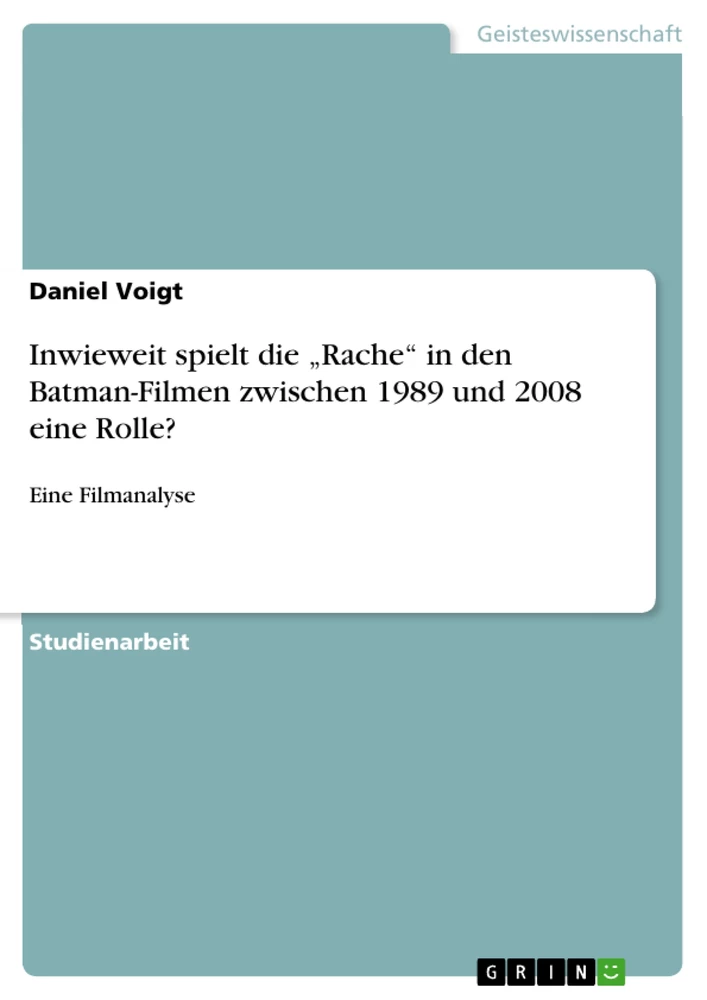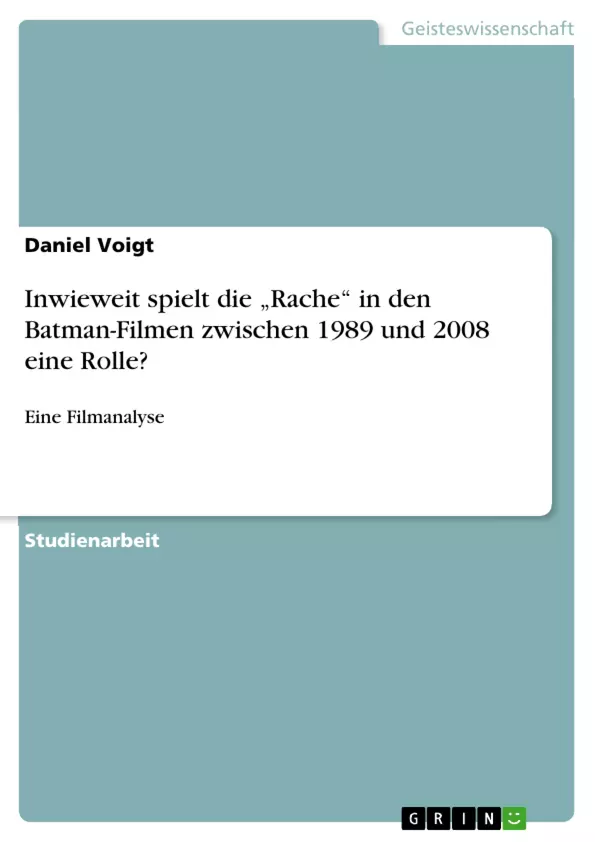1939 erschuf Bob Kane eine Comic-Figur, die bis heute für Aufsehen sorgt. Batman. Eine Figur, hinter dem sich eigentlich der superreiche Bruce Wayne verbirgt, der aber nachts als Batman versucht, als gesetzloser Rächer in Gotham City für Recht und Ordnung zu sorgen. Meine Hausarbeit beschäftigt sich mit den bislang sechs veröffentlichten Batman-Filmen von 1989-2009 und will sich der Frage widmen, inwieweit die „Rache“ in den jeweiligen Verfilmungen eine Rolle spielt. Dabei möchte ich zunächst kurz den Begriff „Rache“ definieren, dann auf die Figur Batman und den damit verbundenen Comic sowie die Handlungen der Realverfilmungen eingehen, daraufhin anhand der Filme die oben genannte Frage analysieren, bevor ich schlussendlich meine Ergebnisse am Ende in einem Fazit noch einmal kurz zusammenfassen möchte.
Inhaltsverzeichnis
- Fragestellung
- Definition des Begriffs „Rache“
- Batman: Der Comic und die Filme
- Der Comic
- Die Batman-Filme zwischen 1989 und 2008
- Batman (Regie: Tim Burton, 1989)
- Batman Returns (Regie: Tim Burton, 1992)
- Batman Forever (Regie: Joel Schumacher, 1995)
- Batman & Robin (Regie: Joel Schumacher, 1997)
- Batman Begins (Regie: Christopher Nolan, 2005)
- The Dark Knight (Regie: Christopher Nolan, 2008)
- Inwieweit spielt die „Rache“ in den Batman-Filmen zwischen 1989 und 2008 eine Rolle?
- Batman (Regie: Tim Burton, 1989)
- Batman Returns (Regie: Tim Burton, 1992)
- Batman Forever (Regie: Joel Schumacher, 1995)
- Batman & Robin (Regie: Joel Schumacher, 1997)
- Batman Begins (Regie: Christopher Nolan, 2005)
- The Dark Knight (Regie: Christopher Nolan, 2008)
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Rolle von Rache in den sechs Batman-Filmen zwischen 1989 und 2008. Die Arbeit beginnt mit einer Definition des Begriffs „Rache“ und beleuchtet anschließend den Batman-Comic als Grundlage für die Filmadaptionen. Die Analyse der Filme konzentriert sich auf die Darstellung und Bedeutung von Rachemotiven in den jeweiligen Handlungssträngen.
- Definition und verschiedene Facetten des Begriffs „Rache“
- Batman als Figur und seine Motivationen
- Die Darstellung von Rache in den einzelnen Batman-Filmen
- Der Einfluss verschiedener Regiestile auf die Darstellung von Rache
- Vergleichende Analyse der Rachemotive über die verschiedenen Filme hinweg
Zusammenfassung der Kapitel
Fragestellung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Rolle der Rache in den Batman-Filmen (1989-2008) und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
Definition des Begriffs „Rache“: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Begriff „Rache“, indem es verschiedene Definitionen und Interpretationen beleuchtet. Es wird zwischen archaischer Blutrache und modernen Formen der Vergeltung unterschieden und die soziale und kulturelle Bedeutung des Rachemotivs diskutiert, unter Einbezug verschiedener theoretischer Perspektiven und Beispiele aus der Realität (z.B. Nahostkonflikt).
Batman: Der Comic und die Filme: Dieses Kapitel stellt den Batman-Comic als Ursprungswerk vor und vergleicht ihn mit den sechs Batman-Filmen. Es dient als Grundlage für die anschließende filmanalytische Untersuchung der Rachemotive.
Inwieweit spielt die „Rache“ in den Batman-Filmen zwischen 1989 und 2008 eine Rolle?: Dieser Abschnitt analysiert die Rolle der Rache in jedem einzelnen Batman-Film (1989-2008) im Detail, wobei der Einfluss des Regisseurs und die jeweilige Darstellung von Rache im Kontext der Handlungsstränge bewertet werden.
Schlüsselwörter
Batman, Rache, Vergeltung, Film, Comic, Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan, Gotham City, Recht und Ordnung, Blutrache, Moral, Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Rache in den Batman-Filmen (1989-2008)
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Rolle der Rache in den sechs Batman-Filmen, die zwischen 1989 und 2008 produziert wurden. Sie analysiert, wie das Motiv der Rache in den jeweiligen Filmen dargestellt wird und welche Bedeutung es für die Handlung und die Charaktere hat.
Welche Filme werden in der Hausarbeit analysiert?
Die Hausarbeit analysiert folgende sechs Batman-Filme: Batman (1989, Regie: Tim Burton), Batman Returns (1992, Regie: Tim Burton), Batman Forever (1995, Regie: Joel Schumacher), Batman & Robin (1997, Regie: Joel Schumacher), Batman Begins (2005, Regie: Christopher Nolan) und The Dark Knight (2008, Regie: Christopher Nolan).
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit ist in mehrere Kapitel gegliedert: Einleitung mit Fragestellung, Definition des Begriffs „Rache“, Analyse des Batman-Comics als Grundlage, detaillierte Analyse der Rachemotive in jedem der sechs Filme, und schließlich ein Fazit. Es werden verschiedene theoretische Perspektiven und Beispiele aus der Realität herangezogen.
Welche Aspekte der Rache werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Facetten des Rachemotivs, inklusive archaischer Blutrache und moderner Formen der Vergeltung. Sie betrachtet die soziale und kulturelle Bedeutung von Rache, den Einfluss des Regisseurstils auf die Darstellung von Rache und vergleicht die Rachemotive über die verschiedenen Filme hinweg.
Welche Rolle spielt der Batman-Comic?
Der Batman-Comic dient als Ausgangspunkt und Grundlage für den Vergleich mit den Filmadaptionen. Die Hausarbeit untersucht, wie der Comic das Motiv der Rache darstellt und wie diese Darstellung in den Filmen aufgegriffen und weiterentwickelt wird.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Batman, Rache, Vergeltung, Film, Comic, Tim Burton, Joel Schumacher, Christopher Nolan, Gotham City, Recht und Ordnung, Blutrache, Moral, Gerechtigkeit.
Welche Forschungsfrage wird in der Hausarbeit gestellt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwieweit spielt die Rache in den Batman-Filmen zwischen 1989 und 2008 eine Rolle?
Wie wird der Begriff "Rache" definiert?
Die Hausarbeit bietet eine umfassende Auseinandersetzung mit dem Begriff „Rache“, indem sie verschiedene Definitionen und Interpretationen beleuchtet und zwischen archaischer Blutrache und modernen Formen der Vergeltung unterscheidet.
- Quote paper
- Daniel Voigt (Author), 2010, Inwieweit spielt die „Rache“ in den Batman-Filmen zwischen 1989 und 2008 eine Rolle?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150664