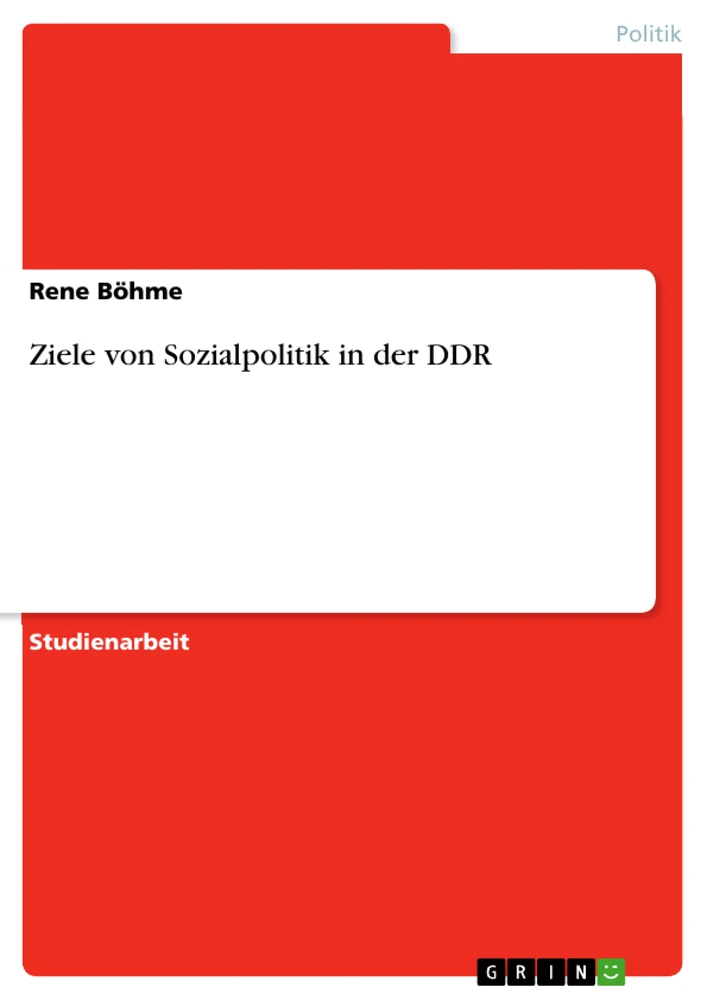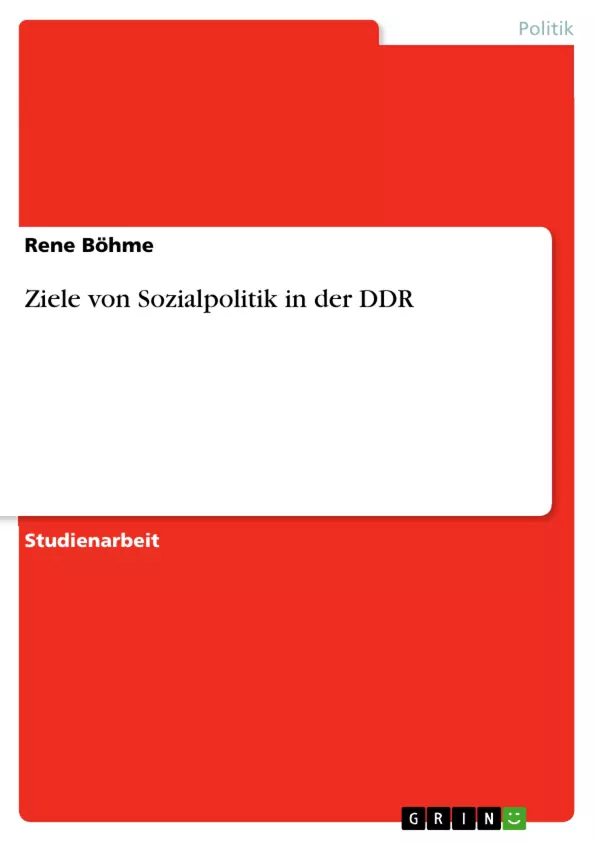Das sozialpolitische System der DDR wird vorgestellt und die Ziele dezidiert herausgearbeitet. Diese werden dann mit modernen westlichen Vorstellungen von Wohlfahrtsstaatlichkeit verglichen und Rückschlüsse auf heutige Entwicklungen gezogen.
Note war 1,3 am Zentrum für Sozialpolitik, Uni Bremen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theorien von Wohlfahrtsstaatlichkeit
- Definition und Abgrenzung
- Entstehungskräfte und Entwicklungsdeterminanten
- Wirkungen und Probleme
- Funktionen und Ziele
- Kernelemente der Sozialpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik
- Recht auf Arbeit
- Sozialversicherung
- soziale Sicherung im Reproduktionsbereich
- Subventionierung des Grundbedarfs
- Familien- und Frauenförderung
- betriebliche Sozialpolitik
- Zusatzversorgungssysteme
- Wohnungspolitik
- Zielsetzungen von Sozialpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik
- soziale Sicherheit durch Gewährung einer Grundversorgung
- einheitliche Absicherung gegen zentrale Lebensrisiken
- Reproduktion bzw. die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Gleichbehandlung und Chancengleichheit
- Wohnungsfürsorge
- Arbeitsplatzgarantie, ökonomische Funktion und betriebliche Sozialpolitik
- Legitimierung und Stabilisierung des Systems, Klassenkampffunktion
- Vergleich und Bewertung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Zielen der Sozialpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR). Sie untersucht, inwieweit die Aufgaben und Ziele der DDR-Sozialpolitik mit dem heutigen westlichen Verständnis von Wohlfahrtsstaatlichkeit übereinstimmen. Dazu wird zunächst ein Überblick über die Theorien von Wohlfahrtsstaatlichkeit gegeben, bevor die Wesensmerkmale des sozialen Sicherungssystems der DDR beleuchtet werden. Anschließend werden die zentralen Zielsetzungen der DDR-Sozialpolitik herausgearbeitet und mit den heutigen Auffassungen verglichen.
- Theorien von Wohlfahrtsstaatlichkeit und deren Einfluss auf die Entwicklung der Sozialpolitik
- Wesensmerkmale des sozialen Sicherungssystems der DDR
- Zentrale Zielsetzungen der Sozialpolitik in der DDR
- Vergleich der DDR-Sozialpolitik mit heutigen Wohlfahrtsstaatskonzepten
- Bewertung der Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert die Zielsetzung und den methodischen Ansatz. Sie beleuchtet die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der DDR-Sozialpolitik und dem heutigen westlichen Wohlfahrtsstaat.
- Theorien von Wohlfahrtsstaatlichkeit: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die wichtigsten Theorien von Wohlfahrtsstaatlichkeit und deren unterschiedliche Perspektiven auf Entstehung, Entwicklung und Funktion von Sozialpolitik. Es werden verschiedene Ansätze wie die sozioökonomische Determination, der Machtressourcenansatz, die Parteiendifferenzlehre, die politisch-institutionelle Betrachtungsweise, die Internationale Hypothese und die Politik-Erblastthese vorgestellt.
- Kernelemente der Sozialpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik: In diesem Kapitel werden die wichtigsten Elemente der Sozialpolitik in der DDR vorgestellt, darunter das Recht auf Arbeit, die Sozialversicherung, die soziale Sicherung im Reproduktionsbereich (Subventionierung des Grundbedarfs, Familien- und Frauenförderung), die betriebliche Sozialpolitik und die Zusatzversorgungssysteme.
- Zielsetzungen von Sozialpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik: Hier werden die zentralen Zielsetzungen der Sozialpolitik in der DDR erläutert, darunter die soziale Sicherheit durch Gewährung einer Grundversorgung, die einheitliche Absicherung gegen zentrale Lebensrisiken, die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, die Gleichbehandlung und Chancengleichheit, die Wohnungsfürsorge, die Arbeitsplatzgarantie, die ökonomische Funktion und die betriebliche Sozialpolitik.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Zielen und Funktionen von Sozialpolitik in der Deutschen Demokratischen Republik. Zu den wichtigsten Themen und Begriffen gehören: Wohlfahrtsstaatlichkeit, Sozialpolitik, DDR, soziales Sicherungssystem, Recht auf Arbeit, Sozialversicherung, soziale Sicherung im Reproduktionsbereich, Familien- und Frauenförderung, betriebliche Sozialpolitik, Wohnungspolitik, soziale Sicherheit, Grundversorgung, Absicherung gegen Lebensrisiken, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gleichbehandlung, Chancengleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die zentralen Ziele der Sozialpolitik in der DDR?
Zentrale Ziele waren die Gewährleistung sozialer Sicherheit durch eine Grundversorgung, die einheitliche Absicherung gegen Lebensrisiken, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie die Systemstabilisierung durch das Recht auf Arbeit.
Welche Rolle spielte das "Recht auf Arbeit" im DDR-Sozialsystem?
Das Recht auf Arbeit war ein Kernelement, das nicht nur ökonomische Sicherheit bot, sondern auch als Instrument zur sozialen Integration und politischen Legitimation des Staates diente.
Wie unterschied sich die DDR-Sozialpolitik von westlichen Wohlfahrtsstaaten?
Während westliche Systeme oft auf Pluralismus und Marktmechanismen setzen, war die DDR-Sozialpolitik stark zentralistisch, betrieblich orientiert und eng mit der Ideologie des Klassenkampfes verknüpft.
Was bedeutete "soziale Sicherung im Reproduktionsbereich"?
Dies umfasste Maßnahmen wie die staatliche Subventionierung von Grundbedürfnissen (Mieten, Lebensmittel) sowie eine gezielte Frauen- und Familienförderung.
Welche Bedeutung hatte die betriebliche Sozialpolitik?
Betriebe waren in der DDR zentrale Orte der sozialen Versorgung, die über die reine Arbeit hinaus Leistungen wie Kinderbetreuung, Ferienplätze und Gesundheitsvorsorge organisierten.
- Arbeit zitieren
- Dipl. Sozpäd./Sozarb. (FH) Rene Böhme (Autor:in), 2009, Ziele von Sozialpolitik in der DDR, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150677