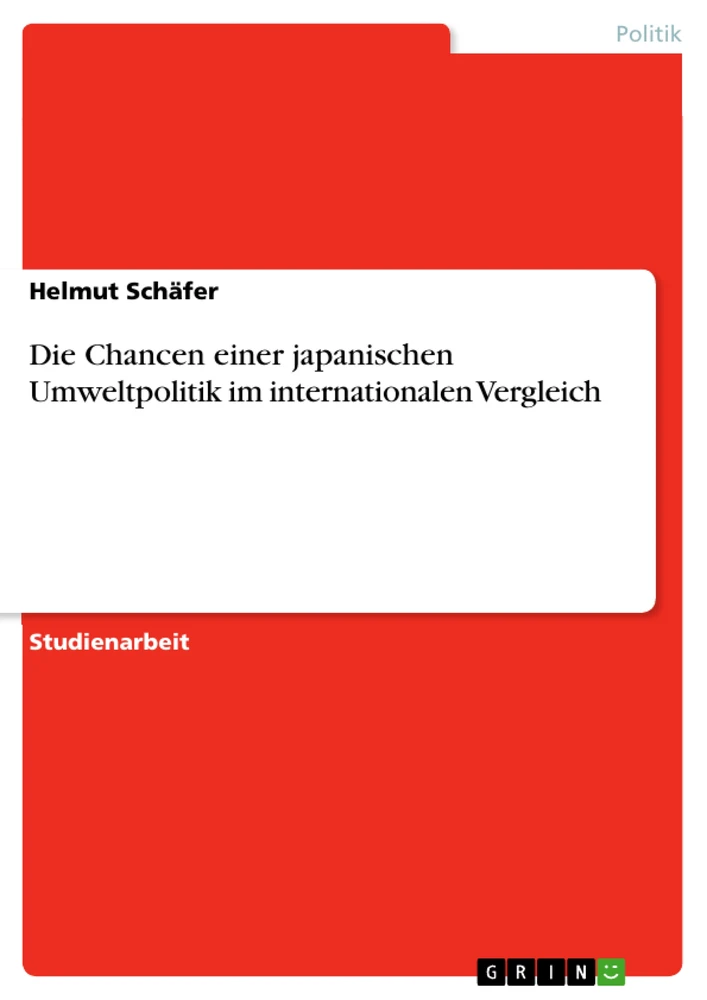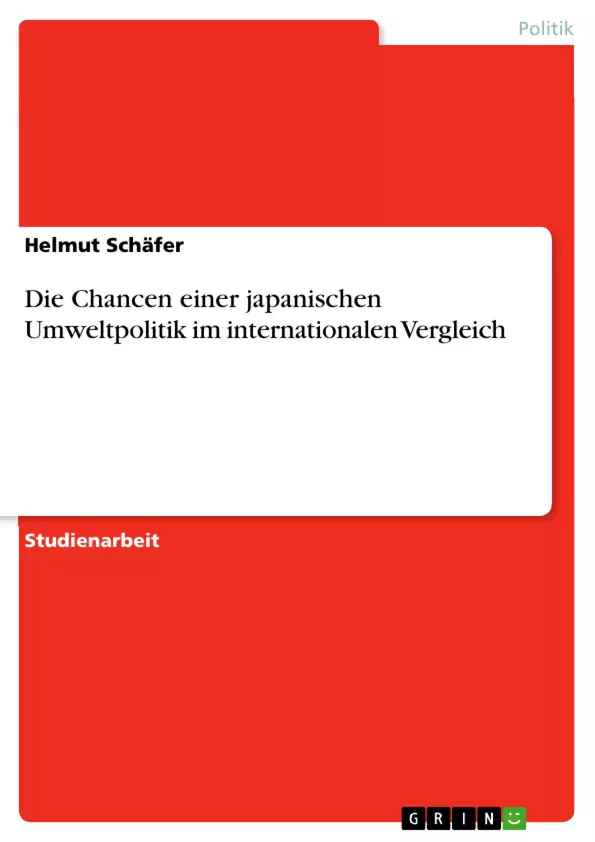"Die Frage lautet nicht mehr, ob wir aus Qualitätsbewußtsein eine mehr oder weniger schöne und saubere Umwelt schaffen oder auch zugunsten anderer Ziele darauf verzichten wollen. Die Umweltfrage ist selbst zur Überlebensfrage der Menschheit geworden."
In den hochentwickelten Industrienationen der heutigen Zeit ist die Frage nach der Legitimität eines ungebremsten Forschungsfortschritts sehr entscheidend geworden. Wieweit kann der Mensch die Technik zu seinen Gunsten entwickeln und nutzen, ohne sich seine eigene Existenzgrundlage zu zerstören?
Japan ist ein Land, das innerhalb der letzten Jahrzehnte in rasantem Tempo an die Spitze der Wirtschaftsmächte aufgestiegen ist. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit den ökologischen Auswirkungen, die aus dieser ökonomischen Entwicklung resultieren.
Hierzu werden zunächst die naturgegebenen Voraussetzungen in diesem Land beleuchtet (Kapitel 2). Geologie, Klima und Vegetation sind hierbei Indikatoren wie das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Verstädterung.
Neben dieser Bestandsaufnahme sollen die umweltpolitischen Handlungsmöglichkeiten des Landes untersucht werden (Kapitel 3). Hierbei werden vor allem die Politik der Nachkriegszeit und noch offene Problembereiche aufgezeigt.
Am Ende steht ein internationaler Vergleich der Umweltpolitik (Kapitel 4). Es werden unter anderem gesetzliche Regelungen und staatliche Initiativen zum Umweltschutz verglichen, aber auch die diesbezügliche internationale Kooperation soll untersucht werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITENDE VORBEMERKUNG
- ALLGEMEINE VORAUSSETZUNGEN
- NATURGEOGRAPHIE JAPANS
- Geologie
- Klima
- Vegetation
- BEVÖLKERUNGSENTWICKLUNG
- Bevölkerungswachstum
- Urbanisation und Landflucht
- NATURGEOGRAPHIE JAPANS
- DIE UMWELTPOLITISCHEN HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN UND DIE ÖKONOMISCHE KALKULATION IN JAPAN
- ENTWICKLUNG DER UMWELTPOLITIK
- Die drei Stufen japanischer Umweltpolitik in der Nachkriegszeit bis 1975
- Die ungelösten Problembereiche
- DIE AKTUELLE UMWELTPOLITIK UND INNOVATIONSMÖGLICHKEITEN JAPANISCHER (ÖKO-)TECHNOLOGIE
- ENTWICKLUNG DER UMWELTPOLITIK
- INTERNATIONALER VERGLEICH DER UMWELTPOLITIK
- GESETZLICHE REGELUNGEN
- AKTIVITÄTEN MIT BÜRGERBETEILIGUNG
- STAATLICHE INITIATIVEN
- INTERNATIONALE KOOPERATIONEN
- ZUSAMMENFASSUNG UND ABSCHLIEBENDE STELLUNGNAHME
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ökologischen Auswirkungen der rasanten Wirtschaftsentwicklung Japans. Im Vordergrund steht die Analyse der umweltpolitischen Handlungsmöglichkeiten und deren Wirksamkeit im Kontext der naturgegebenen Bedingungen und der Bevölkerungsentwicklung.
- Naturgeographie Japans und deren Einfluss auf die Umweltproblematik
- Entwicklung der japanischen Umweltpolitik und deren Herausforderungen
- Ökologische Auswirkungen der Wirtschaftsentwicklung und des Bevölkerungswachstums
- Internationaler Vergleich der Umweltpolitik mit Fokus auf gesetzliche Regelungen, Bürgerbeteiligung und staatliche Initiativen
- Bewertung der Chancen und Grenzen einer effektiven Umweltpolitik in Japan
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2: Allgemeine Voraussetzungen
Dieses Kapitel beleuchtet die naturgegebenen Bedingungen Japans, indem es die Geologie, das Klima und die Vegetation des Landes analysiert. Es wird deutlich, dass die spezifische Geographie des Landes, insbesondere die tektonische Labilität, einen bedeutenden Einfluss auf die Umweltproblematik hat. Weiterhin wird die Bevölkerungsentwicklung Japans, insbesondere das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Verstädterung, im Kontext der ökologischen Herausforderungen diskutiert.
Kapitel 3: Die umweltpolitischen Handlungsmöglichkeiten und die ökonomische Kalkulation in Japan
Das Kapitel analysiert die Entwicklung der japanischen Umweltpolitik, insbesondere die drei Stufen der Politik in der Nachkriegszeit bis 1975. Es beleuchtet auch die ungelösten Problembereiche und skizziert die aktuelle Umweltpolitik sowie die Innovationspotenziale der japanischen (Öko-)Technologie.
Kapitel 4: Internationaler Vergleich der Umweltpolitik
Dieses Kapitel vergleicht die japanische Umweltpolitik mit der anderer Länder. Es analysiert gesetzliche Regelungen, Aktivitäten mit Bürgerbeteiligung, staatliche Initiativen und die internationale Zusammenarbeit im Bereich des Umweltschutzes. Es zeigt die Stärken und Schwächen der japanischen Umweltpolitik im internationalen Kontext auf.
Schlüsselwörter
Umweltpolitik, Japan, Wirtschaftsentwicklung, Naturgeographie, Bevölkerungswachstum, Urbanisation, Ökologie, Nachhaltigkeit, Internationale Kooperation, Gesetzesgebung, Bürgerbeteiligung, Innovation, (Öko-)Technologie
Häufig gestellte Fragen zur Umweltpolitik Japans
Wie beeinflusst die Geographie Japans die Umweltproblematik?
Die tektonische Labilität, das spezifische Klima und die begrenzte nutzbare Fläche prägen die ökologischen Herausforderungen des Landes.
Was sind die Hauptursachen für Japans Umweltprobleme?
Der rasante wirtschaftliche Aufstieg zur Wirtschaftsmacht, das Bevölkerungswachstum und die extreme Urbanisierung sind zentrale Faktoren.
Welche Phasen der Umweltpolitik gab es in Japan nach dem Krieg?
Die Arbeit unterscheidet drei Stufen der Umweltpolitik in der Nachkriegszeit bis zum Jahr 1975.
Welche Rolle spielt die Technologie im japanischen Umweltschutz?
Japan setzt stark auf Innovationspotenziale in der (Öko-)Technologie, um ökonomisches Wachstum und Ökologie zu vereinbaren.
Wie schneidet Japan im internationalen Vergleich ab?
Die Arbeit vergleicht gesetzliche Regelungen, staatliche Initiativen und die Bürgerbeteiligung mit anderen hochindustrialisierten Nationen.
Was ist das Ziel der internationalen Kooperation Japans?
Japan beteiligt sich an globalen Klimaschutz-Maßnahmen und dem Austausch von Umwelttechnologien zur Sicherung der Existenzgrundlage der Menschheit.
- Quote paper
- Helmut Schäfer (Author), 1993, Die Chancen einer japanischen Umweltpolitik im internationalen Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150683