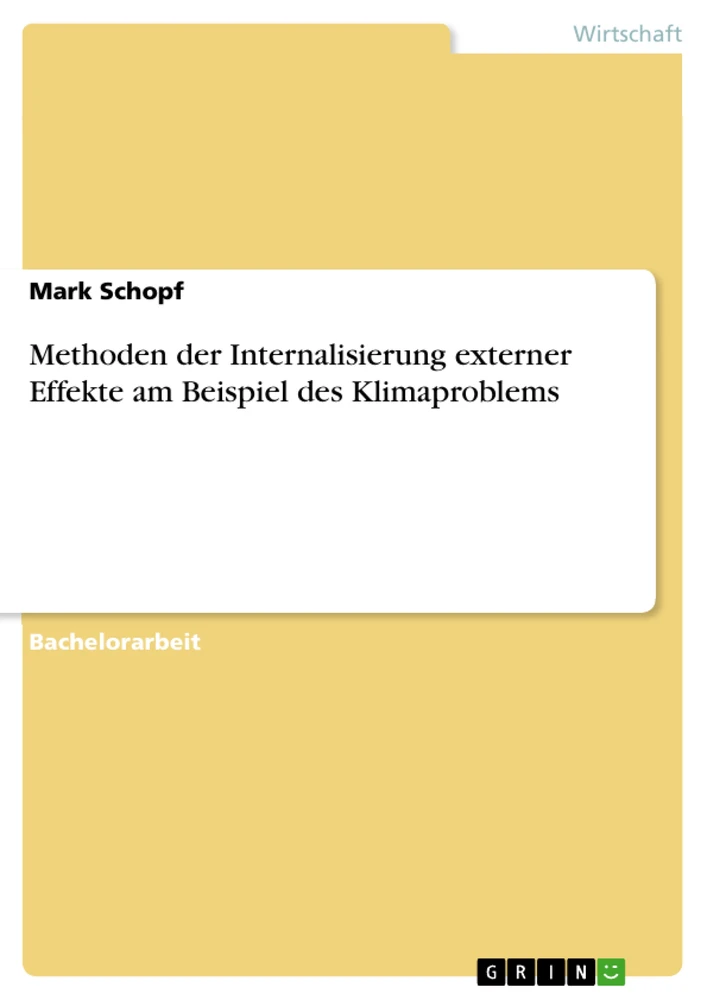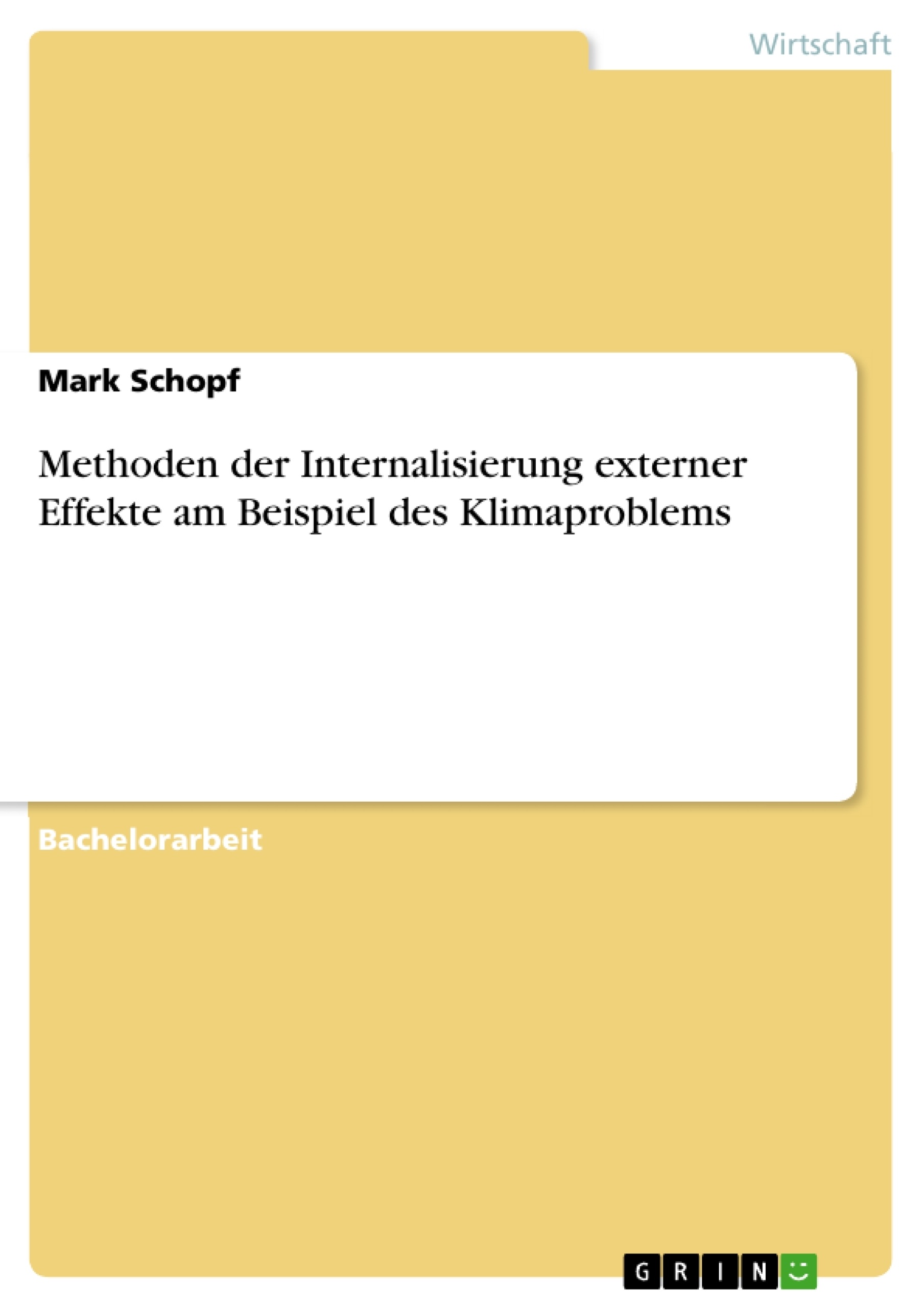Ein Klima ohne Wandel ist ein wertvolles Gut. Diese Aussage wird von Studien bestätigt, welche die jährlichen volkswirtschaftlichen Schäden, die durch eine um vier Grad Celsius erhöhte globale Durchschnittstemperatur entstünden, auf ein bis fünf Prozent des weltweiten Bruttoinlandsproduktes schätzen. So wären beispielsweise hunderte Millionen Menschen einer erhöhten Wasserknappheit ausgesetzt, mehr als vierzig Prozent der Arten würden aussterben und viele Millionen Menschen wären zusätzlich von Küstenüberflutungen betroffen. Trotzdem vollzieht sich zurzeit ein Klimawandel, der nicht nur auf natürliche, sondern auch auf menschliche Einflüsse zurückzuführen ist. Die resultierende Fragestellung lautet:
• Warum lassen wir den Klimawandel zu, obwohl die resultierenden Schäden sehr hoch sein werden?
Diese Fragestellung wird im zweiten Kapitel dieser Arbeit behandelt. Dazu wird zunächst der Begriff der externen Effekte erläutert, um diese im folgenden Abschnitt mit dem Klimaproblem in Verbindung zu bringen. Die Zwischenergebnisse werden anhand von Formeln und Abbildungen an einem Beispiel verdeutlicht. Es wird sich herausstellen, dass der Klimawandel prinzipiell aufgehalten werden kann, was jedoch mit hohen volkswirtschaftlichen Kosten verbunden wäre. Daraus ergibt sich folgende Frage:
• Wie können wir den Klimawandel aufhalten, ohne die resultierenden Kosten unnötig hoch werden zu lassen?
Dieser Fragestellung widmet sich das dritte Kapitel dieser Arbeit. Dazu werden verschiedene Methoden, wie der Klimawandel aufgehalten werden könnte, insbesondere hinsichtlich ihrer Effizienzeigenschaften untersucht. Dies wird auch mit Hilfe des zuvor eingeführten Beispiels getan. Dabei wird mit den First-Best-Lösungen begonnen, um Schlussfolgerungen bezüglich der besten praktisch umsetzbaren Methode ziehen zu können. Die nächsten Abschnitte beschäftigen sich mit den Second-Best-Lösungen und der Auflagenpolitik. Letztere wird anhand der deutschen Gesetzgebung erläutert, um ihre Relevanz in der Realität zu verdeutlichen. Da das Klimaproblem nicht national eingeschränkt werden kann, ergibt sich folgende Frage:
• Was müssen wir bei der Klimapolitik beachten, wenn die Betrachtung global ausgeweitet wird?
Diese Fragestellung wird im vierten Kapitel dieser Arbeit behandelt. Dazu werden zunächst die Ergebnisse aus dem dritten Kapitel zusammengefasst, um darzulegen, welche Methoden sich als die überlegenen herausgestellt haben...
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserläuterungen
- 2.1 Internalisierung externer Effekte ...
- 2.2 ... am Beispiel des Klimaproblems
- Exkurs: Das Öffentliche-Gut-Problem
- 3. Methoden
- 3.1 First-Best-Lösungen
- 3.1.1 Pigou-Steuer
- 3.1.2 Coase-Theorem
- Exkurs: Das Informationsproblem
- 3.2 Second-Best-Lösungen
- 3.2.1 Standard-Preis-Ansatz
- 3.2.2 Handelbare Eigentumsrechte
- Exkurs: Standard-Preis-Ansatz oder handelbare Eigentumsrechte?
- 3.3 Auflagenpolitik
- Exkurs: Auflagenpolitik im System handelbarer Eigentumsrechte
- 3.1 First-Best-Lösungen
- 4. Notwendigkeit einer globalen Umsetzung
- 5. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert verschiedene Methoden der Internalisierung externer Effekte am Beispiel des Klimaproblems. Ziel ist es, die verschiedenen Ansätze und ihre Effizienz im Hinblick auf die Bewältigung der Klimaproblematik zu beurteilen.
- Internalisierung externer Effekte
- Klimaproblematik
- First-Best- und Second-Best-Lösungen
- Pigou-Steuer, Coase-Theorem, Standard-Preis-Ansatz, handelbare Eigentumsrechte und Auflagenpolitik
- Notwendigkeit einer globalen Umsetzung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik der Externalitäten und ihrer Internalisierung ein. Es wird auf das Klimaproblem als Beispiel für eine negative Externalität eingegangen. Das zweite Kapitel widmet sich der Erläuterung verschiedener Internalisierungsmethoden, beginnend mit First-Best-Lösungen wie der Pigou-Steuer und dem Coase-Theorem. Das dritte Kapitel befasst sich mit Second-Best-Lösungen, darunter der Standard-Preis-Ansatz, handelbare Eigentumsrechte und Auflagenpolitik. Kapitel 4 beleuchtet die Notwendigkeit einer globalen Umsetzung der Internalisierungsmaßnahmen zur Bewältigung des Klimaproblems. Das fünfte Kapitel fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen der Internalisierung externer Effekte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Klimaproblem. Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Externalitäten, Umweltökonomie, Pigou-Steuer, Coase-Theorem, Standard-Preis-Ansatz, handelbare Eigentumsrechte, Auflagenpolitik, globale Zusammenarbeit.
Häufig gestellte Fragen
Was sind "externe Effekte" im Zusammenhang mit dem Klima?
Externe Effekte entstehen, wenn Handlungen von Marktteilnehmern Auswirkungen auf Unbeteiligte haben, ohne dass diese über den Preismechanismus abgegolten werden – beim Klima etwa durch CO2-Emissionen, die globale Schäden verursachen.
Wie funktioniert die Pigou-Steuer?
Die Pigou-Steuer ist eine "First-Best-Lösung", bei der der Verursacher einer Externalität eine Steuer in Höhe der Grenzkosten des Schadens zahlt, um sein Verhalten ökonomisch zu korrigieren.
Was besagt das Coase-Theorem?
Das Coase-Theorem geht davon aus, dass private Verhandlungen zwischen Beteiligten zu einer effizienten Lösung führen, sofern Eigentumsrechte klar definiert und Transaktionskosten vernachlässigbar sind.
Was ist der Unterschied zwischen Steuern und handelbaren Zertifikaten?
Während eine Steuer den Preis für Emissionen festlegt, begrenzen handelbare Eigentumsrechte (Zertifikate) die Gesamtmenge der Emissionen ("Cap and Trade"), wobei sich der Preis am Markt bildet.
Warum ist eine globale Umsetzung der Klimapolitik notwendig?
Da das Klima ein öffentliches Gut ist, führen nationale Alleingänge oft zu Trittbrettfahrer-Problemen. Nur eine globale Internalisierung der Effekte kann den weltweiten Klimawandel effizient aufhalten.
- Quote paper
- Mark Schopf (Author), 2009, Methoden der Internalisierung externer Effekte am Beispiel des Klimaproblems, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150709