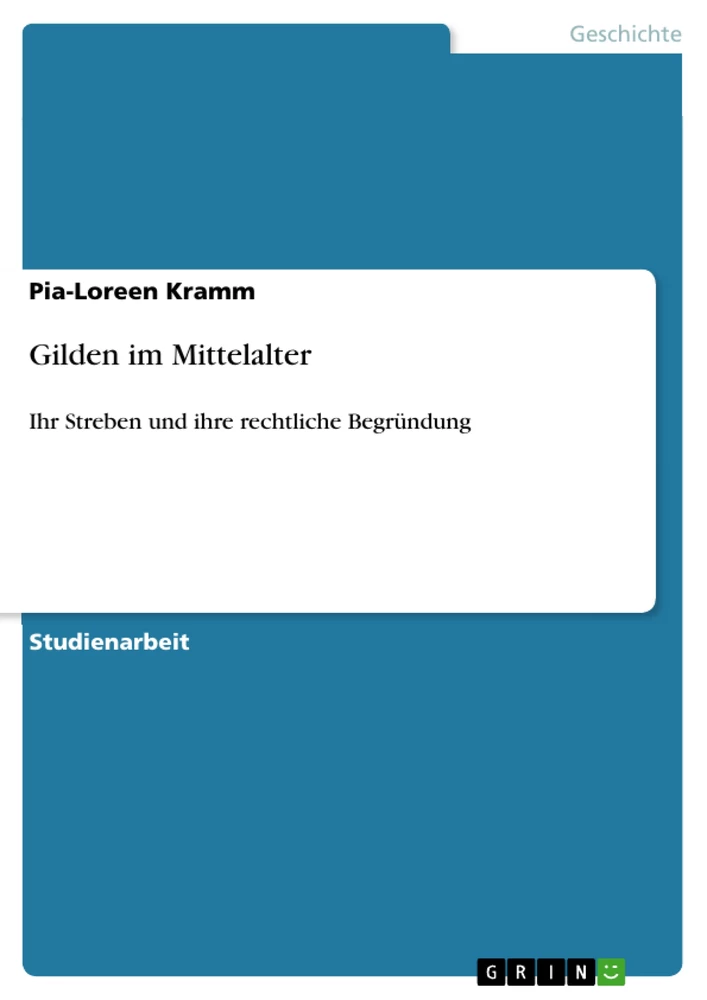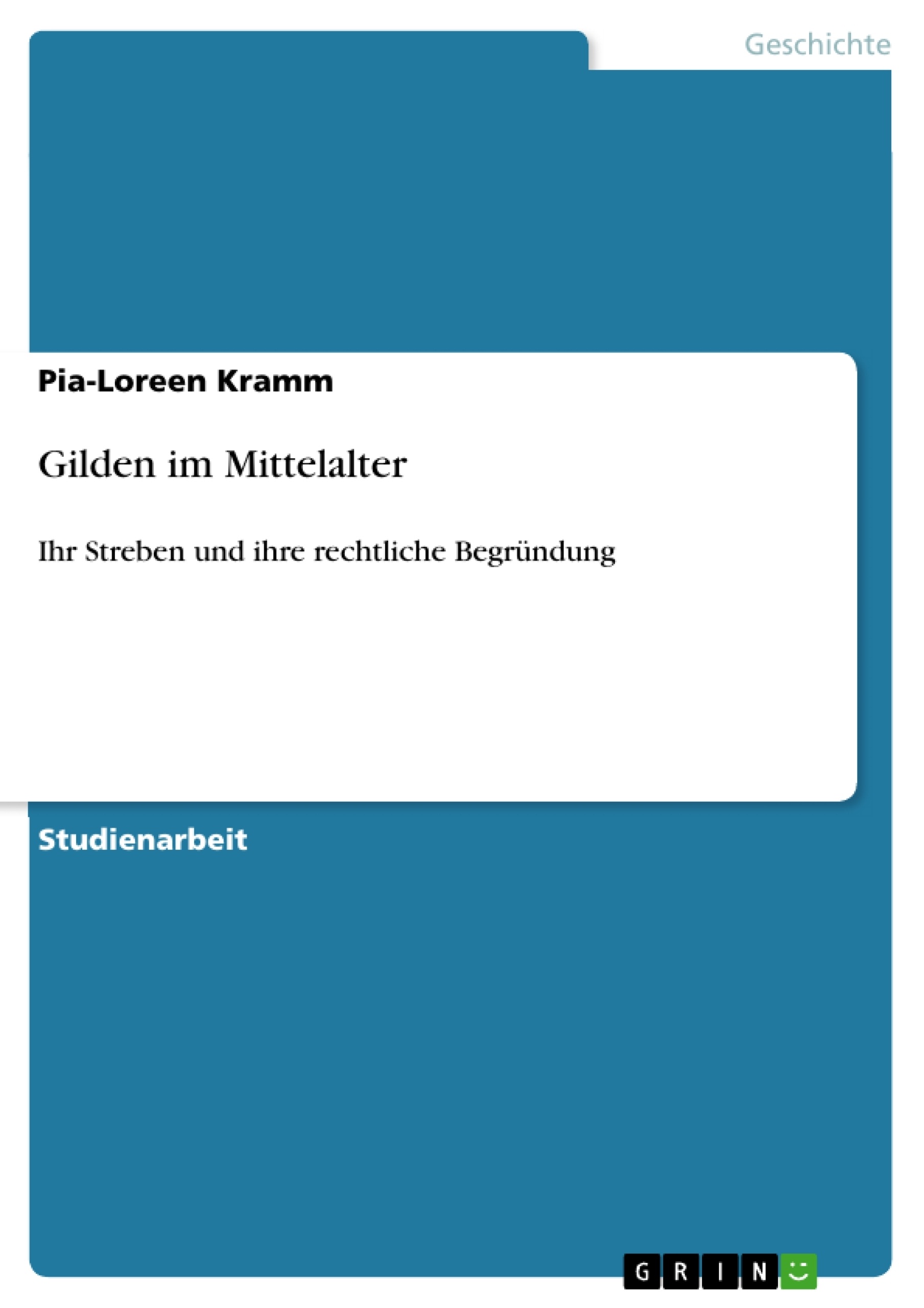Die Klärung der rechtlichen Stellung und Privilegien der Gilden sowie ihrer Merkmale, Aufnahmebedingungen und weitreichenden Folgen in der mittelalterlichen Gesellschaft und eben auch für die Stadtentwicklung, wurde und wird eine große Bedeutung beigemessen.
Aufgrund dessen möchte ich mich in meiner Hausarbeit dem Thema:"Gilden im Mittelalter - ihr Streben und ihre rechtliche Begründung" widmen. Mich dabei jedoch auf die Blütezeit der
Kaufleutegenossenschaft beschränken und ihre Frühformen und den Verlust ihrer Funktionen im Verlauf nur erwähnen.
Da es im Mittelalter nur sehr begrenzt zur schriftlichen Fixierung kam, und neben den Statuten und Rechtstexten, Kaufmannsbücher, die Auskunft über private Eindrücke vermittelten, wohl eher die Ausnahme waren, fällt es schwer konkrete Aussagen zum Beispiel über das soziale Leben der Gilde zu treffen.
Trotz der schwierigen Quellenlage ist die Gilde doch ein viel und oft behandeltes Thema, das besonders häufig im Zusammenhang mit Zunft und Innung Eingang in die Forschung findet.
Auch bei der Gliederung meiner Arbeit war ich bemüht dies zu berücksichtigen, indem ich den Gildebegriff erst versuche zu definieren, um ihn anschließend in Abgrenzung zu den anderen
Genossenschaften zu stellen.
Des weiteren gehe ich auf die drei wesentlichen Punkte ein, die beim Eintritt in die Gilde von Nöten waren, und in diesem Zusammenhang auch auf die Beträge, die damit fällig wurden.
Einen Schwerpunkt setzte ich in meiner Hausarbeit in den Gildemerkmalen, die ich einzeln unterteile und deren Aussagekraft für die Gilde somit noch unterstrichen werden soll.
Als wesentlich kann auch die Rechtsgültigkeit und das Privileg erachten. Auf die ich durch das Klären von Bedeutsamkeit für Privilegiengeber und -empfänger und die damit verbundenen Rechte und Pflichten, näher eingehen möchte.
Zuletzt will ich auch auf die weitergehenden Auswirkungen der Gilde zu sprechen kommen, den Einfluss dieser Verbindung beleuchten und ihre Vorbildfunktion für die Stadtentwicklung hinterfragen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gilden im Mittelalter - Begriff
- Gilde
- Abgrenzungen
- Zugangsvoraussetzungen
- Erwerb der Bürgerrechte
- Nachweis über eheliche Geburt
- "Ehrbarer Lebenswandel"
- Beiträge
- Merkmale
- Gemeinschaft des Berufes
- Ortsansässigkeit
- Eidgenossenschaft
- Ein bruderschaftliches Verhältnis
- Das Convivium
- Gildehäuser
- Religiosität – in Kult und Totenmemoria
- Hilfe, Frieden und Schutz
- Organisation und personelle Strukturierung
- Gildekasse – Umgang mit Geld und Reichtum
- Rechtsgültigkeit und Privileg
- Privileg – seine Bedeutung, Donatoren und Empfänger
- Konkrete Rechte und Pflichten
- Privilegien und Rechte an Boden gebunden
- Verfassung und Rechtsgültigkeit in der mittelalterlichen Stadt
- Weiterentwicklung des Marktrechts zum Kaufmannsrecht
- Weitergehende Auswirkungen der Gilde
- Einfluss der Gilde – Verhältnis von Rat und Gilde in der Stadt
- Vorbildfunfktion für die Stadtentwicklung
- Abschlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der rechtlichen Stellung und den Privilegien der Gilden im Mittelalter, ihren Merkmalen, Aufnahmebedingungen und weitreichenden Folgen für die mittelalterliche Gesellschaft und die Stadtentwicklung. Der Fokus liegt auf der Blütezeit der Kaufleutegenossenschaft, während die Frühformen und der Verlust ihrer Funktionen im Verlauf nur erwähnt werden.
- Definition des Begriffs "Gilde" und Abgrenzung zu ähnlichen Genossenschaften
- Analyse der Zugangsvoraussetzungen und der damit verbundenen finanziellen Verpflichtungen
- Erforschung der wichtigsten Merkmale der Gilden, wie Gemeinschaft, Ortsansässigkeit, Eidgenossenschaft und religiöse Aspekte
- Untersuchung der Rechtsgültigkeit und der Privilegien der Gilden, einschließlich ihrer Bedeutung, der Rechte und Pflichten sowie der Beziehung zum städtischen Rechtssystem
- Bewertung des Einflusses der Gilden auf die Stadtentwicklung und ihre Vorbildfunktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und die Zielsetzung der Arbeit vor. Sie beleuchtet die Bedeutung des Themas und die Herausforderungen der Quellenlage.
Kapitel 2 definiert den Begriff "Gilde" und grenzt ihn von anderen Genossenschaften ab. Es analysiert die verschiedenen Bedeutungen des Begriffs in unterschiedlichen Regionen und beleuchtet die Problematik der Quellenlage.
Kapitel 3 beschäftigt sich mit den Zugangsvoraussetzungen für den Beitritt in eine Gilde, darunter die Erwerbung der Bürgerrechte, den Nachweis der ehelichen Geburt, den "ehrbaren Lebenswandel" und die finanziellen Verpflichtungen.
Kapitel 4 untersucht die wichtigsten Merkmale der Gilden, wie Gemeinschaft des Berufes, Ortsansässigkeit, Eidgenossenschaft, ein bruderschaftliches Verhältnis, das "Convivium", Religiosität, Hilfe und Schutz, Organisation und personelle Strukturierung sowie die Gildekasse.
Kapitel 5 beleuchtet die Rechtsgültigkeit und die Privilegien der Gilden. Es analysiert die Bedeutung der Privilegien für Donatoren und Empfänger, die damit verbundenen Rechte und Pflichten sowie die Verfassung und Rechtsgültigkeit der Gilden im städtischen Kontext.
Kapitel 6 untersucht den Einfluss der Gilden auf die Stadtentwicklung und ihre Vorbildfunktion. Es analysiert das Verhältnis von Rat und Gilde in der Stadt und die Bedeutung der Gilden für die städtische Ordnung und Entwicklung.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen und Themen der mittelalterlichen Kaufmannsgenossenschaften. Im Fokus stehen die rechtliche Begründung und die soziale Bedeutung der Gilden sowie ihre Auswirkungen auf die Stadtentwicklung. Wichtige Schlüsselwörter sind: Gilde, Privileg, Recht, Stadt, mittelalterliche Gesellschaft, Kaufleute, Handwerk, Zunft, Eidgenossenschaft, Convivium, Rechtsgültigkeit, Einfluss, Vorbildfunktion.
Häufig gestellte Fragen
Was war die Hauptaufgabe mittelalterlicher Gilden?
Gilden waren Kaufleutegenossenschaften, die ihren Mitgliedern Schutz, Frieden und gegenseitige Hilfe garantierten sowie wirtschaftliche Privilegien sicherten.
Wie wurde man Mitglied einer Gilde?
Voraussetzungen waren der Erwerb der Bürgerrechte, der Nachweis einer ehelichen Geburt, ein „ehrbarer Lebenswandel“ und die Zahlung von Beiträgen.
Was ist ein „Convivium“?
Das Convivium bezeichnete das gemeinsame Mahl und gesellige Beisammensein in Gildehäusern, das den bruderschaftlichen Zusammenhalt stärkte.
Welchen Einfluss hatten Gilden auf die Stadtentwicklung?
Gilden hatten oft eine Vorbildfunktion für die städtische Verfassung; ihre Mitglieder stellten häufig den Rat und prägten die Rechtsordnung der Stadt.
Was bedeuteten Privilegien für eine Gilde?
Privilegien waren rechtliche Sonderstellungen, die vom Landesherrn verliehen wurden und konkrete Rechte wie Marktzölle oder Handelsmonopole beinhalteten.
- Arbeit zitieren
- Pia-Loreen Kramm (Autor:in), 2010, Gilden im Mittelalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150728