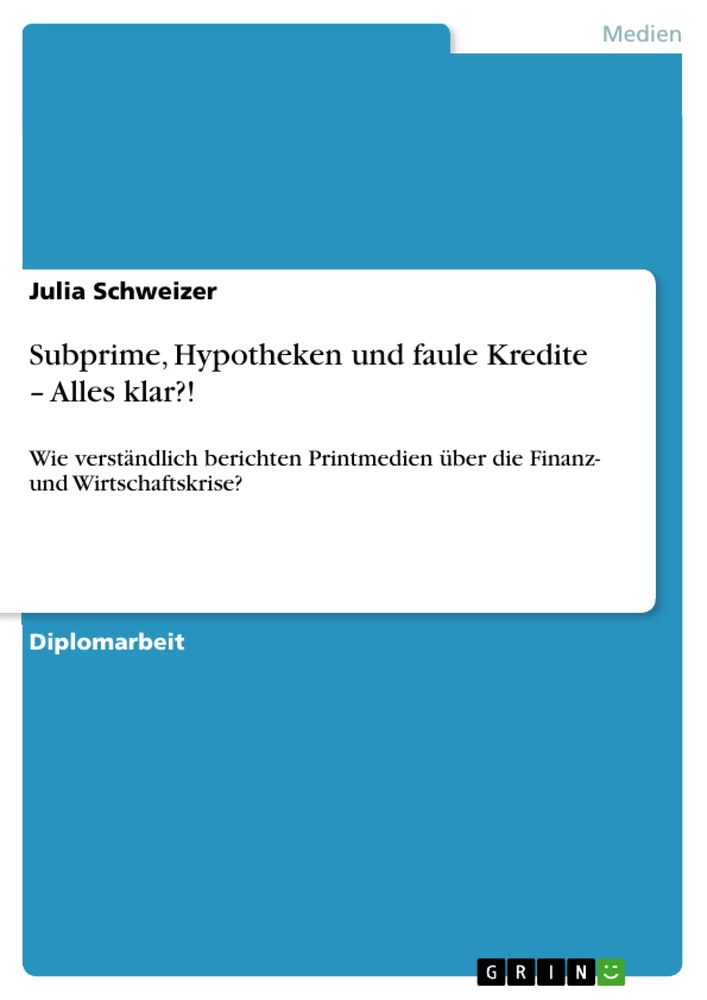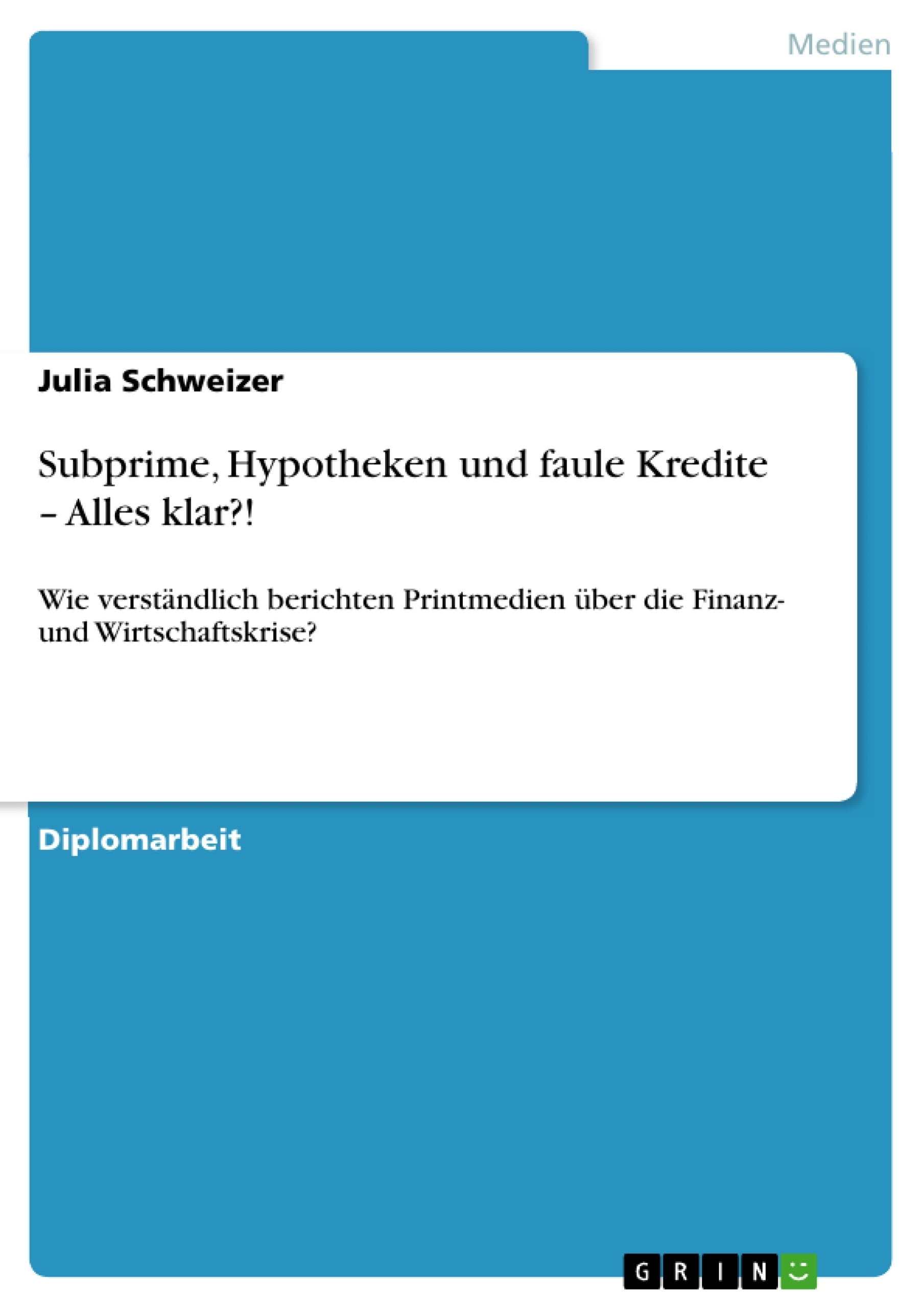Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Verständlichkeit der Wirtschaftsberichterstattung in Tageszeitungen. Denn laut Auftrag sollen Journalisten u.a. informieren und vermitteln – gerade in Bereichen, die für Menschen von großer Bedeutung sind, deren komplexe Zusammenhänge sie aber nur schwer begreifen können. Dazu gehört auch „die Wirtschaft“, die in jüngster Zeit immer komplexer geworden zu sein scheint. Doch gleichzeitig übten und üben Autoren an kaum einem anderen Teil von Zeitungen mehr Kritik als am Wirtschaftsressort und dessen Verständlichkeit.
Der theoretische Teil der Arbeit beginnt mit einem Überblick über den Wirtschaftsjournalismus – mit dessen Definition sich Wissenschaftler offenbar ebenso schwer tun wie viele Praktiker mit einer verständlichen Sprache, wie die Darstellung der Kritik zeigt – sowie der Geschichte der seit 2007 andauernden Finanz- und Wirtschaftskrise und der Berichterstattung über diesen Zeitraum. Hinführend auf den empirischen Teil befasst sich ein weiteres Kapitel mit der Verständlichkeitsforschung. Schwerpunkt ist dabei der Teilbereich der Lesbarkeitsforschung mit ihren Formeln und den gemessenen Variablen, Basis für die anschließende Untersuchung. Für diese wurden mithilfe einer speziellen Software mehr als 800 Artikel dreier Tageszeitungen untersucht und die Wirtschaftsberichterstattung auf ihre Verständlichkeit geprüft. Dabei sind – da „Wirtschaft“ ein Querschnittsthema ist – andere Ressorts ebenso mit einbezogen wie unterschiedliche journalistische Stilformen. Zusätzlich werden exemplarische Verbesserungsvorschläge für einige von der Software als besonders unverständlich ermittelte Artikel gemacht. In einem eigenen Kapitel werden zudem die verantwortlichen Redakteure der untersuchten Zeitungen befragt, inwieweit „Verständlichkeit“ ein Thema für sie ist, wie versucht wird, sie umzusetzen und welche Möglichkeiten zur Verbesserung die „Textproduzenten“ selber sehen.
Die Arbeit kommt zu dem Schluss, dass es zwar zum Teil erhebliche Unterschiede innerhalb jeder Zeitung, Zeiträume, Ressorts und Stilformen gibt, man aber nicht mehr generell von einer absoluten Unverständlichkeit der Wirtschaftsberichterstattung sprechen kann, wie dies noch vor einigen Jahren geäußert wurde. Allerdings müssen hierbei Einschränkungen des Fazits u.a. durch die gewählte Methode berücksichtigt werden, die ebenfalls umfassend diskutiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Wirtschaftsjournalismus in deutschen Printmedien
- Was ist Wirtschaftsjournalismus?
- Inhalte des Wirtschaftsjournalismus
- Funktion und Aufgaben von Wirtschaftsjournalismus
- Entwicklung des Wirtschaftsjournalismus in den Tageszeitungen
- Die Anfänge: vom Mittelalter bis zur Industriellen Revolution
- Von der Industriellen Revolution bis zu den beiden Weltkriegen
- Die Entwicklung bis in die Gegenwart: Neue Medien fordern heraus
- Kritik am Wirtschaftsjournalismus
- Vorwurf der mangelnden Fachkompetenz
- Wirtschaftsjournalismus: unverständlich?!
- Diskussion und Ausblick
- Die Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007
- Entstehung und Verlauf
- Niedrige Zinssätze und die Immobilienblase in den USA
- Die Immobilienkrise erfasst die Finanzwelt
- Die Krise greift auf die Produktion über
- Bedeutung der Finanz- und Wirtschaftskrise
- Auswirkungen auf die Finanzbranche selber
- Auswirkungen auf die Realwirtschaft und die Bevölkerung
- Berichterstattung über die Finanz- und Wirtschaftskrise
- Kritik I: Zu spät und zu blind – aber auch „sachgerecht und informativ”
- Kritik II: sprachliche Verständlichkeit
- Entstehung und Verlauf
- Verständlichkeit
- Verständlichkeitsforschung und ihre Teilbereiche
- Ansätze zur Messung der Textverständlichkeit
- Lesbarkeitsforschung
- Hamburger Verständlichkeitsmodell
- Groebens Verständlichkeitskonzept
- Die Formeln der Lesbarkeitsforschung
- De Variabeln der Lesbarkeitsformeln
- Die bekanntesten Lesbarkeitsformeln
- Wie können Lesbarkeitsformeln überprüft werden?
- Zusammenfassung und Diskussion
- Vorgehen bei der Analyse der Artikel
- Warum Lesbarkeitsformeln?
- Formeln, Vergleichswerte und zusätzliche Faktoren
- Arbeit mit der Analyse-Software TextLab
- Auswahl der Medien
- Auswahl der Untersuchungszeiträume
- Auswahl und Vorbereitung der Artikel
- Warum Lesbarkeitsformeln?
- Auswertung der quantitativen Artikelanalyse
- Ist die Sprache der Wirtschaftsberichterstattung über die Krise verständlich?
- Ist die Sprache mit längerer Dauer der Krise verständlicher geworden?
- Sind einzelne Ressorts in ihrer Berichterstattung verständlicher als andere?
- Sind einzelne journalistische Stilformen verständlicher geschrieben als andere?
- Verbesserungsvorschläge für exemplarisch ausgewählte Artikel
- Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse
- Interviews mit den Ressort(mit)verantwortlichen
- Interview mit der FAZ
- Interview mit der Stuttgarter Zeitung
- Interview mit der Eßlinger Zeitung
- Zusammenfassung und Diskussion
- Schlussbetrachtung
- Kritik am verwendeten Verfahren der Lesbarkeitsforschung
- Kritik an der Operationalisierung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verständlichkeit der Wirtschaftsberichterstattung in deutschen Printmedien im Kontext der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007. Sie analysiert, ob die Sprache der Wirtschaftsjournalisten verständlich für ein breites Publikum ist und ob sich die Verständlichkeit im Laufe der Krise verändert hat. Die Untersuchung konzentriert sich dabei auf die Lesbarkeit der Artikel anhand von Lesbarkeitsformeln und analysiert verschiedene journalistische Stilformen sowie den Einfluss von unterschiedlichen Ressorts.
- Verständlichkeit von Wirtschaftsberichterstattung in Printmedien
- Einfluss der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die Verständlichkeit
- Analyse von Lesbarkeit und Stilformen in Wirtschaftsartikeln
- Untersuchung von Ressortunterschieden in der Verständlichkeit
- Bewertung der Rolle von Lesbarkeitsformeln in der Analyse von Textverständlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz der Arbeit dar und beleuchtet die Bedeutung von verständlicher Wirtschaftsberichterstattung für die Öffentlichkeit. Kapitel 2 bietet einen Überblick über den Wirtschaftsjournalismus in Deutschland, seine Geschichte, seine Aufgaben und die Kritik, die er häufig erhält. Kapitel 3 beschreibt die Entstehung und den Verlauf der Finanz- und Wirtschaftskrise seit 2007, sowie die Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die Realwirtschaft. Kapitel 4 beleuchtet verschiedene Ansätze zur Messung von Textverständlichkeit, insbesondere die Lesbarkeitsforschung und das Hamburger Verständlichkeitsmodell.
Kapitel 5 beschreibt die Vorgehensweise bei der Analyse der Wirtschaftsartikel, einschließlich der Auswahl der Medien, Zeiträume und der verwendeten Lesbarkeitsformeln. Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der quantitativen Analyse der Artikel, die sich mit der Verständlichkeit der Wirtschaftsberichterstattung im Kontext der Finanzkrise auseinandersetzt. Kapitel 7 fasst die Ergebnisse der Interviews mit den Ressortleitern der untersuchten Medien zusammen. Die Schlussbetrachtung in Kapitel 8 reflektiert die Ergebnisse der Arbeit und diskutiert die Limitationen der verwendeten Methoden sowie die Bedeutung von verständlicher Wirtschaftsberichterstattung für die Demokratie.
Schlüsselwörter
Wirtschaftsjournalismus, Finanz- und Wirtschaftskrise, Verständlichkeit, Lesbarkeitsforschung, Hamburger Verständlichkeitsmodell, Printmedien, journalistische Stilformen, Ressortunterschiede, Textanalyse.
Häufig gestellte Fragen
Wie verständlich ist die Wirtschaftsberichterstattung in deutschen Zeitungen?
Die Untersuchung zeigt, dass man nicht mehr von einer generellen Unverständlichkeit sprechen kann, obwohl es erhebliche Unterschiede zwischen Medien und Ressorts gibt.
Welchen Einfluss hatte die Finanzkrise 2007 auf die Berichterstattung?
Die Arbeit analysiert, ob die zunehmende Komplexität der Krise (Subprime, faule Kredite) zu einer verständlicheren Sprache der Journalisten geführt hat.
Mit welchen Methoden wurde die Verständlichkeit gemessen?
Es wurden über 800 Artikel mithilfe von Lesbarkeitsformeln und der Software TextLab quantitativ untersucht sowie qualitative Interviews mit Redakteuren geführt.
Gibt es Unterschiede zwischen den journalistischen Stilformen?
Ja, die Analyse prüft, ob bestimmte Stilformen (z. B. Bericht vs. Kommentar) oder Ressorts eine höhere Lesbarkeit aufweisen als andere.
Welche Zeitungen wurden in der Studie untersucht?
Die Untersuchung umfasst Artikel der FAZ, der Stuttgarter Zeitung und der Eßlinger Zeitung.
- Arbeit zitieren
- Julia Schweizer (Autor:in), 2009, Subprime, Hypotheken und faule Kredite – Alles klar?! , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150818