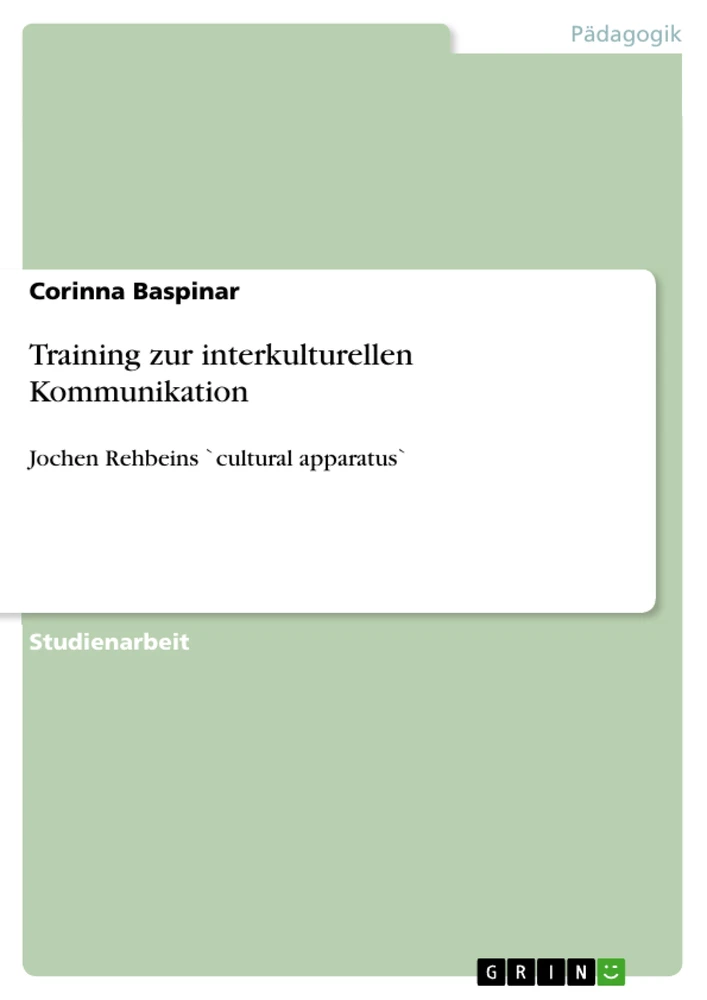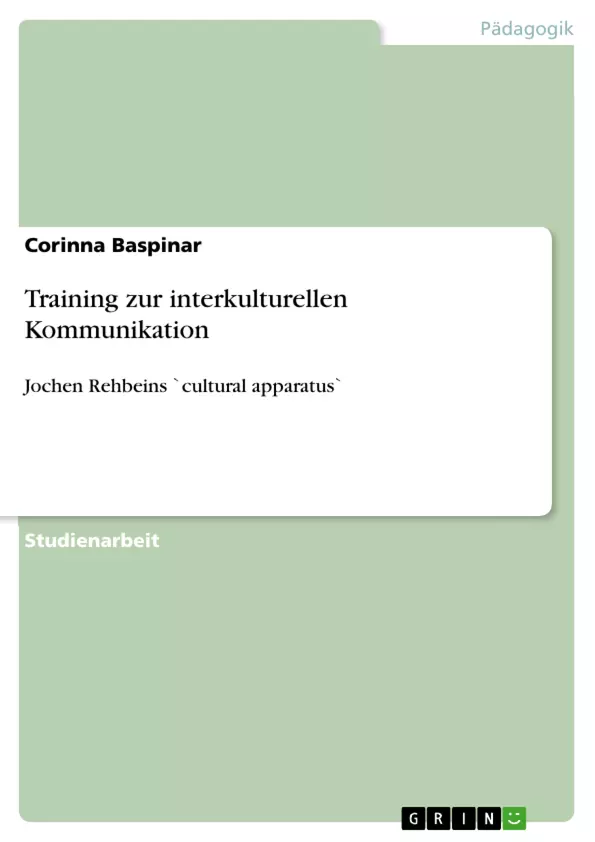In einer Welt wie heute, deren innergesellschaftliche Kommunikationsform auf Grund weltweiter Migration von vielen unterschiedlichen Faktoren abhängig geworden ist, in der es inzwischen unverzichtbar ist, nicht nur vom eigenen Kenntnisstand auszugehen, sondern mindestens genauso umfassend die Hintergründe anderer Kulturen zu erkennen und zu respektieren, sollte eine Sensibilität für `ein Dahinter` gewonnen werden: Eine Sensibilität, die sich nicht nur an Fakten orientiert, sondern mit der man sich in seine Mitmenschen einfühlen kann, mit denen man seinen Alltag teilt und die genauso wie man selbst bestimmte Beweggründe für ihr jeweiliges Handeln haben, auch wenn diese nicht immer den eigenen entsprechen.
Eine wichtige Voraussetzung, um fremde Handlungsweisen nachvollziehen zu können, ist das Interesse an anderen Kulturen sowie die Bereitschaft, diese kennen lernen zu wollen.
Indessen beginnt der Mensch meist zunächst mit Vorbehalten und Vergleichen. Er kann sein Gegenüber schlecht in dessen Eigenheit bestehen lassen, sondern er setzt sich selbst zum Anderen in Beziehung, dadurch wird er sich als eigenständige Person bewusst und kann sich in einer modernen und komplexen Welt besser orientieren. Der Mensch zieht seine Schlüsse meist aufgrund eigener Erfahrungen, und auf dieser Grundlage folgert er aus Gesprochenem oder Gesehenem. Dabei bedient er sich oft stereotyper Muster oder Vorurteile und wird seinem fremden Gegenüber in einer Kommunikation nicht gerecht, weil sich der Fremde nicht einfach in vorgefertigte Muster stecken lässt. Daraus resultieren Probleme, die Begegnungen mit anderen Mitmenschen erschweren können und im besonderen Maße bei interkulturellen Begegnungen zu Missverständnissen führen können. Deshalb ist es notwendig, den Dialog zu einem friedlichen Miteinander zu finden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- „The cultural apparatus“ (Jochen Rehbein)
- `Cultural apparatus` in der Praxis
- Denkstrukturen und Vorstellungsformen im Konflikt
- `Cultural apparatus` als inneres Regelsystem
- Mentale Prozesse (Technai)
- Cultural apparatus als Schritt zu einer transkulturellen Kommunikation?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Konzept des `cultural apparatus` von Jochen Rehbein, um einen Einblick in die Komplexität interkultureller Kommunikation zu gewinnen und Möglichkeiten zur Überwindung von Missverständnissen aufzuzeigen. Dabei soll die Bedeutung von kulturellen Prägungen für die Interpretation von Sprache und Verhalten herausgestellt werden.
- Kulturelle Prägung von Denkstrukturen und Vorstellungsformen
- Interkulturelle Kommunikation und der Einfluss von Vorannahmen
- Der `cultural filter` als Mechanismus des Missverständnisses
- Die Rolle von mentalen Prozessen (Technai) in der interkulturellen Kommunikation
- Das Potenzial des `cultural apparatus` für eine transkulturelle Kommunikation
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Relevanz interkultureller Kommunikation in einer globalisierten Welt und unterstreicht die Bedeutung von Empathie und Verständnis für die Kommunikation mit Menschen aus anderen Kulturen. Sie führt ein in das Konzept des `cultural apparatus` und die damit verbundene Herausforderung, die eigene Perspektive zu hinterfragen und fremde Handlungsweisen nachzuvollziehen.
- „The cultural apparatus“ (Jochen Rehbein): Dieses Kapitel präsentiert Rehbeins Konzept des `cultural apparatus`, das als inneres Regelsystem kulturell geprägte Denkstrukturen und Vorstellungsformen beschreibt. Es analysiert die Entstehung von Missverständnissen durch unterschiedliche mentale Prozesse und die Rolle des `cultural filter` bei der Interpretation von Sprache und Verhalten.
- `Cultural apparatus` in der Praxis: Das dritte Kapitel vertieft die praktische Relevanz des `cultural apparatus`, indem es konkrete Beispiele für interkulturelle Begegnungen und die damit verbundenen Herausforderungen aufzeigt. Es beleuchtet, wie kulturelle Prägungen die Wahrnehmung von Sprache und Verhalten beeinflussen und zu Missverständnissen führen können.
- Denkstrukturen und Vorstellungsformen im Konflikt: Dieses Kapitel untersucht, wie unterschiedliche kulturelle Denkstrukturen und Vorstellungsformen zu Konflikten führen können. Es analysiert die Bedeutung von Vorannahmen und die Rolle des `cultural filter` bei der Entstehung von Missverständnissen.
- `Cultural apparatus` als inneres Regelsystem: Das fünfte Kapitel betrachtet den `cultural apparatus` als ein inneres Regelsystem, das unsere Interpretation von Sprache und Verhalten prägt. Es analysiert, wie dieses System auf Grundlage unserer kulturellen Prägungen funktioniert und welche Auswirkungen es auf die interkulturelle Kommunikation hat.
- Mentale Prozesse (Technai): Dieses Kapitel befasst sich mit den mentalen Prozessen, die bei der interkulturellen Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Es analysiert, wie diese Prozesse durch kulturelle Prägungen beeinflusst werden und wie sie zu Missverständnissen führen können.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter und Themen der Arbeit sind `cultural apparatus`, interkulturelle Kommunikation, Missverständnisse, kulturelle Prägung, Vorannahmen, `cultural filter`, mentale Prozesse, Technai, transkulturelle Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der "cultural apparatus" nach Jochen Rehbein?
Es handelt sich um ein inneres Regelsystem kulturell geprägter Denkstrukturen und Vorstellungsformen, das unsere Interpretation von Sprache und Verhalten steuert.
Wie führt der "cultural filter" zu Missverständnissen?
Der Filter bewirkt, dass wir Informationen aus fremden Kulturen auf Basis unserer eigenen Erfahrungen und Stereotypen interpretieren, was oft nicht der Realität des Gegenübers entspricht.
Welche Rolle spielen mentale Prozesse (Technai) in der Kommunikation?
Diese Prozesse sind kulturell geprägt und bestimmen, wie wir Informationen verarbeiten und darauf reagieren; Unterschiede hierbei führen oft zu interkulturellen Konflikten.
Warum sind Vorurteile ein Hindernis für transkulturelle Kommunikation?
Menschliches Denken nutzt oft stereotype Muster zur Orientierung, wodurch man dem Gegenüber in seiner Eigenheit nicht gerecht wird und den Dialog erschwert.
Wie kann man die interkulturelle Sensibilität verbessern?
Notwendig sind Interesse an anderen Kulturen, die Bereitschaft zum Hinterfragen eigener Denkmuster und Empathie für die Beweggründe des Handelns anderer.
- Quote paper
- Corinna Baspinar (Author), 2008, Training zur interkulturellen Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150909