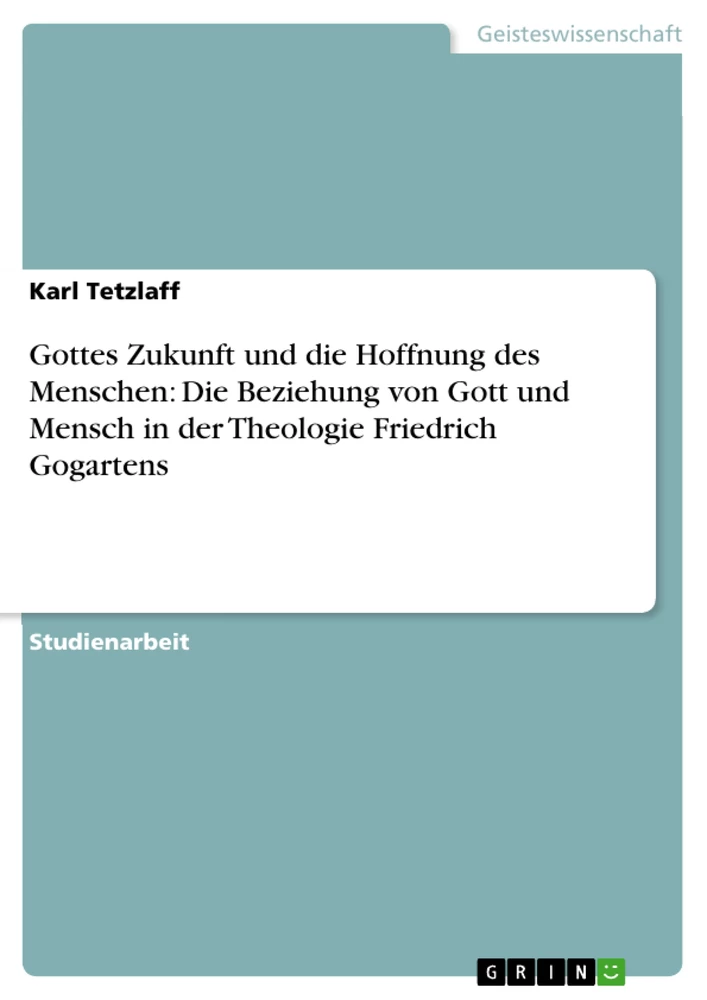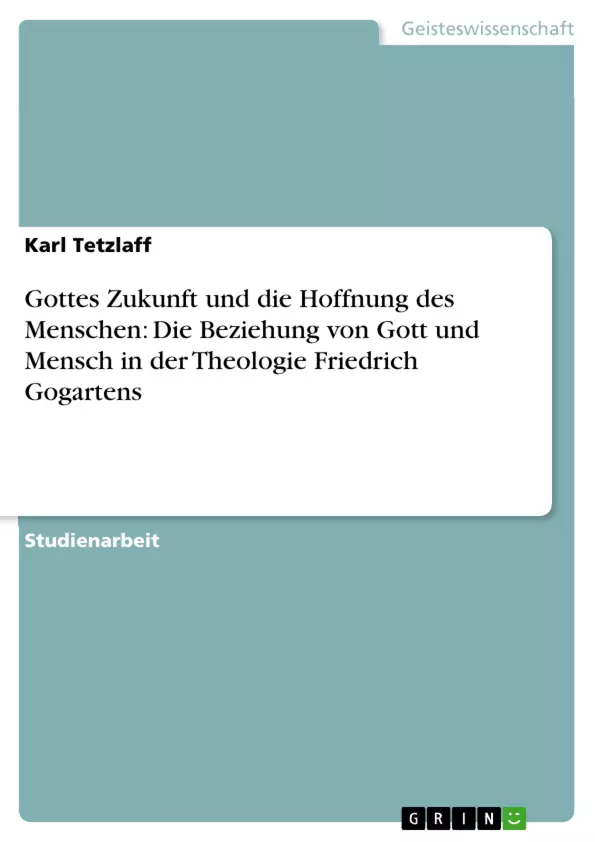Die Aufgabe des Theologen ist es, zu ergründen, „wie das christliche Selbstverständnis seiner Zeit beschaffen sein könnte“. So formuliert es jedenfalls Friedrich Gogarten, als er sein Verständnis von Theologie erklärt und Theologie als „verantwortetes Denken“ bezeichnet. In verschiedene Richtungen arbeitet Gogarten dies heraus, besonders gut zeigt es sich jedoch anhand des Verhältnisses von Gott und Mensch, das er mit seiner Konzeption der Begriffe Hoffnung und Zukunft klar gezeichnet hat. Davon soll diese Arbeit handeln, dazu jedoch, und das ganz im Sinne von Gogartens Theologieverständnis, ist jeweils ein Blick auf die geschichtlichen Umstände notwendig. Des Weiteren müssen die Entwicklungslinien von Gogartens Theologie klar werden, weil sie sich in Reaktion auf historische Notwendigkeiten immer mehr herausdifferenzierten.
Gogarten, am 13. Januar 1887 in Dortmund geboren und 16.Oktober 1967 in Göttingen gestorben , legte einen langen Weg zurück, bis er zu dieser Erkenntnis kam. Ohne irgendwelche familiären Voraussetzungen „zog er aus die Religion zu lernen“ , kam über die liberale Theologie und den Religiösen Sozialismus schließlich nach dem Ersten Weltkrieg mit anderen Theologen seiner Generation in eine Situation des „leeren, nackten Wartens“, in der nur eines klar war, „dass es so nicht weitergehe“.
An diesem Punkt soll meine Arbeit einsetzen, weil sich hier sehr klar zeigt, wo Gogartens „Theologie als verantwortetes Denken“ seinen Ursprung nimmt.
Ziel und Zentrum dieser Arbeit soll es -im Sinne Gogartens- sein, aufzuzeigen, in welchem Verhältnis der Mensch innerhalb seiner Zeit zu Gott stehen kann, wenn er Gottes Zukunft in Hoffnung begegnet.
Inhaltsverzeichnis
- A Einleitung: „Theologie als verantwortetes Denken“
- 1. Die Begegnung des Menschen mit Gott
- 1.1 Theologie der Krise
- 1.2 Menschliche Möglichkeiten angesichts der Offenbarung
- 1.3 Das Göttliche und das Menschliche
- 1.4 Verantwortung für die Welt vor Gott
- 2. Gottes Zukunft – „Quelle des Lebens“
- 2.1 Diagnose der Nachkriegsgesellschaft
- 2.2 Gottes Zukunft – eine Predigt
- 2.2.1 Mahnung zur Wachsamkeit
- 2.2.2 Offenes Erwarten
- 2.2.3 Gottes „Auf-uns-zu-kommen“
- 2.2.4 Die Hoffnung der Nachkriegsgesellschaft
- 2.3 Glaube und Säkularisierung
- 2.3.1 Säkularistische Utopien
- 2.3.2 Säkularisierung
- 2.3.3 Das Verhältnis von Glauben und Säkularisierung
- 2.3.5 Der Säkularismus
- 3. Die reine Hoffnung
- 3.1 Hoffnung als Kern des Glaubens
- 3.1.1 Die Eigenart der christlichen Hoffnung
- 3.1.2 Die Reinheit der christlichen Hoffnung
- 3.2 Der hoffende Mensch
- 3.2.1 Der Mensch der „ein gefragter Gottes“
- 3.2.2 Wesen und Un-Wesen
- 3.2.3 Das Nichts des Menschen und das Nichts Gottes
- 3.3 Die grundlose Hoffnung
- 3.3.1 Der Weg in die Hoffnung als Wesensfrage
- 3.3.2 Hoffnung und Zukunft
- Die Begegnung des Menschen mit Gott im Kontext der Krisen des 20. Jahrhunderts
- Gogartens Kritik am Kulturprotestantismus und der Vermittlungstheologie
- Die Bedeutung der Eschatologie und die Andersartigkeit Gottes
- Das Verhältnis von christlichem Glauben und Säkularisierung
- Die Rolle der Hoffnung als zentrale Kategorie in Gogartens Theologie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Theologie Friedrich Gogartens, insbesondere mit seiner Konzeption von „Theologie als verantwortetem Denken“. Sie untersucht, wie Gogarten das Verhältnis von Gott und Mensch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen und historischen Umstände seiner Zeit neu definiert. Dabei steht das Konzept der Hoffnung als zentrale Kategorie im Zentrum der Analyse.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt Gogartens Konzept der „Theologie als verantwortetes Denken“ vor und skizziert den historischen Kontext seiner Arbeit. Sie beleuchtet die „Dialektische Theologie“ als Ausgangspunkt und die Abgrenzung zu Karl Barth.
Das erste Kapitel befasst sich mit der Begegnung des Menschen mit Gott. Gogarten kritisiert den Kulturprotestantismus und die Vermittlungstheologie und betont die radikale Trennung zwischen Menschlichem und Göttlichem. Die Eschatologie wird als zentrales Thema eingeführt.
Das zweite Kapitel analysiert Gogartens Konzept von „Gottes Zukunft“ als Alternative zum Zukunftsdenken des Menschen. Es behandelt das Verhältnis von christlichem Glauben und Säkularisierung.
Das dritte Kapitel widmet sich der „reinen Hoffnung“ als Kern des Glaubens. Gogarten untersucht die Eigenart der christlichen Hoffnung und zeigt, wie der Mensch in seiner Zeit zu Gott stehen kann.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen „Theologie als verantwortetes Denken“, „Dialektische Theologie“, „Eschatologie“, „Hoffnung“, „Zukunft“, „Säkularisierung“ und „Gott“, um das Verhältnis von Mensch und Gott im Kontext der historischen und gesellschaftlichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts zu beleuchten.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Friedrich Gogarten unter „Theologie als verantwortetes Denken“?
Er sieht die Aufgabe der Theologie darin, das christliche Selbstverständnis im Kontext der jeweiligen geschichtlichen und gesellschaftlichen Umstände kritisch zu reflektieren.
Welche Rolle spielt die „Hoffnung“ in seiner Theologie?
Die Hoffnung ist der Kern des Glaubens und die Art und Weise, wie der Mensch der „Zukunft Gottes“ begegnet, ohne sich in säkularen Utopien zu verlieren.
Wie positioniert sich Gogarten zur Säkularisierung?
Gogarten unterscheidet zwischen Säkularisierung (als legitime Folge des christlichen Glaubens) und Säkularismus (als Ideologie, die Gott ausschließt).
Was ist die „Theologie der Krise“?
Es ist eine theologische Strömung nach dem Ersten Weltkrieg, die die radikale Andersartigkeit Gottes gegenüber menschlichen Möglichkeiten und Kultur betont.
In welchem historischen Kontext entstand sein Werk?
Sein Denken wurde stark durch die Erschütterungen des Ersten Weltkriegs und die daraus resultierende Krise der bürgerlichen Gesellschaft und des Kulturprotestantismus geprägt.
- Citar trabajo
- Karl Tetzlaff (Autor), 2009, Gottes Zukunft und die Hoffnung des Menschen: Die Beziehung von Gott und Mensch in der Theologie Friedrich Gogartens, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150950