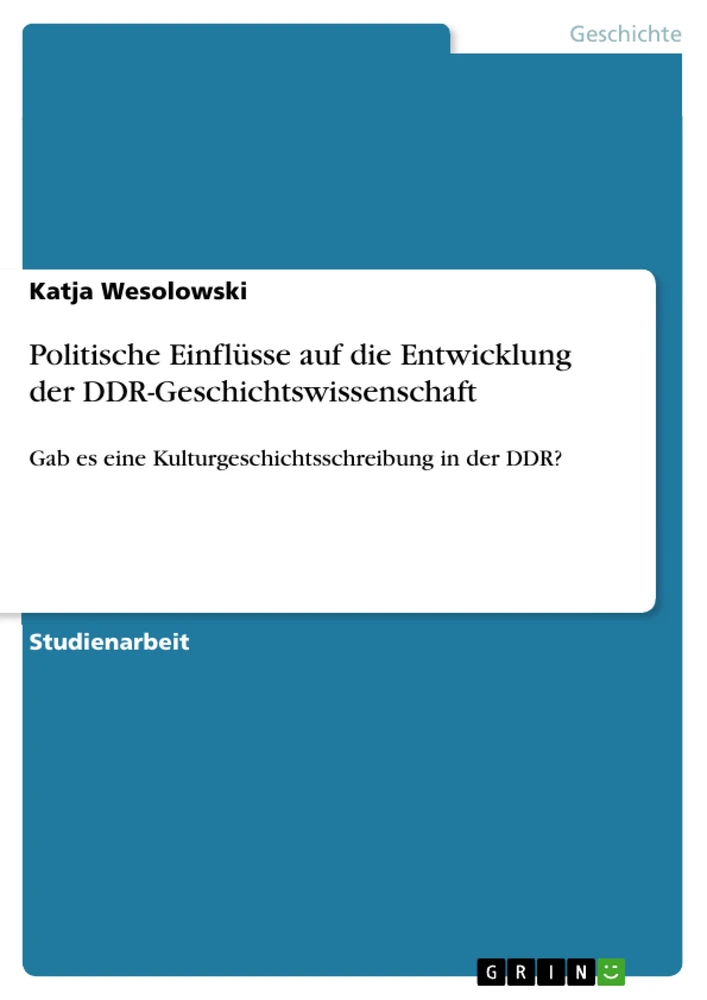Ausgangspunkt dieser Arbeit bildet das Seminar: „Kulturgeschichte in Deutschland: Von J. Burckhardt bis E. Friedell (1860 – 1933)“, dessen Schwerpunktthema die Entwicklung der Kulturgeschichtsschreibung in Deutschland bis zur Gründung des Dritten Reiches war.[...]
Auffallend ist, dass Betrachtungen zur Kulturgeschichte und -schreibung Deutschlands sich im Allgemeinen heutzutage auf das Gebiet der ehemaligen Bundesrepublik Deutschland beschränken. Bedeutsam ist jedoch, dass sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges zwei deutsche Staaten mit gegensätzlichen politischen Gesellschaftssystemen entwickelten.
Ein geschichtlich gemeinsam entwickeltes Kulturgebiet war nun geteilt. Zwei Staaten, zwei Geschichtswissenschaften, die nun um Anspruch miteinander konkurrieren, jeweils die vernünftige Konsequenz aus der deutschen Geschichte zu ziehen und ausgehend von dem daraus resultierenden Legitimationsanspruch der BRD und der DDR die jeweilige Auffassung ent-spricht, die jeweils richtige Interpretation der deutschen Geschichte vorzunehmen und anzubieten. Die problembeladene „deutsch-deutsche“ Beziehung wurde ebenso auf der Ebene der beiden sich selbständig voneinander entwickelnden deutschen Geschichtswissenschaften widergespiegelt.
Nach der Wiedervereinigung im Jahr 1990 hat sich damit einhergehend die „westdeutsche“ Geschichtsforschung durchgesetzt. Der „Historikerstreit“ war entschieden. Die DDR-Geschichtswissenschaft wegen ihrer Methoden und Ergebnissen kritisiert, was zur Folge hat, dass sie hinsichtlich ihrer wissenschaftlichen Ergebnisse nunmehr unberücksichtigt gelassen werden musste.
45 Jahre DDR-Geschichtsforschung sind größtenteils für die neueren Forschungen unbrauchbar geworden. Und dennoch wird das Thema „DDR-Geschichtswissenschaft“ in jüngster Zeit wieder thematisiert und tritt ins Rampenlicht geschichtswissen-schaftlicher Forschungen. So bildet sie auch die Grundlage für den Schwerpunkt dieser Arbeit, in der die Existenz einer DDR-Kulturgeschichtsschreibung untersucht werden soll, da sie bekanntlich die wissenschaftliche Grundlage jeglicher Geschichts-schreibung bildet und damit auch verantwortlich für Themenschwerpunkte – also beispielsweise kulturgeschichtlicher Forschungen - ist.
Interessant ist in erster Linie für diese Arbeit ist, in wie weit es eine Kulturgeschichtsschreibung in der DDR gab. Welche Tendenzen sich in der DDR-Geschichtswissenschaft ausbildeten und welche politischen Einflüsse diese Tendenzen gelenkt haben.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Die Geschichte der DDR Geschichtswissenschaft
- II.1. Auswirkung der DDR-Politik auf die Geschichtswissenschaft - Die marxistisch-leninistische Geschichtsschreibung bis zu den 70er Jahre
- II.1.1. 1945 – 1948: Entwicklung des fortschrittlichen Humanismus
- II.1.2. 1948 – 1952: Der „Sturm auf die Festung Wissenschaft“
- II.1.3. 1952 - 1956: Die Wendung zum „Nationalen“
- II.1.4. 1956 – 1961: Die Erziehung zum sozialistischen Patriotismus
- II.1.5. 1961 – 1966: Umfassender Aufbau des Sozialismus
- II.1.6. 1967 - 1971: Das „entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus“ (ESS) und die Bedeutung des Geschichtsbewusstseins
- II.1.7. Ab 1971: „Revolutionärer Weltprozess“, Internationalismus, Integration in das sozialistische Staatsgefüge
- II.2. Zusammenfassung
- II.3. Die DDR-Geschichtswissenschaft vom Ende der 70er Jahre bis 1989/90
- II.4. Zusammenfassung
- III. Aufgabe und Funktion der marxistisch-leninistischen DDR-Geschichtswissenschaft
- III.1. Aufgaben der DDR-Geschichtswissenschaft
- III.2. Funktionen der DDR-Geschichtswissenschaft
- IV. Herausbildung von Forschungsschwerpunkten in der DDR-Geschichtswissenschaft
- IV.1. Inhaltliche Schwerpunkte im Geschichtsbild der DDR-Geschichtswissenschaft bis zum Beginn der 70er Jahre
- IV.2. Periodisierung der Geschichte des 19. Jahrhunderts in der DDR-Geschichtswissenschaft seit Ende der 70er Jahre
- IV.3. Tendenzen und Probleme der Forschung unter thematischem Aspekt
- IV.3.1. Deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts im Überblick
- IV.3.2. Parteiengeschichte und Geschichte der Arbeiterbewegung
- IV.3.3. Agrargeschichte
- IV.3.4. Regionalgeschichte
- IV.3.5. Wirtschafts- und Sozialgeschichte
- V. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Frage, ob es in der DDR eine eigene Kulturgeschichtsschreibung gab. Sie analysiert die Einflüsse politischer Rahmenbedingungen auf die Entwicklung der DDR-Geschichtswissenschaft, insbesondere im Kontext des marxistisch-leninistischen Denkens.
- Die Entwicklung der DDR-Geschichtswissenschaft im Kontext der politischen Rahmenbedingungen.
- Die Rolle und Funktion der marxistisch-leninistischen Geschichtsschreibung in der DDR.
- Die Herausbildung von Forschungsschwerpunkten in der DDR-Geschichtswissenschaft.
- Die Darstellung der deutschen Geschichte im Spiegel der DDR-Geschichtswissenschaft.
- Die Frage nach der Existenz einer eigenen Kulturgeschichtsschreibung in der DDR.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Kulturgeschichte und deren Entwicklung in Deutschland bis zur Gründung des Dritten Reiches. Im Anschluss daran werden die politischen Einflüsse auf die Entwicklung der DDR-Geschichtswissenschaft bis zu den 1970er Jahren beleuchtet. Hierbei werden die einzelnen Phasen der marxistisch-leninistischen Geschichtsschreibung in der DDR analysiert und ihre Auswirkungen auf die Forschungstätigkeit beschrieben. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung des fortschrittlichen Humanismus, dem „Sturm auf die Festung Wissenschaft“, der Wendung zum „Nationalen“, der Erziehung zum sozialistischen Patriotismus, dem umfassenden Aufbau des Sozialismus, dem „entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus“ (ESS) und der Integration in das sozialistische Staatsgefüge.
Anschließend wird die DDR-Geschichtswissenschaft vom Ende der 1970er Jahre bis 1989/90 betrachtet. Hierbei werden die Veränderungen in der Forschungspraxis und die Herausbildung von Forschungsschwerpunkten analysiert. Die Arbeit befasst sich mit den inhaltlichen Schwerpunkten im Geschichtsbild der DDR-Geschichtswissenschaft bis zum Beginn der 1970er Jahre, der Periodisierung der Geschichte des 19. Jahrhunderts in der DDR-Geschichtswissenschaft seit Ende der 1970er Jahre und den Tendenzen und Problemen der Forschung unter thematischem Aspekt. Diese Analyse umfasst die deutsche Geschichte des 19. Jahrhunderts im Überblick, die Parteiengeschichte und Geschichte der Arbeiterbewegung, die Agrargeschichte, die Regionalgeschichte und die Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
Schlüsselwörter
DDR-Geschichtswissenschaft, marxistisch-leninistische Geschichtsschreibung, Kulturgeschichte, politische Einflüsse, Forschungsschwerpunkte, deutsche Geschichte, Geschichte des 19. Jahrhunderts, Parteiengeschichte, Arbeiterbewegung, Agrargeschichte, Regionalgeschichte, Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte die SED auf die DDR-Geschichtswissenschaft?
Die Geschichtswissenschaft war stark politisiert und musste sich dem Marxismus-Leninismus unterordnen, um die Legitimität des sozialistischen Staates historisch zu begründen.
Gab es in der DDR eine eigene Kulturgeschichtsschreibung?
Ja, allerdings war diese oft in die allgemeine Gesellschaftsgeschichte integriert und diente der Erziehung zum „sozialistischen Patriotismus“.
Was war der „Sturm auf die Festung Wissenschaft“?
Damit wird die Phase zwischen 1948 und 1952 bezeichnet, in der bürgerliche Historiker verdrängt und die marxistische Ideologie an den Universitäten radikal durchgesetzt wurde.
Warum sind viele DDR-Forschungen heute „unbrauchbar“?
Aufgrund der ideologischen Einseitigkeit und der oft manipulativen Interpretation von Quellen gelten viele Werke als methodisch veraltet, auch wenn sie in Einzelfragen wertvolle Fakten enthalten können.
Wie wurde das 19. Jahrhundert in der DDR-Historie bewertet?
Der Fokus lag auf der Geschichte der Arbeiterbewegung, der Revolution von 1848 und dem Aufstieg des Proletariats als Triebkraft der Geschichte.
- Quote paper
- Katja Wesolowski (Author), 2006, Politische Einflüsse auf die Entwicklung der DDR-Geschichtswissenschaft, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/150995