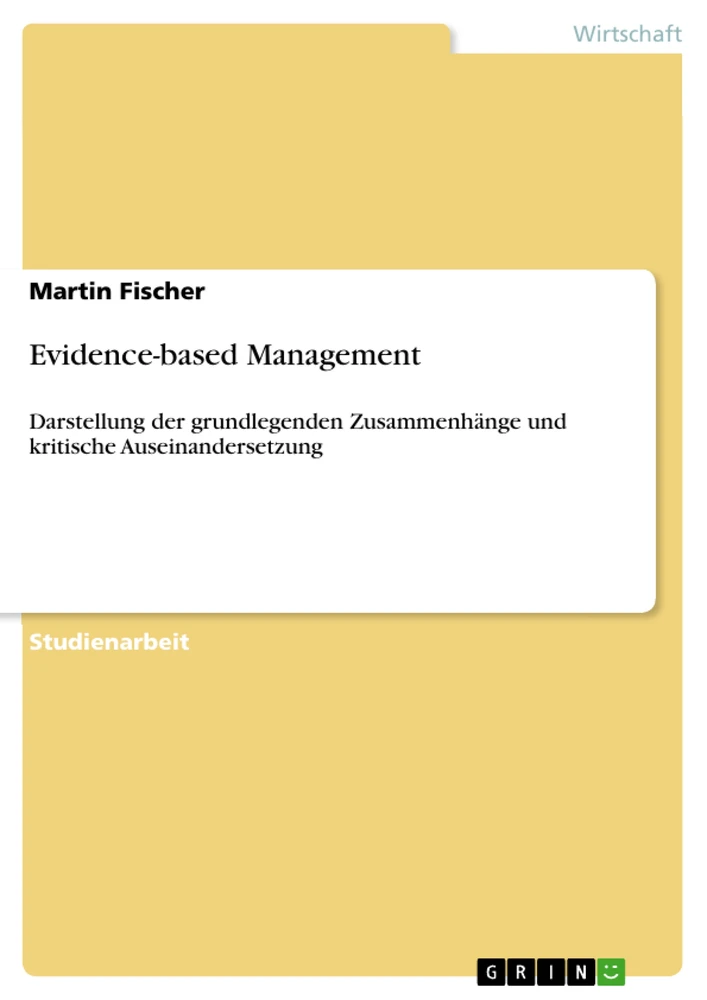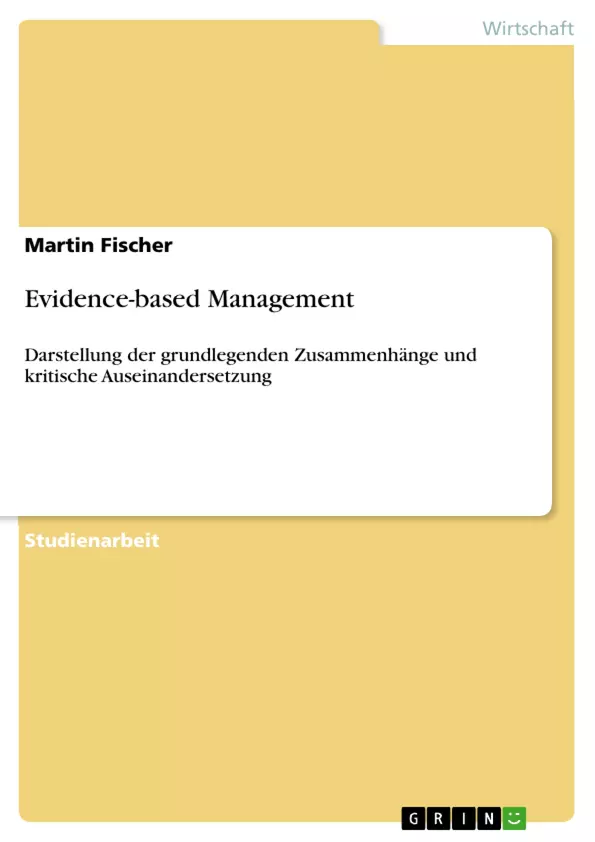Evidence-based Management (EBMgt), oder auch fakten- bzw. evidenzbasiertes Management, ist ein relativ neues Thema im Bereich der Managementliteratur. Im Kern der Aussage ist EBMgt weniger als Managementmethode, sondern eher als Denkansatz und Denkweise zu betrachten. Ziel ist es unternehmerische Entscheidungen auf Basis der besten verfügbaren wissenschaftlichen Fakten und Beweise zu treffen und praktikable, etablierte Theorien in die betriebliche Praxis umzusetzen, um die Unternehmensleistung zu verbessern.
Die vorliegende Seminararbeit soll die Grundzüge des Ansatzes darstellen, die Möglichkeiten zur Implementierung aufzeigen und eine kritische Analyse sowie Auseinandersetzung mit der Thematik gewährleisten.
Hierzu werden im Folgenden die Grundlagen von Evidence-based Management beschrieben. Inhaltlich werden die Geschichte der Entwicklung von faktenbasierten Entscheidungsmethoden, sowie die Gründe, die vermehrt zur Beschäftigung mit EBMgt geführt haben, behandelt.
Nachfolgend wird die Implementierung der Thematik in den betrieblichen Alltag anhand von Handlungsempfehlungen und Leitlinien zur Implementierung aufgegriffen. Dabei werden auch die Widerstände und Hindernisse, die aus bisherigen Praktiken und Gegebenheiten entstehen in Betracht gezogen.
Abschließend wird die Thematik EBMgt unter kritischen Aspekten betrachtet und vor allem Argumente konträrer wissenschaftlicher Entwicklungen und Meinungen analysiert. Hier werden ebenfalls die faktenbasierten Ansätze mit Aussagen bestehender Theorien und Methoden (wirtschafts-)wissenschaftlicher Teilgebiete abgeglichen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Grundlagen von Evidence-based Management
- 2.1 Entstehung von Evidence-based Management
- 2.2 Notwendigkeit von faktenbasierten Ansätzen durch schlechte Entscheidungsmethoden
- 2.2.1 Willkürliches Benchmarking
- 2.2.2 Unkritisches Fortführen bisheriger Methoden
- 2.2.3 Kein Hinterfragen von Ideologien
- 2.3 Grundsätze von Evidence-based Management
- 3 Implementierung des Managementansatzes
- 3.1 Grundlegende Maßnahmen und Instrumente
- 3.2 Leitlinien für faktenbasiertes Management
- 3.3 Mögliche Hindernisse
- 4 Kritische Auseinandersetzung mit Evidence-based Management
- 4.1 Analyse von EBMgt im Vergleich mit anderen wissenschaftlichen Ansätzen
- 4.2 Kritikpunkte zu faktenbasiertem Management
- 5 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit Evidence-based Management (EBMgt), einem Managementansatz, der auf der systematischen Verwendung von empirischen Daten basiert. Ziel ist es, die grundlegenden Zusammenhänge von EBMgt darzustellen und kritisch zu analysieren. Die Arbeit untersucht die Entstehung und Notwendigkeit von EBMgt im Kontext schlechter Entscheidungsmethoden sowie die Implementierung des Ansatzes.
- Entstehung und Grundlagen von Evidence-based Management
- Notwendigkeit faktenbasierter Ansätze
- Implementierung von EBMgt: Maßnahmen und Herausforderungen
- Kritischer Vergleich mit anderen Managementansätzen
- Kritikpunkte an Evidence-based Management
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema Evidence-based Management ein und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Sie skizziert die Bedeutung von faktenbasierten Entscheidungen im Management und die Notwendigkeit, etablierte Methoden kritisch zu hinterfragen.
2 Grundlagen von Evidence-based Management: Dieses Kapitel erläutert die Entstehung von Evidence-based Management, ausgehend von der Evidenzbasierten Medizin. Es analysiert die Ursachen für schlechte Entscheidungen im Management, wie willkürliches Benchmarking, unkritisches Festhalten an alten Methoden und das Ignorieren von ideologischen Grenzen. Zudem werden die grundlegenden Prinzipien und Leitsätze von EBMgt dargelegt, die auf systematischer Datenanalyse und deren kritischer Bewertung beruhen, um fundierte Entscheidungen zu ermöglichen. Es wird der Unterschied zwischen Daten, Informationen, Wissen und Weisheit herausgestellt, wobei die Bedeutung von kritischer Reflexion und Erfahrung betont wird.
3 Implementierung des Managementansatzes: Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung von EBMgt. Es beschreibt grundlegende Maßnahmen und Instrumente, die für die Implementierung notwendig sind. Es werden Leitlinien für ein faktenbasiertes Management vorgestellt und mögliche Hindernisse bei der Einführung und Umsetzung von EBMgt diskutiert. Die Bedeutung von geeigneten Informations- und Kommunikationssystemen wird hervorgehoben. Das Kapitel betont die Herausforderungen bei der Integration von EBMgt in bestehende Managementstrukturen und -prozesse.
4 Kritische Auseinandersetzung mit Evidence-based Management: Dieses Kapitel analysiert EBMgt im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Managementansätzen. Es werden sowohl die Stärken als auch die Schwächen des Ansatzes beleuchtet. Konkrete Kritikpunkte an EBMgt werden diskutiert, wie z.B. die potenzielle Überbetonung von quantitativen Daten auf Kosten qualitativer Aspekte und die Gefahr einer einseitigen Fokussierung auf messbare Ergebnisse. Der Einfluss von Kontextfaktoren und die Schwierigkeit der Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen auf die Praxis werden ebenfalls thematisiert.
Schlüsselwörter
Evidence-based Management, faktenbasiertes Management, Entscheidungsfindung, empirische Daten, Benchmarking, Implementierung, Kritik, wissenschaftliche Ansätze, Managementmethoden.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Evidence-based Management
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit befasst sich umfassend mit dem Thema Evidence-based Management (EBMgt). Sie untersucht die Grundlagen, die Implementierung und die kritische Auseinandersetzung mit diesem Managementansatz, der auf der systematischen Verwendung empirischer Daten basiert.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Ziel der Arbeit ist es, die grundlegenden Zusammenhänge von EBMgt darzustellen und kritisch zu analysieren. Es werden die Entstehung und Notwendigkeit von EBMgt im Kontext schlechter Entscheidungsmethoden sowie die Implementierung des Ansatzes untersucht.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Entstehung und Grundlagen von EBMgt, die Notwendigkeit faktenbasierter Ansätze, die Implementierung von EBMgt inklusive Maßnahmen und Herausforderungen, ein kritischer Vergleich mit anderen Managementansätzen und abschließend eine kritische Auseinandersetzung mit den Kritikpunkten an EBMgt.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Grundlagen von EBMgt, Implementierung des Managementansatzes, kritische Auseinandersetzung mit EBMgt und Fazit. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt von EBMgt, beginnend mit einer Einführung und endend mit einer kritischen Bewertung.
Was wird im Kapitel "Grundlagen von Evidence-based Management" behandelt?
Dieses Kapitel erläutert die Entstehung von EBMgt, ausgehend von der Evidenzbasierten Medizin. Es analysiert die Ursachen für schlechte Entscheidungen im Management (z.B. willkürliches Benchmarking, Festhalten an alten Methoden, Ignorieren ideologischer Grenzen) und beschreibt die grundlegenden Prinzipien und Leitsätze von EBMgt, die auf systematischer Datenanalyse und deren kritischer Bewertung beruhen.
Was wird im Kapitel "Implementierung des Managementansatzes" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit der praktischen Umsetzung von EBMgt. Es beschreibt grundlegende Maßnahmen und Instrumente, Leitlinien für ein faktenbasiertes Management und mögliche Hindernisse bei der Einführung und Umsetzung. Die Bedeutung von Informationssystemen und die Herausforderungen bei der Integration in bestehende Strukturen werden hervorgehoben.
Was wird in der kritischen Auseinandersetzung mit EBMgt behandelt?
Das Kapitel analysiert EBMgt im Vergleich zu anderen wissenschaftlichen Managementansätzen und beleuchtet Stärken und Schwächen. Es werden konkrete Kritikpunkte diskutiert, wie z.B. die potenzielle Überbetonung quantitativer Daten, die einseitige Fokussierung auf messbare Ergebnisse, der Einfluss von Kontextfaktoren und die Übertragbarkeit von Forschungsergebnissen in die Praxis.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Evidence-based Management, faktenbasiertes Management, Entscheidungsfindung, empirische Daten, Benchmarking, Implementierung, Kritik, wissenschaftliche Ansätze, Managementmethoden.
Welche schlechten Entscheidungsmethoden werden in der Arbeit kritisiert?
Die Arbeit kritisiert willkürliches Benchmarking, das unkritische Fortführen bisheriger Methoden und das Nicht-Hinterfragen von Ideologien als Ursachen für schlechte Entscheidungen im Management.
Gibt es ein Fazit?
Ja, die Arbeit schließt mit einem Fazit ab, das die wichtigsten Ergebnisse zusammenfasst und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen im Bereich des Evidence-based Managements geben könnte.
- Quote paper
- B.A. Martin Fischer (Author), 2009, Evidence-based Management , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151011