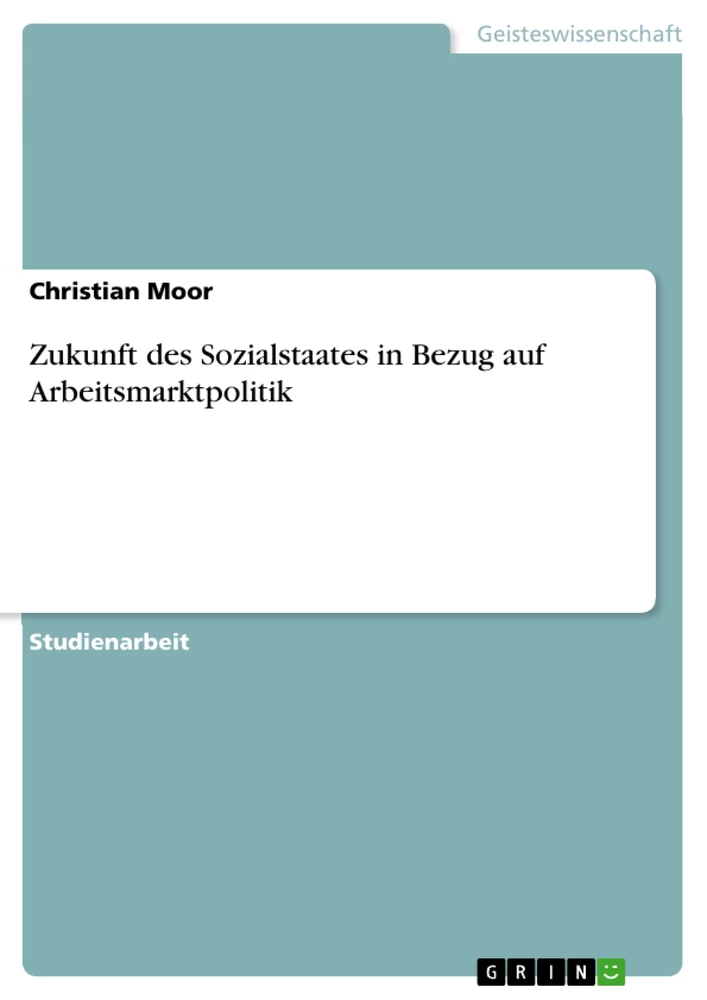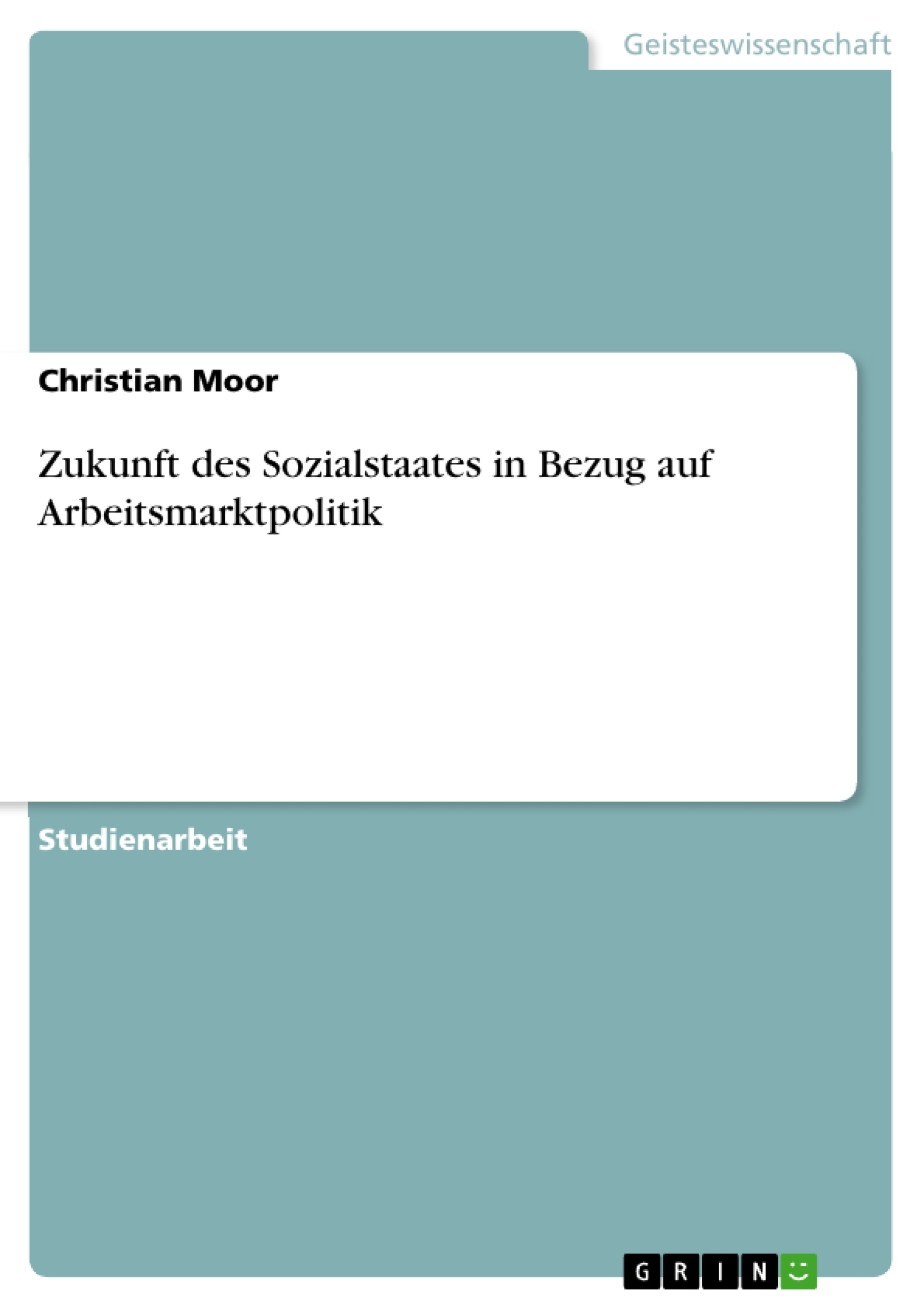Die Arbeitslosigkeit in Deutschland hat in den vergangenen Jahrzehnten immer mehr zugenommen. Viele Menschen wurden arbeitslos und in der Statistik erfasst. Aber daneben gab es auch Menschen, die von der Sozialhilfe lebten und deshalb nicht erfasst wurden. Das war die so genannte „verdeckte“ Arbeitslosigkeit.
Ich werde in meiner Hausarbeit die Situation der Arbeitslosigkeit vor der Arbeitsmarktreform der Hartz-Kommission unter der Rot-Grünen Koalition von Bundeskanzler Gerhard Schröder und die daraus folgenden Schlussfolgerungen wie Arbeitsmarkt im aktivierenden Sozialstaat, die Erneuerung der Arbeitsmarktpolitik ab 2005, Wirkungen der Arbeitsmarktreform sowie Möglichkeiten und Kontrolle bearbeiten.
Dazu werde ich auf folgende Thesen eingehen:
•Das alte System kam an Grenzen – es war ineffizient und teuer!
•Arbeitslosigkeit wurde zuvor z.T. vertuscht/ verwaltet!
•Sind Minijobs ein Anreiz zur Arbeit Abgaben Stufenweise?
•Die Ich – AG ist ein Erfolg!
•Neuer Name – Neues Programm ,,Bundesagentur für Arbeit“!
•Das Kernstück der Reform – wirklich eine effektive Erneuerung?
•Die Armut ist größer geworden!
•Die Vermittlung beginnt früher!
•Vermittlungsgutscheine und – Agenturen wirken nicht!
•Die Zuschüsse werden gezielter eingesetzt!
•Die Kosten sind geringer geworden!
•Verwirklichungschancen sind nur teilweise gegeben!
•Über die Arbeitslosigkeit kommt der Polizeistaat!
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Arbeitsmarkt im aktivierenden Sozialstaat
- Wie sind wir dazu gekommen – Fördern und Fordern bis 2005
- Das Ausmaß der Arbeitslosigkeit wurde sichtbar
- Die Erneuerung der Arbeitsmarktpolitik ab 2005
- Die Hartz - Gesetze
- Die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe
- Wirkungen der Arbeitsmarktreform...
- ... in Bezug auf das Einkommen
- ... in Bezug auf die Arbeitsvermittlung
- in Bezug auf die Arbeitsförderung
- in Bezug auf den Staat
- Möglichkeiten und Kontrolle
- Teilhabe und Verwirklichungschancen
- Der Polizeistaat kommt über die Arbeitslosigkeit
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die Situation der Arbeitslosigkeit in Deutschland vor und nach der Arbeitsmarktreform der Hartz-Kommission, die im Zuge der Agenda 2010 unter Bundeskanzler Gerhard Schröder durchgeführt wurde. Sie untersucht die Entwicklung des Arbeitsmarktes im aktivierenden Sozialstaat, die Erneuerung der Arbeitsmarktpolitik ab 2005, die Auswirkungen der Arbeitsmarktreform auf verschiedene Bereiche und die damit verbundenen Möglichkeiten und Herausforderungen.
- Die Ineffizienz und Kosten des alten Sozialstaates
- Die Auswirkungen der Globalisierung auf den Arbeitsmarkt
- Die Veränderungen der Arbeitsmarktpolitik durch die Hartz-Reformen
- Die Auswirkungen der Reformen auf Einkommen, Arbeitsvermittlung und Arbeitsförderung
- Die Rolle des Staates und die Möglichkeiten der Kontrolle
Zusammenfassung der Kapitel
Das Vorwort führt in die Thematik der Arbeitslosigkeit in Deutschland ein und beschreibt die Situation vor der Arbeitsmarktreform. Kapitel 1 beleuchtet die Entwicklung des Arbeitsmarktes im aktivierenden Sozialstaat und die Gründe für die Notwendigkeit einer Reform. Kapitel 2 beschreibt die Erneuerung der Arbeitsmarktpolitik ab 2005 durch die Einführung der Hartz-Gesetze und die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe. Kapitel 3 untersucht die Wirkungen der Arbeitsmarktreform in Bezug auf Einkommen, Arbeitsvermittlung, Arbeitsförderung und den Staat. Kapitel 4 analysiert die Möglichkeiten und Herausforderungen der Arbeitsmarktreform, insbesondere im Hinblick auf Teilhabe und Verwirklichungschancen sowie die Gefahr eines Polizeistaates. Das Fazit fasst die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Arbeitslosigkeit, Sozialstaat, Arbeitsmarktpolitik, Hartz-Reformen, Agenda 2010, Globalisierung, Aktivierung, Fördern und Fordern, Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Vermittlung, Beschäftigung, Einkommen, Kontrolle, Polizeistaat, Teilhabe, Verwirklichungschancen.
Häufig gestellte Fragen
Was waren die Hauptgründe für die Hartz-Reformen?
Das alte Sozialsystem galt als ineffizient und zu teuer. Die Reformen zielten darauf ab, Arbeitslosigkeit sichtbarer zu machen und den Sozialstaat zu „aktivieren“.
Was versteht man unter dem Prinzip „Fördern und Fordern“?
Es beschreibt den Kern der Reformen ab 2005: Der Staat unterstützt Arbeitslose bei der Vermittlung, fordert aber gleichzeitig Eigeninitiative und die Aufnahme von Arbeit ein.
Was bedeutet die Zusammenlegung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe?
Dies war das Kernstück der Reform (Hartz IV), bei dem die Leistungen für Langzeitarbeitslose auf einem einheitlichen Niveau zusammengefasst wurden.
Sind Minijobs ein wirksamer Anreiz zur Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch, ob Minijobs tatsächlich als Brücke in den ersten Arbeitsmarkt fungieren oder eher prekäre Beschäftigung fördern.
Was ist mit dem Begriff „verdeckte Arbeitslosigkeit“ gemeint?
Es bezeichnet Menschen, die zwar arbeitslos waren, aber in der offiziellen Statistik nicht auftauchten, da sie beispielsweise Sozialhilfe bezogen oder in Maßnahmen waren.
Welche Kritikpunkte an der Reform werden in der Arbeit genannt?
Thematisiert werden unter anderem die Zunahme der Armut, die mangelnde Wirkung von Vermittlungsgutscheinen und die Sorge vor einem „Polizeistaat“ durch verstärkte Kontrolle.
- Quote paper
- Christian Moor (Author), 2009, Zukunft des Sozialstaates in Bezug auf Arbeitsmarktpolitik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151018