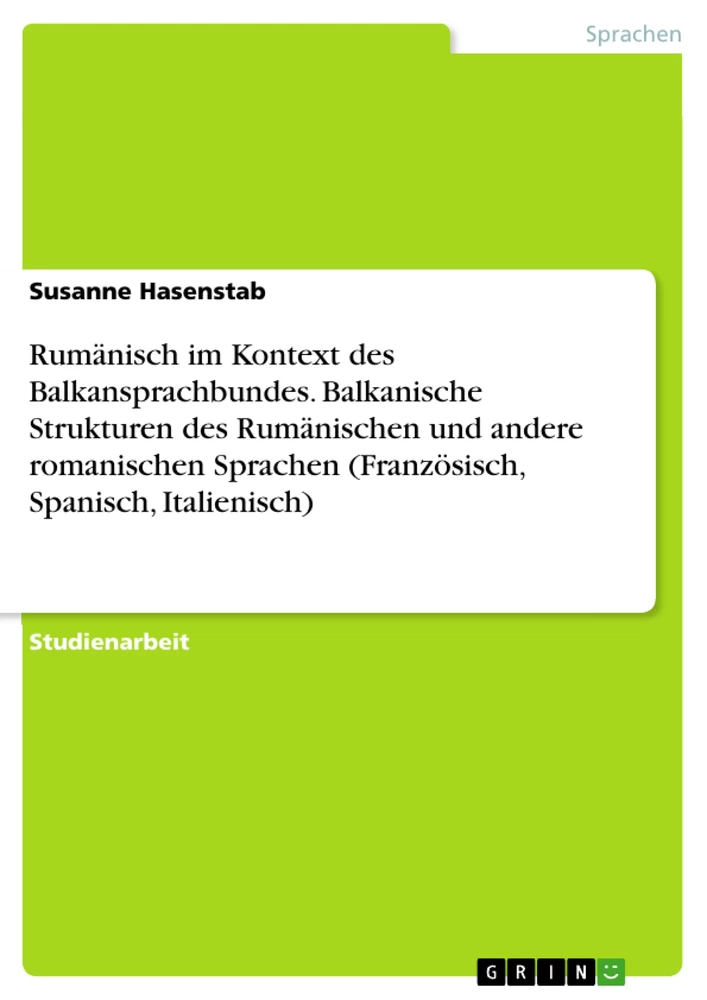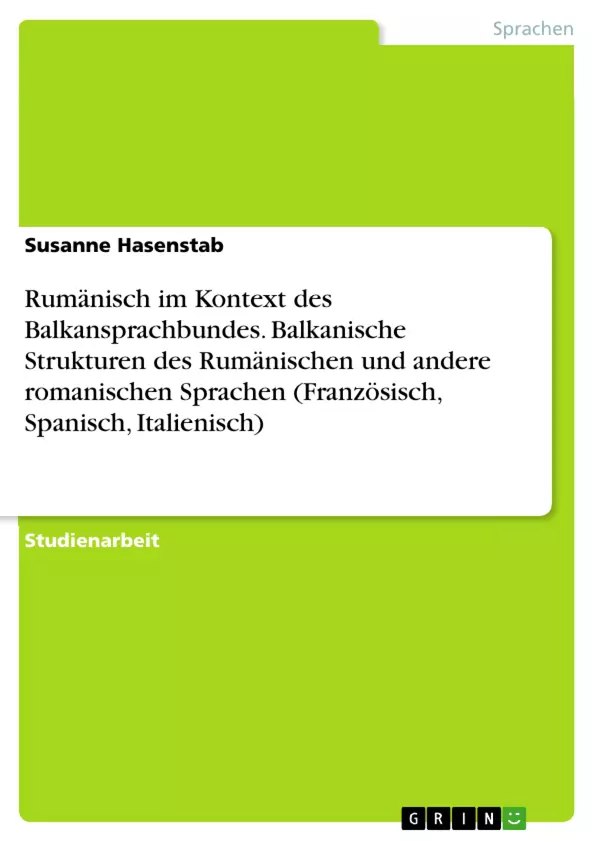Betrachtet man das Rumänische im Kontext des so genannten Balkansprachbundes, ist es nötig, zuerst eine Definition der Begriffe „Sprachbund“ und „Balkansprachbund“ vorzunehmen. In der Sprachwissenschaft ist ein Sprachbund die
Bezeichnung für Gruppen geographisch benachbarter Sprachen, die sich, auch ohne daß zwischen ihnen eine genetische Verwandtschaft zu bestehen braucht, durch auffällige Übereinstimmung im grammatischen Bau auszeichnen und sich durch dieselben Gemeinsamkeiten von im weiteren Umkreis gesprochenen Sprachen abheben.
Es handelt sich also um Sprachen, die genetisch nicht miteinander verwandt sind oder zumindest nicht sein müssen, die sich aber in manchen morphologischen und syntaktischen Eigenschaften gleichen. Als Voraussetzung für die Entstehung eines solchen Sprachbundes werden „langdauernde Zustände von Sprachkontakt“ angeführt.
Eine „Bedingung für die sinnvolle Verwendung des Begriffs Sprachbund ist […], dass die betreffenden Eigenschaften nicht ohnedies aus der „Erbmasse“ aller beteiligten Sprachen ableitbar sind.“ Sprachen wie Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch können deshalb trotz ihrer Gemeinsamkeiten und geographisch benachbarten Lage natürlich nicht unter dem Begriff Sprachbund zusammengefasst werden, da sich ihre grammatischen und sonstigen Gemeinsamkeiten ja aus der Ursprungssprache aller romanischer Sprachen, dem Lateinischen beziehungsweise dem Vulgärlateinischen, entwickelt haben.
Des weiteren wird definiert: „Ein Sprachbund weist mindestens zwei gemeinsame Merkmale auf, die sich auf mindestens drei nicht zur gleichen Familie gehörende Sprachen erstrecken, um genetisch bedingten Ursprung oder einseitige Beeinflussung […] auszuschließen.“ Die Sprachen des Balkans erfüllen diese Voraussetzung, denn sie gehören verschiedenen Sprachfamilien an und haben keinen gemeinsamen Erbwortschatz, drücken aber dennoch einige grammatische Funktionen in gemeinsamer Art und Weise aus.
Der Begriff Balkansprachbund ist demzufolge die „Übergreifende Bezeichnung für eine durch auffällige Gemeinsamkeiten im grammatischen Bau gekennzeichnete Gruppe genetisch nur mittelbar verwandter Sprachen im Balkanraum.“
Neben dem Balkansprachbund existieren Sprachbünde in Süd- und Zentralasien sowie im Südkaukasus. Auch bei der Entstehung des Balkansprachbundes wird als Ursache Jahrhunderte langer Sprachkontakt und Transhumanz7 angenommen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Rumänisch als balkanische Sprache
- 2. Der Balkansprachbund
- 2.1 Begriffsdefinition
- 2.2 Die wichtigsten Merkmale des Balkansprachbundes nach Schaller
- 3. Vergleichende Untersuchung: Balkanische Strukturen des Rumänischen und die Äquivalenz entsprechender Strukturen im Französischen, Spanischen und Italienischen
- 3.1 Der nachgestellte bestimmte Artikel
- 3.2 Zusammenfall von Genitiv und Dativ
- 3.3 Die analytische Komparation
- 3.4 Das Zahlsystem von 11 bis 19
- 3.5 Eingeschränkter Infinitivgebrauch
- 3.6 Analytische Bildung des Futurs mit dem Hilfsverb „wollen“
- 3.7 Verdopplung des Objekts
- 3.8 Verwendung von Personalpronomen in der Funktion von Possessivpronomen
- 4. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die balkanischen Strukturen im Rumänischen und vergleicht diese mit entsprechenden Strukturen im Französischen, Spanischen und Italienischen. Ziel ist es, die Sonderstellung des Rumänischen unter den romanischen Sprachen im Kontext des Balkansprachbundes zu beleuchten und die Einflüsse der umliegenden Sprachen auf seine grammatische Entwicklung zu analysieren.
- Das Rumänische im Kontext des Balkansprachbundes
- Vergleichende Analyse balkanischer Strukturen im Rumänischen und anderen romanischen Sprachen
- Identifizierung und Erklärung der grammatischen Unterschiede
- Bewertung des Einflusses des Balkansprachbundes auf das Rumänische
- Untersuchung der Äquivalenzen in anderen romanischen Sprachen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Rumänisch als balkanische Sprache: Die Einleitung etabliert die Sonderstellung des Rumänischen unter den romanischen Sprachen, begründet durch seine geographische Isolation und den daraus resultierenden Einfluss balkanischer Sprachen. Sie skizziert die Forschungsfrage: Inwiefern unterscheiden sich balkanische Strukturen im Rumänischen von entsprechenden Strukturen in anderen romanischen Sprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch)? Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung dieser Unterschiede und deren wissenschaftliche Erklärung, wobei die Frage nach der eindeutigen Zuordnung der Abweichungen zu balkanischen Einflüssen im Vordergrund steht. Der methodische Ansatz wird ebenfalls dargelegt: Die Untersuchung basiert auf einem Korpus von Tageszeitungen aus Rumänien, Frankreich, Spanien und Italien (Ausgabe vom 6. Juni 2008), der für exemplarische Sprachvergleiche verwendet wird, ohne quantitative Auswertungen.
2. Der Balkansprachbund: Dieses Kapitel liefert zunächst eine Definition der Begriffe "Sprachbund" und "Balkansprachbund". Es wird erläutert, dass Sprachbünde Gruppen geographisch benachbarter Sprachen sind, die auffällige grammatische Übereinstimmungen aufweisen, ungeachtet ihrer genetischen Verwandtschaft. Im Gegensatz dazu werden die romanischen Sprachen, deren Gemeinsamkeiten auf ihre gemeinsame lateinische Herkunft zurückzuführen sind, nicht als Sprachbund betrachtet. Das Kapitel beschreibt den Balkansprachbund als eine Gruppe genetisch unterschiedlich verwandter Sprachen auf dem Balkan, die trotz ihrer unterschiedlichen Ursprünge gemeinsame grammatische Merkmale aufweisen. Als Ursache für die Entstehung des Balkansprachbundes wird jahrhundertelanger Sprachkontakt und Transhumanz angeführt, die zu intensiven Interaktionen zwischen den verschiedenen Sprachgemeinschaften führten.
Schlüsselwörter
Rumänisch, Balkansprachbund, Romanische Sprachen, Sprachvergleich, Grammatische Strukturen, Sprachkontakt, Transhumanz, Französisch, Spanisch, Italienisch, Archaismen, morphologische und syntaktische Übereinstimmungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Balkanische Strukturen im Rumänischen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die balkanischen Strukturen im Rumänischen und vergleicht diese mit entsprechenden Strukturen im Französischen, Spanischen und Italienischen. Das Ziel ist es, die Sonderstellung des Rumänischen unter den romanischen Sprachen im Kontext des Balkansprachbundes zu beleuchten und die Einflüsse der umliegenden Sprachen auf seine grammatische Entwicklung zu analysieren.
Welche balkanischen Strukturen im Rumänischen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene grammatische Merkmale, darunter den nachgestellten bestimmten Artikel, den Zusammenfall von Genitiv und Dativ, die analytische Komparation, das Zahlsystem von 11 bis 19, den eingeschränkten Infinitivgebrauch, die analytische Futurbildung mit „wollen“, die Verdopplung des Objekts und die Verwendung von Personalpronomen als Possessivpronomen.
Wie wird der Balkansprachbund definiert?
Der Balkansprachbund wird als eine Gruppe genetisch unterschiedlich verwandter Sprachen auf dem Balkan definiert, die trotz ihrer unterschiedlichen Ursprünge gemeinsame grammatische Merkmale aufweisen. Die Entstehung wird auf jahrhundertelangen Sprachkontakt und Transhumanz zurückgeführt.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Untersuchung basiert auf einem Korpus von Tageszeitungen aus Rumänien, Frankreich, Spanien und Italien (Ausgabe vom 6. Juni 2008). Es werden exemplarische Sprachvergleiche durchgeführt, ohne quantitative Auswertungen.
Was ist die Forschungsfrage der Arbeit?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Inwiefern unterscheiden sich balkanische Strukturen im Rumänischen von entsprechenden Strukturen in anderen romanischen Sprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch)? Die Arbeit konzentriert sich auf die Untersuchung dieser Unterschiede und deren wissenschaftliche Erklärung, wobei die Frage nach der eindeutigen Zuordnung der Abweichungen zu balkanischen Einflüssen im Vordergrund steht.
Welche Sprachen werden verglichen?
Es wird ein Vergleich zwischen dem Rumänischen und den romanischen Sprachen Französisch, Spanisch und Italienisch durchgeführt, um die balkanischen Einflüsse auf das Rumänische herauszustellen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Balkansprachbund, ein Kapitel zum vergleichenden Sprachvergleich (Rumänisch mit Französisch, Spanisch und Italienisch), und eine Zusammenfassung. Die Einleitung begründet die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz. Das Kapitel zum Balkansprachbund liefert eine Definition und erläutert die Ursachen seiner Entstehung. Das Vergleichskapitel analysiert die spezifischen grammatischen Strukturen. Die Zusammenfassung fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Rumänisch, Balkansprachbund, Romanische Sprachen, Sprachvergleich, Grammatische Strukturen, Sprachkontakt, Transhumanz, Französisch, Spanisch, Italienisch, Archaismen, morphologische und syntaktische Übereinstimmungen.
- Citar trabajo
- Susanne Hasenstab (Autor), 2008, Rumänisch im Kontext des Balkansprachbundes. Balkanische Strukturen des Rumänischen und andere romanischen Sprachen (Französisch, Spanisch, Italienisch), Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151032