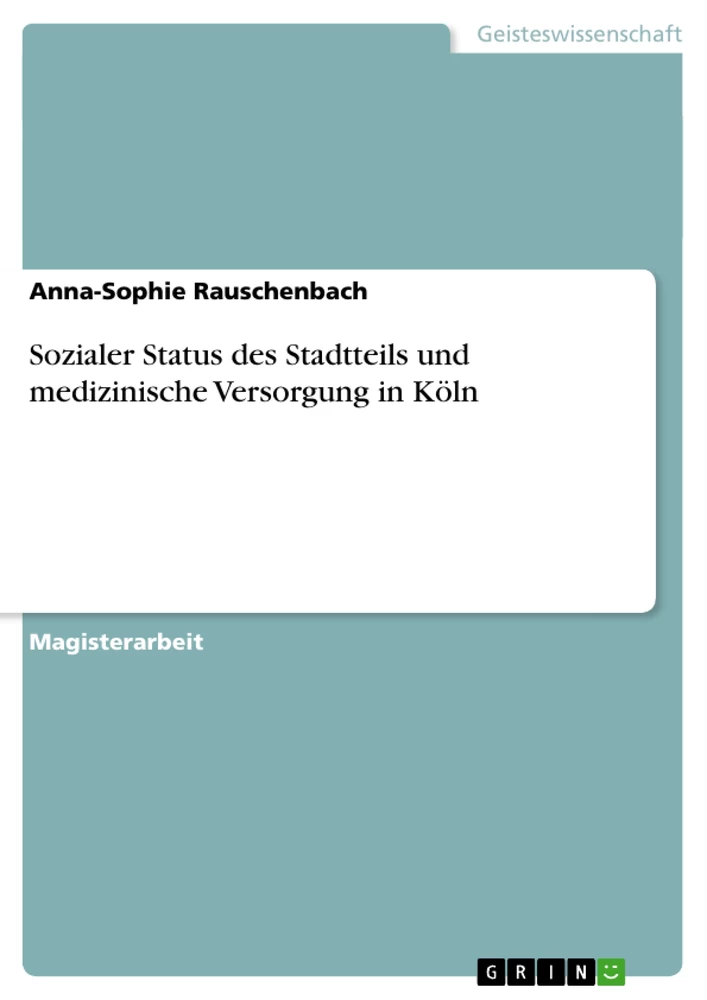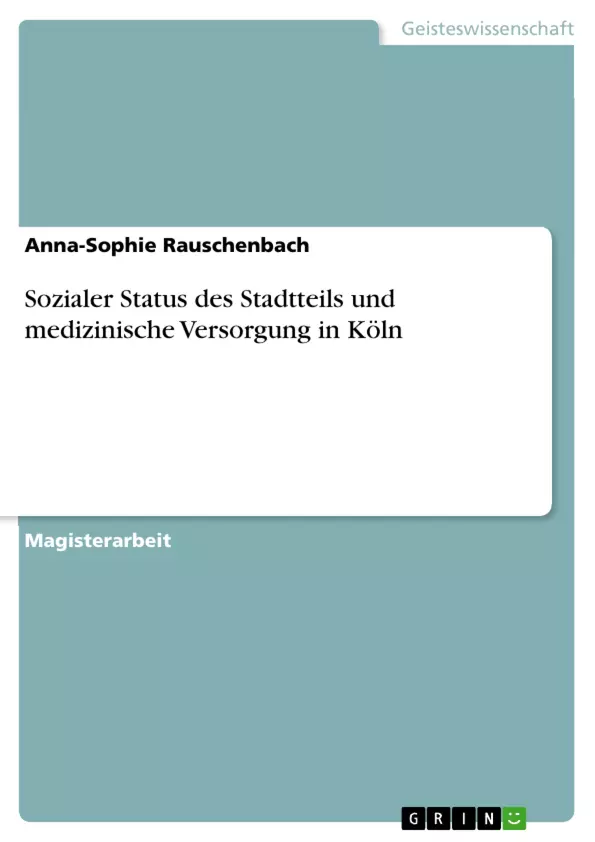Im Rahmen dieser Arbeit soll untersucht werden, in welchem Maße eine infrastrukturelle Benachteiligung in den städtischen Problemvierteln im Bereich der medizinischen Grundversorgung nachgewiesen werden kann. Als Untersuchungsgegenstand wurde das Merkmal der ambulanten medizinischen Versorgung gewählt, das eine messbare Ausstattungs- und Versorgungsgröße darstellt und bereits seit längerer Zeit durch die Debatte um die Zweiklassen-Medizin im Kontext sozialer Ungleichheit steht. Trotz der allgemeinen Verbesserung des Gesundheitszustandes und des wohlfahrtsstaatlichen Systems, stehen der sozioökonomische Statuts und der Gesundheitszustand einer Person weiterhin in engem Zusammenhang (Weyers/-Kunst 2006).
Die Arbeit hat es sich zum Ziel gesetzt, den inhaltlichen Zusammenhang sozialer Segregation und der Gesundheitsversorgung innerhalb eines Agglomerationsraums empirisch zu überprüfen. Unabhängig von individuellen Faktoren, wie etwa der Behandlungsqualität, liegt das vorrangige Interesse dieser Arbeit auf der strukturellen Versorgung mit niedergelassenen Ärzten.
Die Fragen sollen im Laufe dieser Arbeit empirisch überprüft werden, um auf diese Weise zu klären, ob eine angebotsorientierte Benachteiligung auf die armen Stadtteile von außen einwirkt und so Gebietseffekte in der medizinischen Versorgung für die Bewohner erzeugen. Als Untersuchungsraum wird beispielhaft die Stadt Köln als eine der größten Städte Deutschlands ausgewählt.
Zugleich soll in dieser Arbeit die Bedarfsplanung, bei der es um die Über- und Unterversorgung von ambulanten medizinischen Leistungen geht, thematisiert werden (Gemeinsamer Bundesausschuss 2009). Die Bedarfsplanungsrichtlinien, die die Niederlassung der Vertragsärzte regeln, bewegen sich innerhalb des kleinsten räumlichen Planungsbereichs auf gesamtstädtischer Ebene und berücksichtigen daher städtische Segregationsentwicklungen in keinster Weise. Diese gesetzliche Regelung soll hinterfragt und zugleich empirisch überprüft werden, ob in den Agglomerationsräumen, in denen die größte soziale und ökonomische Spanne innerhalb der deutschen Gesellschaft besteht, die Niederlassung von Ärzten dem Zufall überlassen werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Theoretische Rahmenbedingungen
- 2.1 Formen der Ungleichheit
- 2.2 Segregationsforschung
- 2.3 Medizinsoziologie
- 2.4 Medizinische Versorgungslage
- 2.4.1 Das deutsche Gesundheitssystem
- 2.4.2 Die ambulante Versorgung
- 2.4.3 Die Bedarfsplanung
- 2.4.4 Vergütung und Standortwahl
- 2.4.5 Medizinische Versorgungsforschung
- 2.4.6 Das Akteursnetz
- 2.5 Hypothesen
- 2.6 Das Untersuchungsgebiet
- 3. Methodik und Datenbasis
- 3.1 Datengrundlage
- 3.2 Variablen
- 3.3 Datenaufbereitung
- 3.4 Methodische Vorgehensweise
- 3.5 Das Logitmodell
- 3.6 Methodenkritik
- 4. Untersuchungsergebnisse
- 4.1 Deskriptive Auswertung
- 4.2 Bivariate Analyse - Prüfung von H1
- 4.3 Bivariate Analyse - Prüfung von H2
- 4.4 Einfache multivariate Analyse - Prüfung von H3
- 4.5 Logistische Regressionsanalyse – Einbezug der Kontrollvariable
- 4.6 Prüfung von H4
- 4.7 Zusammenfassung der Ergebnisse
- 5. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Segregation und der ambulanten medizinischen Versorgung in Köln. Ziel ist die empirische Überprüfung, ob eine infrastrukturelle Benachteiligung in ärmeren Stadtteilen im Bereich der medizinischen Grundversorgung besteht. Die Arbeit analysiert, ob eine angebotsorientierte Benachteiligung die Bewohner armer Stadtteile betrifft und so Gebietseffekte erzeugt.
- Soziale Segregation in Köln
- Ungleichverteilung der ambulanten medizinischen Versorgung
- Einfluss des Sozialstatus auf die medizinische Versorgung
- Gebietseffekte in der medizinischen Versorgung
- Analyse der Bedarfsplanung im Kontext sozialer Ungleichheit
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit, ausgehend von der wachsenden sozialräumlichen Ungleichheit in deutschen Großstädten und dem daraus resultierenden Problem der Verarmung in städtischen Räumen. Sie führt den Begriff der Segregation ein und hebt die doppelte Benachteiligung armer Bevölkerungsschichten in Problemvierteln hervor, die durch räumliche Isolation und Konzentration von Problemen entsteht. Der "Gebietseffekt" wird erklärt und die Arbeit fokussiert auf die Untersuchung des Zusammenhangs zwischen infrastruktureller Benachteiligung, speziell im Bereich der ambulanten medizinischen Versorgung, und sozialer Segregation in Köln. Die zentralen Forschungsfragen der Arbeit werden formuliert.
2. Theoretische Rahmenbedingungen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen der Arbeit dar. Es werden verschiedene Formen der Ungleichheit, Konzepte der Segregationsforschung und relevante Aspekte der Medizinsoziologie diskutiert. Ein Schwerpunkt liegt auf der medizinischen Versorgungslage in Deutschland, inklusive des Gesundheitssystems, ambulanter Versorgung, Bedarfsplanung, Vergütung und Standortwahl von Ärzten, sowie der medizinischen Versorgungsforschung und des Akteursnetzes. Das Kapitel mündet in die Formulierung von Hypothesen und der Beschreibung des Untersuchungsgebietes, Köln.
3. Methodik und Datenbasis: Dieses Kapitel beschreibt die methodische Vorgehensweise und die Datengrundlage der Studie. Es werden die verwendeten Variablen, die Datenaufbereitung, die methodische Vorgehensweise inklusive des Logitmodells und eine kritische Reflexion der Methoden erläutert. Es wird detailliert dargelegt, wie die Daten erhoben, aufbereitet und analysiert wurden, um die Forschungsfragen zu beantworten.
4. Untersuchungsergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es umfasst deskriptive Auswertungen, bivariate Analysen zur Prüfung der Hypothesen H1 und H2, eine einfache multivariate Analyse zur Prüfung von H3, die logistische Regressionsanalyse unter Einbezug von Kontrollvariablen zur Überprüfung der Hypothesen, und eine Zusammenfassung der Ergebnisse. Die gewonnenen Daten werden detailliert dargestellt und interpretiert.
Schlüsselwörter
Soziale Segregation, Medizinische Versorgung, Köln, Ambulante Ärzte, Bedarfsplanung, Gebietseffekt, Ungleichheit, Armut, Gesundheit, Logitmodell, Empirische Forschung
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Soziale Segregation und ambulante medizinische Versorgung in Köln
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht den Zusammenhang zwischen sozialer Segregation und der ambulanten medizinischen Versorgung in Köln. Im Fokus steht die Frage, ob eine infrastrukturelle Benachteiligung in ärmeren Stadtteilen im Bereich der medizinischen Grundversorgung besteht und ob eine angebotsorientierte Benachteiligung Gebietseffekte erzeugt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt soziale Segregation in Köln, die Ungleichverteilung der ambulanten medizinischen Versorgung, den Einfluss des Sozialstatus auf die medizinische Versorgung, Gebietseffekte in der medizinischen Versorgung und die Analyse der Bedarfsplanung im Kontext sozialer Ungleichheit. Theoretische Grundlagen umfassen verschiedene Formen der Ungleichheit, Konzepte der Segregationsforschung und Aspekte der Medizinsoziologie, sowie das deutsche Gesundheitssystem und die ambulante Versorgung.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Arbeit verwendet eine empirische Forschungsmethode. Die Datengrundlage, Variablen und die Datenaufbereitung werden detailliert beschrieben. Die methodische Vorgehensweise beinhaltet ein Logitmodell und eine kritische Reflexion der Methoden. Die Analyse umfasst deskriptive Auswertungen, bivariate Analysen und eine logistische Regressionsanalyse unter Einbezug von Kontrollvariablen.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung werden in den Kapiteln zu den deskriptiven Auswertungen, den bivariaten Analysen (Prüfung der Hypothesen H1 und H2), der multivariaten Analyse (H3), der logistischen Regressionsanalyse (unter Einbezug von Kontrollvariablen) und der Prüfung von H4 präsentiert. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse wird ebenfalls gegeben.
Welche Hypothesen wurden geprüft?
Die Arbeit formuliert Hypothesen (H1-H4) zum Zusammenhang zwischen sozialer Segregation und der ambulanten medizinischen Versorgung. Diese Hypothesen werden anhand der empirischen Daten geprüft und die Ergebnisse werden detailliert diskutiert.
Welche Daten wurden verwendet?
Das Kapitel "Methodik und Datenbasis" beschreibt detailliert die Datengrundlage der Studie. Es werden die verwendeten Variablen und die Datenaufbereitung erläutert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Theoretische Rahmenbedingungen, Methodik und Datenbasis, Untersuchungsergebnisse und Fazit und Ausblick. Ein detailliertes Inhaltsverzeichnis befindet sich im Dokument.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Segregation, Medizinische Versorgung, Köln, Ambulante Ärzte, Bedarfsplanung, Gebietseffekt, Ungleichheit, Armut, Gesundheit, Logitmodell, Empirische Forschung.
Wo finde ich die detaillierten Kapitelzusammenfassungen?
Detaillierte Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel (Einleitung, Theoretische Rahmenbedingungen, Methodik und Datenbasis, Untersuchungsergebnisse) sind im Dokument enthalten.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für die akademische Verwendung bestimmt, zur Analyse von Themen im Bereich der sozialen Segregation und medizinischen Versorgung.
- Citar trabajo
- Anna-Sophie Rauschenbach (Autor), 2010, Sozialer Status des Stadtteils und medizinische Versorgung in Köln, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151069