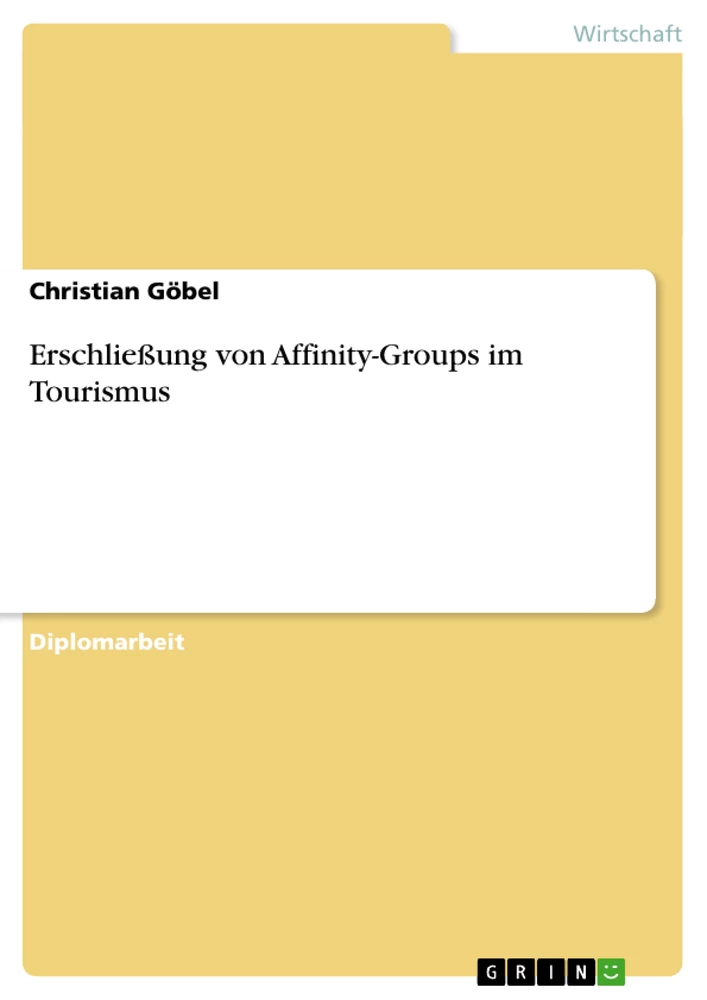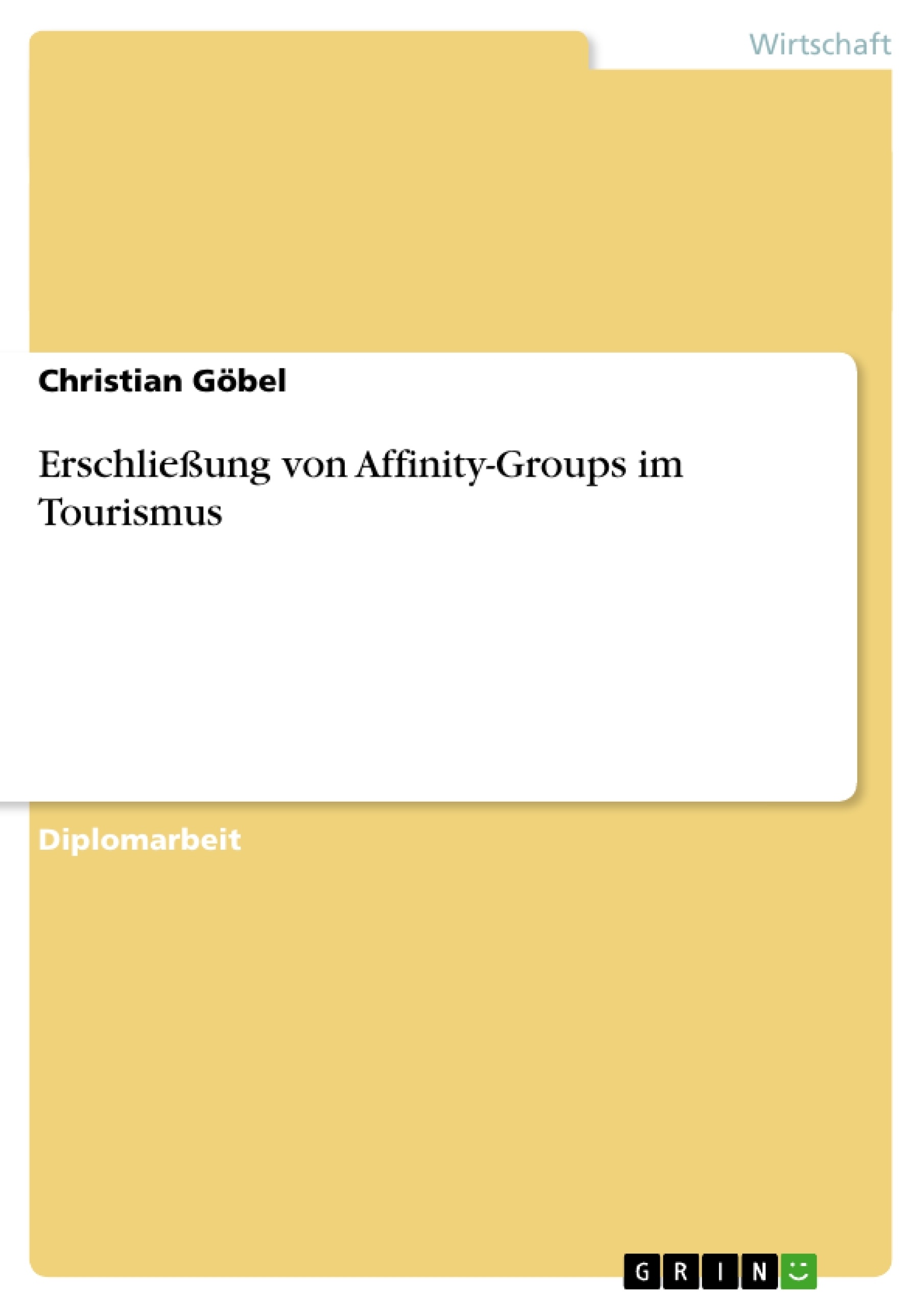Die Individualisierung des Konsums ist auch im Tourismus deutlich spürbar.
Undifferenzierte Massenprodukte sind daher immer weniger geeignet, der zunehmenden Bedürfnisdifferenzierung der Touristen gerecht zu werden.
Zielgruppendefinitionen wie die der Affinity-Group sollen helfen, den Markt in verhaltenshomogene Teilsegmente zu zerlegen und eine segmentspezifische Ausgestaltung der Marketingmaßnahmen zu ermöglichen.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Erschließung (Erfassung und Bearbeitung) der touristischen Affinity-Groups. Dazu wird in einem ersten Schritt auf die Grundlagen der Marktsegmentierung eingegangen, um die Relevanz einer Segmentierung nach Affinity-Groups zu verdeutlichen. Es stellt sich heraus, dass die im Tourismus üblichen Segmentierungskriterien (vor allem soziodemographische und verhaltensorientierte) durch psychographische und vor allem interpersonelle Kriterien ergänzt bzw. ersetzt werden sollten.
Nach einer umfassenden Analyse sozialer Gruppenbegriffe wird die Affinity-Group als Schnittmenge der drei sozialen Einheiten „Kategorie“, „Gruppe“ und „Bezugsgruppe“ definiert und deren starker Einfluss auf das individuelle Käuferverhalten erläutert. Die schwierige Operationalisierung stellt den größten Schwachpunkt des Affinity-Group-Konzeptes dar. In einer abschließenden Bewertung der Affinity-Group zeigt sich daher, dass eine solche Zielgruppendefinition nur unter bestimmten Bedingungen eine sinnvolle Anwendung in der Praxis finden kann. Aufgrund der Besonderheiten touristischer Güter und der Betrachtung der Affinity-Group als soziales Beziehungsnetzwerk ist für die Bearbeitung dieser Zielgruppe ein spezielles Marketing notwendig. Mimetisches Marketing wird dabei als zweckmäßiger erachtet als Zielgruppen-Marketing, da es sich nicht an einer abstrakten Zielgruppe orientiert, sondern sich in ein soziales Netzwerk integriert. Schließlich wird anhand der „Golfer“ die Operationalisierung einer Affinity-Group verdeutlicht und eine mögliche Ausgestaltung eines mimetischen Marketingkonzeptes für einen Golfreiseveranstalter vorgeschlagen.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung und Aufbau der Arbeit
- Marktsegmentierung
- Vorgang der Marktsegmentierung
- Segmentierungskriterien
- Dilemma der Marktsegmentierung
- Käuferverhalten als Basis der Segmentierung
- Soziologie der Gruppe
- Soziale Gruppe
- Definition Soziale Gruppe
- Gruppenarten
- Bezugsgruppe
- Affinity-Group
- Definition Affinität
- Definition Affinity-Group
- Operationalisierung und Identifizierung von Affinity-Groups
- Einfluss von Affinity-Groups auf das Käuferverhalten
- Wissen
- Normen
- Sozialer Vergleich
- Affinity-Group als Segmentierungsansatz
- Soziale Gruppe
- Affinity-Group-Marketing im Tourismus
- Besonderheiten des Tourismus-Marketing
- Vertrauen als Basis von Beziehungen
- Marketing von Beziehungen
- Mimetisches Marketing
- Die Affinity-Group „Golfer\" als Zielgruppe für einen Reiseveranstalter
- Segmentierungsstrategien von Golfreiseveranstaltern
- Segmentierung des Golfmarktes nach Affinity-Groups
- Golfer als Affinity-Group i.w.S.
- Golfer als Affinity-Group i.e.S.
- Affinity-Group-Marketing für einen Golfreiseveranstalter
- Identifikation
- Interfusion
- Co-Evolution
- Interpretation
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Erschließung von Affinity-Groups im Tourismus. Dabei wird insbesondere der Einfluss von Affinity-Groups auf das Käuferverhalten und die Relevanz dieser Gruppen für die Marktsegmentierung im Tourismus untersucht. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Definition und Operationalisierung des Affinity-Group-Konzeptes und erörtert die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der Bearbeitung dieser Zielgruppe für das Tourismus-Marketing ergeben.
- Marktsegmentierung und ihre Bedeutung für den Tourismus
- Das Konzept der Affinity-Group und seine Relevanz für die Marktsegmentierung
- Einfluss von Affinity-Groups auf das Käuferverhalten
- Marketingstrategien für Affinity-Groups im Tourismus
- Die praktische Anwendung des Affinity-Group-Konzeptes am Beispiel der Golfer
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel behandelt die Problemstellung und den Aufbau der Arbeit, indem es den Forschungsgegenstand der Affinity-Group-Erschließung im Tourismus einführt und den Aufbau der Arbeit erläutert.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit der Marktsegmentierung und stellt die Bedeutung der Segmentierung für den Tourismus dar. Es erläutert die verschiedenen Segmentierungskriterien und diskutiert die Herausforderungen der Marktsegmentierung im Tourismus.
- Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Soziologie der Gruppe und definiert verschiedene Gruppenbegriffe, wie soziale Gruppen, Bezugsgruppen und Affinity-Groups. Es untersucht die Operationalisierung und Identifizierung von Affinity-Groups und deren Einfluss auf das Käuferverhalten.
- Das vierte Kapitel untersucht die Anwendung des Affinity-Group-Konzeptes im Tourismus und analysiert die Besonderheiten des Tourismus-Marketings. Es betrachtet das Konzept des mimetischen Marketings und dessen Einsatz bei der Bearbeitung von Affinity-Groups.
- Das fünfte Kapitel präsentiert die Golfer als Affinity-Group und zeigt die Segmentierungsstrategien von Golfreiseveranstaltern auf. Es entwickelt ein mimetisches Marketingkonzept für einen Golfreiseveranstalter und erläutert die verschiedenen Phasen dieses Konzeptes.
Schlüsselwörter
Marktsegmentierung, Affinity-Group, Tourismus, Käuferverhalten, mimetisches Marketing, Golf, Golfer, Soziales Netzwerk, Bezugsgruppe, Gruppenverhalten, Marketingstrategien, Zielgruppendefinition.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine Affinity-Group im Tourismus?
Eine Affinity-Group ist eine Gruppe von Menschen, die durch gemeinsame Interessen, Hobbys oder Werte verbunden sind (z. B. Golfer) und dadurch ein ähnliches Reiseverhalten zeigen.
Warum reicht soziodemographische Segmentierung heute nicht mehr aus?
Durch die Individualisierung des Konsums sagen Alter oder Einkommen weniger über das Reiseverhalten aus als psychographische Kriterien und die Zugehörigkeit zu sozialen Netzwerken.
Was versteht man unter „Mimetischem Marketing“?
Mimetisches Marketing orientiert sich nicht an abstrakten Zielgruppen, sondern versucht, sich organisch in bestehende soziale Netzwerke und Beziehungsstrukturen zu integrieren.
Wie beeinflussen Affinity-Groups das Käuferverhalten?
Sie wirken durch soziale Normen, gemeinsamen Wissensaustausch und den sozialen Vergleich innerhalb der Gruppe, was die Reiseentscheidung maßgeblich prägt.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Operationalisierung?
Es ist schwierig, Affinity-Groups statistisch genau zu erfassen, da die Grenzen zwischen lockeren „Kategorien“ und festen „Bezugsgruppen“ oft fließend sind.
- Quote paper
- Christian Göbel (Author), 2003, Erschließung von Affinity-Groups im Tourismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15107