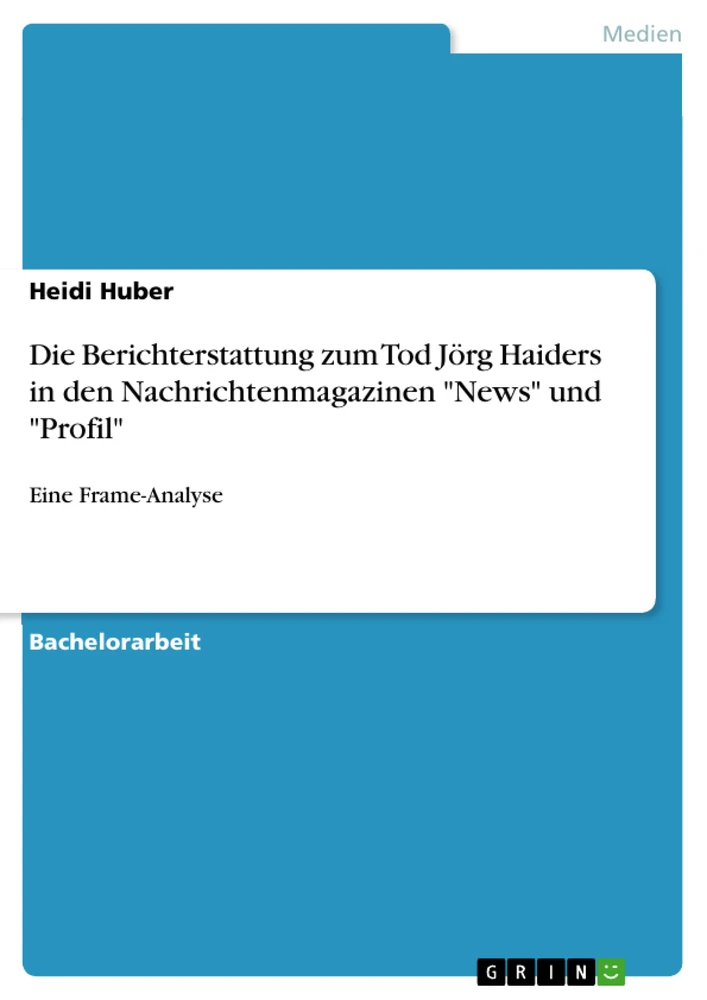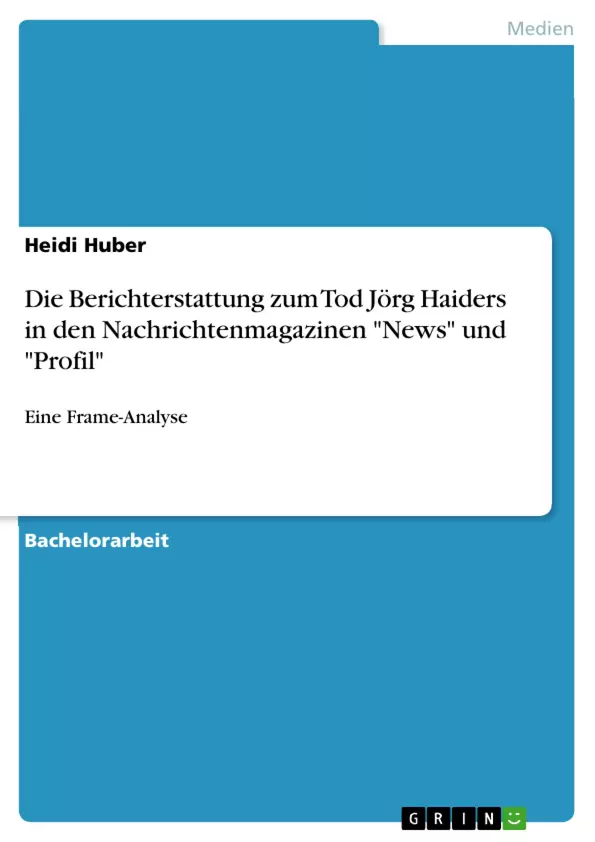„Wenn jemand interessant ist, dann ist eben auch sein Ende wichtig“ (Brunn 1999, 27)
Problemstellung und Relevanz des Themas
Eine der schillerndsten Persönlichkeiten der österreichischen Politik ist am 11. Oktober 2008 um 1.30 Uhr bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen – Jörg Haider. Kein anderer Politiker hat so sehr polarisiert wie er und kein anderer Politiker wurde so oft aufgrund seiner Fremdenfeindlichkeit und Eigenheiten kritisch in den Medien dargestellt wie der langjährige FPÖ-Chef und BZÖ-Gründer. Jörg Haider war nicht nur ein Vollblutpolitiker, er war auch ein Medienstar und der Kärntner Volksheld. Er war ein Oberösterreicher, der in Kärnten seine Hochburg fand. Er war einer der erfolgreichsten Politiker des Landes, und hatte dennoch nie ein Regierungsamt inne. Haider verkörperte einen völlig anderen Politiker-Typus – modern, rhetorisch perfekt, elegant.
Die Nachricht von seinem tödlichen Unfall
Die Meldung wurde sowohl für die heimische als auch für die internationale Presse zum Medienereignis. Das Konterfei des Kärntner Landeshauptmannes und BZÖ-Gründers zierte alle Tageszeitungen. So erschienen auch die Magazine „News“ und „Profil“ mit einer ausführlichen Berichterstattung zum Ableben und zur Person Jörg Haiders. In zahlreichen Artikeln wird Haider charakterisiert, er wird als „Landesvater“, „jugendlicher Revoluzzer“, „Staatsmann“, „Demagoge und Provokateur“ sowie als „Verhetzer“ bezeichnet, um nur einige verwendete Synonyme der Journalisten zu nennen. Die Berichterstattung zu seinem Tod folgt einem erwarteten Muster. Sujets, die ihn schon zu Lebzeiten beschäftigten, werden auch in der Berichterstattung aufgegriffen. Seine Politik wird von beinahe allen Journalisten verpönt, seine Ausstrahlung und sein Charisma jedoch bewundert. Das Thema „Ausländer“ und „Nationalsozialismus“ zieht sich durch die gesamte Berichterstattung und taucht immer wieder auf. Eine der zentralsten Eigenschaften, darüber sind sich beide Magazine einig, ist der Hang zur Inszenierung und Schauspielerei beim 58-jährigen Politiker.
Jörg Haider war prominent. Er war spannend für die Medien und sein abruptes Ableben musste zweifelsohne zum Medienereignis werden. Die Frage, die sich hierbei stellt, ist, mit welchen Frames die Journalisten hier arbeiteten, um Jörg Haider darzustellen. Wie wurde Jörg Haider letztendlich in den Magazinen „News“ und „Profil“ dargestellt?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Problemstellung und Relevanz des Themas
- 1.2. Forschungsfrage
- 1.3. Methodik und Operationalisierung
- 1.4. Bisheriger Forschungsstand
- 1.5. Aufbau der Arbeit
- 2. Prominenz und Tod:
- 2.1. Was ist Framing?
- 2.2. Framing durch die Medien und die Politik
- 2.3. Die Tragik im Journalismus
- 2.4. Die Nachrufkultur der Medien
- 3. Jörg Haider - Politiker und Medienstar
- 4. Die Analyse der Berichterstattung
- 4.1. Prägung
- 4.1.1. Herkunft
- 4.1.2. Elternhaus
- 4.2. Der Ausnahme-Politiker und sein politischer Stil
- 4.3. Volksnah, heimatverbunden, bodenständig
- 4.4. Das Ausländer-Thema
- 4.5. Nationalsozialismus
- 4.6. Zwiespältigkeit und Schauspielerei
- 4.7. Der „alte“ und „neue“ Haider
- 4.8. Jörg Haider privat
- 4.8.1. Der Familienmensch
- 4.8.2. Sexualität
- 4.8.3. Der Mythos
- 4.9. Tod
- 5. Verbindung von Empirie und Theorie
- 5.1. Sprachliche Analyse
- 5.1.1. Wortwahl
- 5.1.2. Rhetorische und stilistische Mittel
- 5.2. Frames in der Berichterstattung
- 5.2.1. News
- 5.2.2. Profil
- 5.3. Mögliche Framing-Effekte
- 6. Konklusion
- 6.1. Resümee
- 6.2. Beantwortung der Forschungsfrage
- 6.3. Schlussfolgerung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Bakkalaureatsarbeit analysiert die Berichterstattung zum Tod Jörg Haiders in den österreichischen Nachrichtenmagazinen „Profil“ und „News“. Die Arbeit zielt darauf ab, die Frames zu identifizieren, die in der Berichterstattung verwendet wurden, um Jörg Haider darzustellen. Sie untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Magazinen hinsichtlich der verwendeten Frames, der rhetorischen und sprachlichen Mittel sowie der Wortwahl. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie die Person Jörg Haider in den Magazinen „Profil“ und „News“ dargestellt wurde.
- Framingprozesse in der Berichterstattung über den Tod von Prominenten
- Die Darstellung Jörg Haiders in den österreichischen Medien
- Analyse von Frames und rhetorischen Mitteln in der Berichterstattung
- Die Rolle von „Profil“ und „News“ in der politischen Berichterstattung
- Die Nachrufkultur der Medien
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in das Thema der Arbeit ein, indem es die Problemstellung und Relevanz des Themas darlegt. Außerdem werden die Forschungsfrage, die Methodik, der bisherige Forschungsstand und der Aufbau der Arbeit erläutert.
Das zweite Kapitel widmet sich der theoretischen Betrachtungsweise zum Framingprozess in der Berichterstattung. Hier werden die Begriffe „Framing“ und „Nachrufkultur der Medien“ definiert und ihre Bedeutung im Kontext der Berichterstattung über den Tod von Prominenten diskutiert.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Person Jörg Haiders und seiner Rolle als Politiker und Medienstar. Hier wird sein Leben, seine politische Karriere und sein Image in der Öffentlichkeit beleuchtet.
Das vierte Kapitel analysiert die Berichterstattung zum Tod Jörg Haiders in den Magazinen „Profil“ und „News“. Hier werden die unterschiedlichen Frames, die rhetorischen und sprachlichen Mittel sowie die Wortwahl der Journalisten untersucht. Die Analyse betrachtet auch die unterschiedlichen Darstellungen Jörg Haiders in den beiden Magazinen.
Das fünfte Kapitel verbindet die empirischen Ergebnisse mit der theoretischen Betrachtung. Hier werden die identifizierten Frames in den Kontext der Framingtheorie eingeordnet und ihre möglichen Effekte auf die Rezeption der Berichterstattung analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit Themen wie Framing, Medienberichterstattung, Prominentenkult, Nachrufkultur, Jörg Haider, „Profil“, „News“, politische Kommunikation, rhetorische Mittel, Sprachliche Analyse.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der Analyse der Berichterstattung über Jörg Haider?
Die Arbeit untersucht, welche "Frames" (Deutungsmuster) die Magazine "News" und "Profil" verwendeten, um die Person Jörg Haider nach seinem Tod darzustellen.
Was versteht man unter "Framing" im Journalismus?
Framing bezeichnet den Prozess, bei dem Medien bestimmte Aspekte einer Realität hervorheben, um eine bestimmte Problemdefinition oder moralische Bewertung zu fördern.
Welche gegensätzlichen Begriffe wurden für Haider verwendet?
Journalisten bezeichneten ihn einerseits als "Landesvater" und "Staatsmann", andererseits als "Demagoge", "Provokateur" und "Verhetzer".
Welche Themen dominierten die Nachrufe?
Zentrale Themen waren sein politischer Stil, das Ausländer-Thema, seine Beziehung zum Nationalsozialismus sowie sein Hang zur Inszenierung.
Wie unterschieden sich "News" und "Profil" in ihrer Darstellung?
Die Arbeit analysiert die spezifischen rhetorischen Mittel und Wortwahlen beider Magazine, um Unterschiede in der Bewertung des "Phänomens Haider" aufzuzeigen.
- Citation du texte
- BA Bakk.Komm. Heidi Huber (Auteur), 2009, Die Berichterstattung zum Tod Jörg Haiders in den Nachrichtenmagazinen "News" und "Profil", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151100