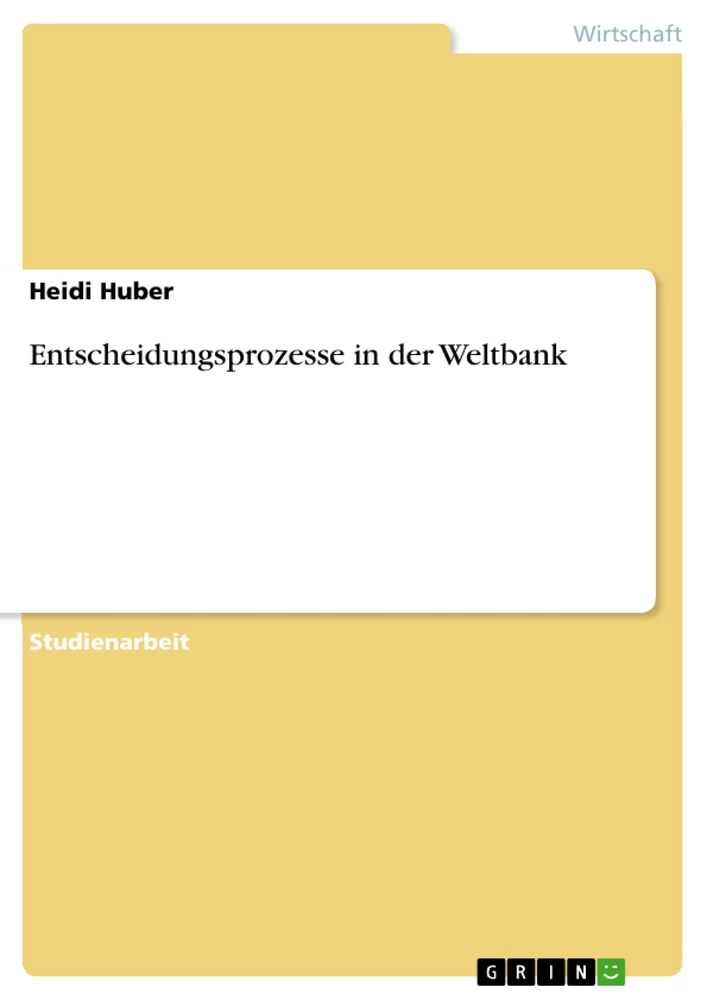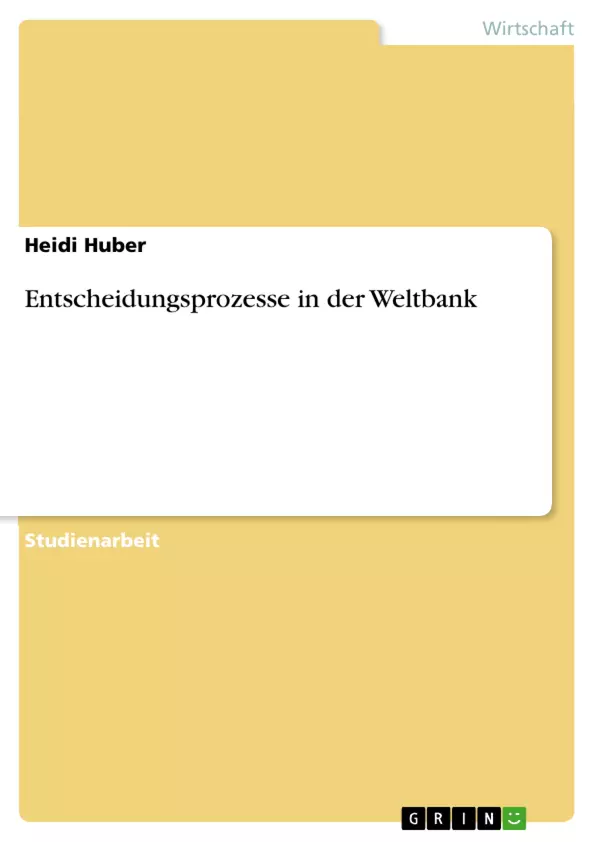Entscheidungen in internationalen Organisationen werfen stets die Frage der Verantwortlichkeit und Kontrolle auf. Die Weltbank hat 185 Mitglieder, fünf von ihnen spielen eine maßgebliche Rolle und es ist kein Zufall, dass diese fünf Staaten (USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien) zu den größten Anteilseignern zählen und vor allem die USA hier noch eine Sonderstellung einnimmt. Entscheidungen in internationalen Organisationen spiegeln häufig die Interessen ihrer stärksten Mitglieder wieder oder unterstehen dem Einfluss mächtiger Interessengruppen. Es stellt sich daher die Frage, ob und wenn ja von welchen Interessen die Weltbank bei der Vergabe von Projekten beeinflusst wird. Dazu muss die Geschichte der Bank von ihrer Gründung bis zum 11. Präsidenten, Robert Zoellick, beleuchtet werden. Das Selbstverständnis der Bank hat sich in den vergangenen 65 Jahren ebenso gewandelt wie ihre Ziele und Agenden. Um auf die scharfe Kritik in den 80er Jahren zu reagieren, veränderte die Weltbank ihr Entscheidungsverfahren von einem zweistufigen zu einem dreistufigen Prozess. Die Bank schuf eine offiziell unabhängige Kontrollinstanz (Inspection Panel), die seit 1993 Anlaufstelle für Beschwerden ist und die Einhaltung der Richtlinien kontrolliert. Richtlinien für die Vergabe und Finanzierung von Projekten existieren zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur in den Bereichen Umwelt und Soziales. Eine eindeutige Reglementierung in anderen zentralen Bereichen wurde bislang verabsäumt. Eine normative Betrachtung der Projektentscheidungen der Weltbank erfordert eine Betrachtung aus der Sicht der Präferenzen der Mitgliedsländer sowie ihrer Akteure im Hintergrund. Wie sachgerecht die Entscheidungen der Weltbank hinsichtlich der Erfüllung ihres Hauptziels, nämlich der Verringerung der Armut, ist, kann am Beispiel des Qinghai-Staudamm-Projektes oder des Tschad-Kamerun-Pipeline-Projektes dargestellt werden. Diese Beispiele zeigen zudem anschaulich, wie viel politisches Kalkül in den Entscheidungsprozess mit einfließt und von welchen Interessen die Staaten geleitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung.
- 1.1 Problemstellung und Relevanz des Themas
- 1.2 Fragestellung und Hypothesen...
- 1.3 Methodik...........
- 1.4 Aufbau der Arbeit......
- 2. Die Institution,,Weltbank“.
- 2.1 Gründungsgeschichte..
- 2.2 Institutioneller Aufbau.
- Stimmenverteilung
- 2.3 Aufgaben der Weltbank..
- 2.4 Von 1946 bis 2009......
- 3. Entscheidungsverfahren............
- 3.1 Zweistufiges Entscheidungsverfahren – die Macht des Sekretariats………………………..
- 3.2 Dreistufiges Entscheidungsverfahren.
- 3.3 Das Projektvergabeverfahren an Beispielen
- 3.4 Die Rolle der USA.
- 4. Die Weltbank in der Kritik..\n4.1 Entwicklung, quo vadis?
- 5. Konklusion
- 5.1 Resümee......
- 5.2 Beantwortung der Forschungsfragen und Hypothesen.
- 5.3 Schlussfolgerung..\n
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der Weltbank und analysiert den Einfluss der Interessen der Geberländer bei der Finanzierung von Entwicklungsprojekten. Sie befasst sich mit der Geschichte der Weltbank, ihrem institutionellen Aufbau und den verschiedenen Entscheidungsverfahren. Außerdem wird die Kritik an der Weltbank beleuchtet und die Frage nach ihrer Rolle als Entwicklungshelfer im 21. Jahrhundert gestellt.
- Die Entscheidungsfindungsprozesse innerhalb der Weltbank
- Der Einfluss der Interessen der Geberländer bei der Finanzierung von Projekten
- Die Rolle der Weltbank als Entwicklungshelfer
- Die Kritik an der Weltbank
- Die Geschichte und der institutionelle Aufbau der Weltbank
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung und Relevanz des Themas ein. Es werden die Forschungsfrage und die Hypothese der Arbeit formuliert. Kapitel 2 bietet einen Überblick über die Weltbank als Institution, ihre Gründung, ihren institutionellen Aufbau und ihre Aufgaben. Kapitel 3 analysiert die Entscheidungsverfahren der Weltbank, die Rolle der Geberländer und die konkrete Projektvergabe. Kapitel 4 beleuchtet die Kritik an der Weltbank. Die Konklusion fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und beantwortet die Forschungsfrage.
Schlüsselwörter
Entscheidungsprozesse, Weltbank, Entwicklungshilfe, Geberländer, Interessen, Kritik, institutioneller Aufbau, Projektvergabe, Bretton-Woods-Institutionen.
Häufig gestellte Fragen
Wer hat den größten Einfluss in der Weltbank?
Die fünf größten Anteilseigner – USA, Japan, Deutschland, Frankreich und Großbritannien – spielen die maßgebliche Rolle, wobei die USA eine Sonderstellung einnehmen.
Was ist das Inspection Panel?
Es ist eine 1993 geschaffene, unabhängige Kontrollinstanz, bei der Betroffene Beschwerden über die Nichteinhaltung von Richtlinien bei Weltbank-Projekten einreichen können.
Wie werden Projekte bei der Weltbank vergeben?
Das Verfahren wandelte sich von einem zweistufigen (Macht des Sekretariats) zu einem komplexeren dreistufigen Prozess, um Transparenz und Kritik Rechnung zu tragen.
Welche Kritik gibt es an der Weltbank?
Kritisiert werden politisches Kalkül bei der Vergabe, die Vernachlässigung sozialer Folgen und der starke Einfluss der Interessen mächtiger Geberländer.
Was war das Problem beim Tschad-Kamerun-Pipeline-Projekt?
Es dient als Beispiel dafür, wie wirtschaftliche Interessen der Geberländer und politisches Kalkül oft über das eigentliche Ziel der Armutsbekämpfung gestellt werden.
- Quote paper
- Heidi Huber (Author), 2009, Entscheidungsprozesse in der Weltbank, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151102