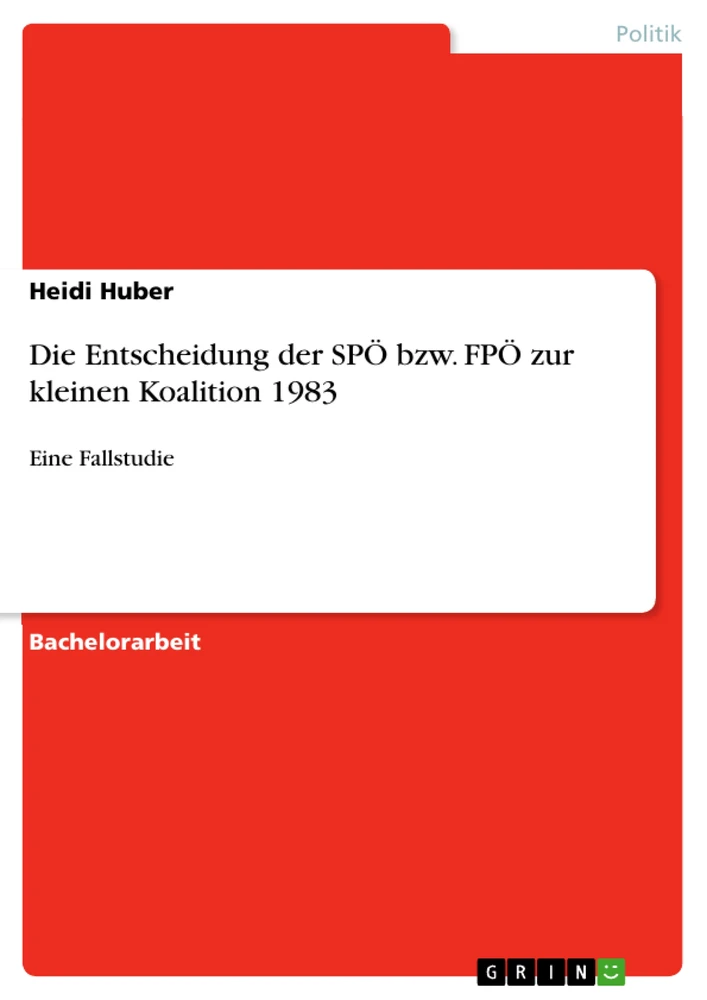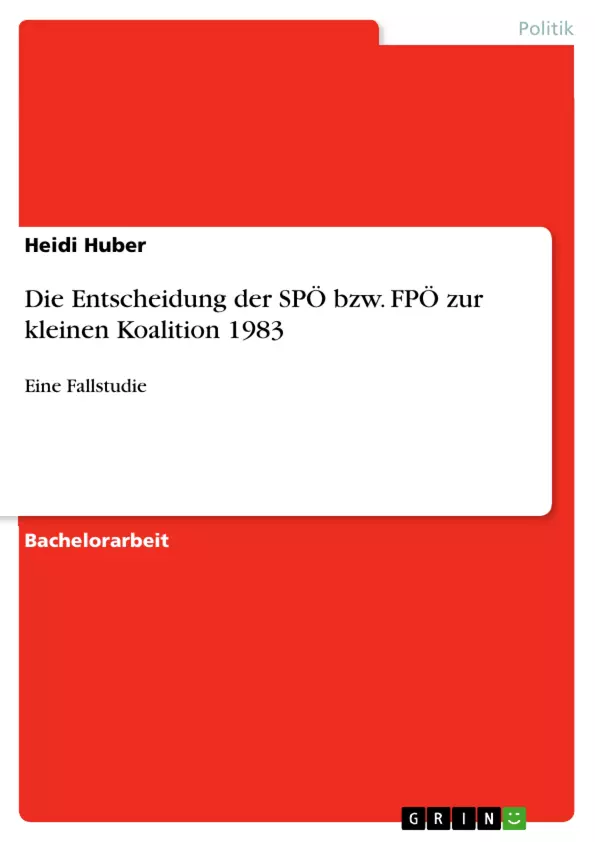1982 entschied sich Bruno Kreisky für eine Wiederkandidatur an der Spitze der SPÖ. Die Bedingungen für seine Kandidatur: Die SPÖ muss die absolute Mehrheit beibehalten, Anton Benya als ÖGB-Präsident im Amt bleiben und er selbst wollte freie Hand bei der Regierungsbildung.
Die SPÖ verlor die Nationalratswahl am 24. April 1983 und musste sich somit nach 13 Jahren Alleinregierung einen Koalitionspartner an die Seite nehmen. Die FPÖ erreichte lediglich fünf Prozent der Stimmen. Die Freiheitlichen erzielten somit das schwächste Ergebnis ihrer Geschichte, sollten es aber dennoch zum Juniorpartner und somit zu einer Regierungsbeteiligung schaffen. Als „Logik der Stunde“, wie es Anton Pelinka formulierte, galt damals die Bildung einer kleinen Koalition. Schon im Wahlkampf hatte sich abgezeichnet, dass die SPÖ, wenn sie denn die absolute Mehrheit verliert, die FPÖ ins Boot holen würde. Kreisky hatte schon 1970 eng mit der FPÖ zusammengearbeitet, um eine Minderheitsregierung bilden zu können und knüpfte enge Kontakte an den damaligen Obmann, Friedrich Peter. Zudem schloss die SPÖ im Vorfeld der Wahl eine Koalition mit der ÖVP dezidiert aus. Am 24. Mai 1983, also nur vier Wochen nach der geschlagenen Wahl, präsentierte Fred Sinowatz als Nachfolger Kreiskys ein politisches Experiment. Damit die ÖVP in Opposition und die SPÖ an der Macht bleibt, wagt Sinowatz erstmals in der Geschichte der Republik eine Koalition mit der FPÖ unter Norbert Steger. Kreisky, gesundheitlich bereits angeschlagen, hatte letztendlich entscheidend die Finger im Spiel und stellte den Motor für die erste rot-blaue Koalition dar.
[...]
Für die SPÖ unter Fred Sinowatz war die kleine Koalition mit der FPÖ das kleinste von drei Übeln. Es galt, die Zeit, bis man wieder die absolute Mandatsmehrheit inne hatte, zu überbrücken. Für die FPÖ unter Norbert Steger war es die Chance, sich als moderne liberale Partei zu präsentieren und den Geist von 1945 abzuschütteln.
An dieser Entscheidung wird deutlich, welche Parteiziele in der SPÖ und der FPÖ verfolgt wurden. Dies ist der wesentliche Aspekt dieser Fallstudie. Ich möchte den Fokus meiner Untersuchung auf die Parteiziele und –strategien richten, die mit der Bildung der kleinen Koalition im Jahre 1983 verfolgt wurden und welche Gewichtung die einzelnen Ziele (votes, policy, office) jeweils hatten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1. Problemstellung und Relevanz des Themas
- 1.2. Forschungsfrage und Hypothesen
- 1.3. Methodik
- 1.4. Aufbau der Arbeit
- 2. THEORETISCHE BETRACHTUNG
- 2.1. Parteiverhalten und Kompromisse
- 2.1.1. office-, policy- und vote-seeking parties
- 2.1.2. trade-offs und Kompromisse
- 3. DIE SPÖ
- 3.1. Historische Entwicklung nach 1945
- 3.2. Die innerparteiliche Entwicklung der SPÖ
- 3.3. Die inhaltliche Positionierung der Partei
- 4. DIE FPÖ
- 4.1. Historische Entwicklung: Vom Vdu zur liberalen FPÖ
- 4.2. Die innerparteiliche Entwicklung der FPÖ
- 4.3. Die inhaltliche Positionierung der Partei
- 5. DIE BILDUNG DER KLEINEN KOALITION
- 5.1. Rot-blaue Annäherungen
- 5.2. Die Nationalratswahlen 1970
- 5.3. Die Nationalratswahlen 1983
- 5.4. Regierungsverhandlungen und Koalitionsoptionen
- 5.5. Einigung nach vier Wochen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Entscheidung der SPÖ und FPÖ zur Bildung der kleinen Koalition im Jahr 1983. Sie analysiert die Faktoren, die zu dieser Entscheidung führten, insbesondere die Parteiziele und -strategien der beiden Parteien.
- Analyse der Parteiziele (office, policy, votes) im Kontext der Koalitionsbildung
- Untersuchung der inhaltlichen Positionen und Gemeinsamkeiten/Unterschiede der SPÖ und FPÖ im Jahr 1983
- Bewertung des Einflusses externer Faktoren wie Volatilität, Regierungsbeteiligung und des Einflusses von Bruno Kreisky
- Erörterung der inneren Debatten innerhalb der SPÖ und FPÖ zur Bildung der Koalition
- Bewertung der damaligen öffentlichen Wahrnehmung und Akzeptanz der rot-blauen Koalition
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Problemstellung und Relevanz des Themas darlegt. Sie führt die Forschungsfrage und die zentralen Hypothesen der Untersuchung ein. Anschliessend wird ein theoretischer Rahmen präsentiert, der Parteiverhalten und Kompromisse im Kontext von office-, policy- und vote-seeking parties beleuchtet.
Die folgenden Kapitel widmen sich der SPÖ und FPÖ, indem sie die historische Entwicklung, die innerparteiliche Entwicklung und die inhaltliche Positionierung beider Parteien im Vorfeld der Koalitionsbildung analysieren.
Die Bildung der kleinen Koalition im Jahr 1983 wird im Detail beleuchtet, wobei die Annäherungen der beiden Parteien, die Nationalratswahlen von 1970 und 1983 sowie die Regierungsverhandlungen und Koalitionsoptionen untersucht werden.
Schlüsselwörter
Diese Arbeit untersucht die Entscheidung der SPÖ und FPÖ zur Bildung der kleinen Koalition im Jahr 1983. Sie befasst sich mit den zentralen Themen Parteiziele, politische Strategien, Kompromissfindung, Koalitionsbildung und der Rolle von Bruno Kreisky. Die Arbeit verwendet Forschungsmethoden der Politikwissenschaft und Soziologie, um die politische Situation in Österreich im Kontext der 1980er Jahre zu analysieren.
Häufig gestellte Fragen zur kleinen Koalition 1983
Warum kam es 1983 zur Koalition zwischen SPÖ und FPÖ?
Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit suchte die SPÖ unter Fred Sinowatz einen Partner, um die ÖVP in der Opposition zu halten. Die FPÖ war der bevorzugte Partner.
Welche Rolle spielte Bruno Kreisky bei dieser Entscheidung?
Kreisky war der wesentliche Motor im Hintergrund. Er hatte bereits 1970 mit der FPÖ kooperiert und ebnete den Weg für das rot-blaue Experiment.
Was waren die Ziele der FPÖ unter Norbert Steger?
Die FPÖ wollte sich als moderne, liberale Partei etablieren und die historische Belastung der Nachkriegszeit hinter sich lassen.
Was bedeuten die Begriffe „office-, policy- und vote-seeking“?
Es sind politikwissenschaftliche Kategorien für Parteiverhalten: Streben nach Ämtern (office), nach inhaltlicher Umsetzung (policy) oder nach Wählerstimmen (votes).
Wie lange dauerten die Regierungsverhandlungen?
Die Einigung auf die kleine Koalition erfolgte bereits vier Wochen nach der Nationalratswahl.
- Quote paper
- BA Bakk.Komm. Heidi Huber (Author), 2009, Die Entscheidung der SPÖ bzw. FPÖ zur kleinen Koalition 1983, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151113