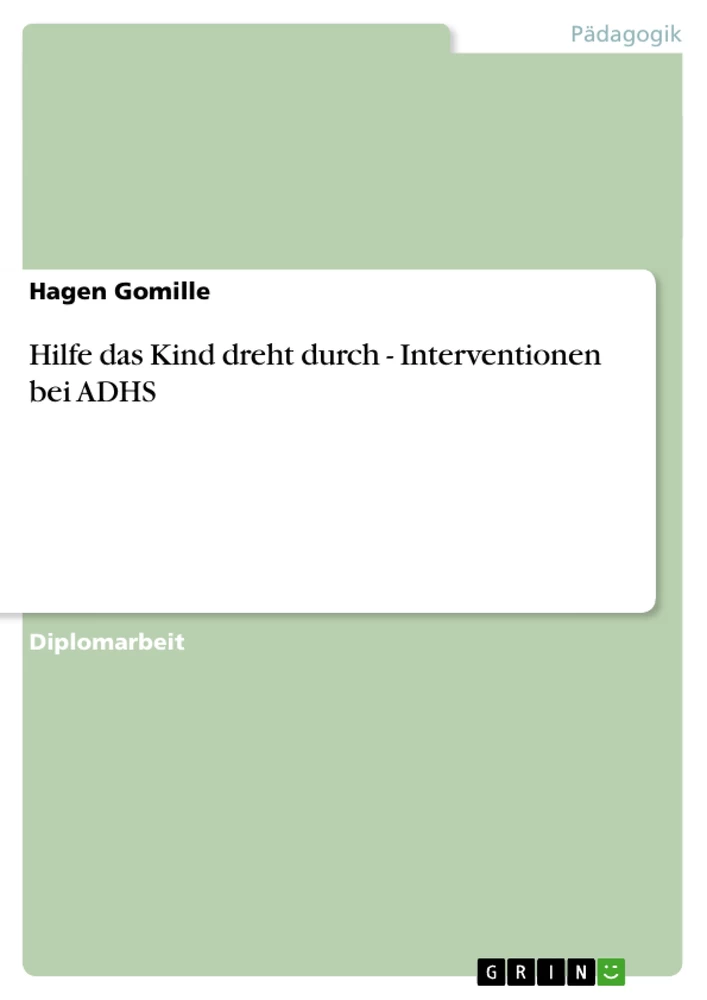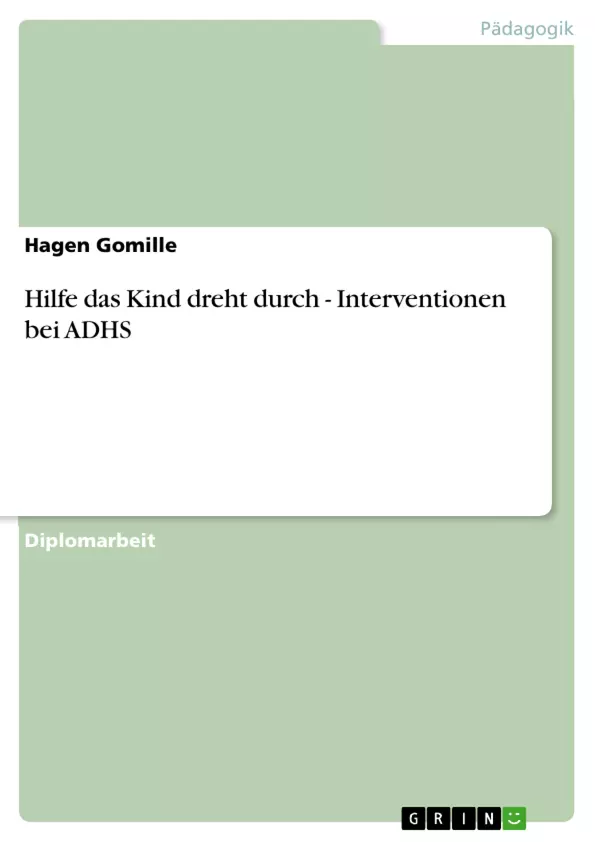Der Titel sagt alles. Diese Arbeit verschafft einen Überblick an Maßnahmen bei ADHS. Besonders geeignet für angehende Schulpädagogen.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I. 1 Fallbeispiel
- I. 2 Definitionsansätze/Begriffserklärung
- I. 2.1 Was ist Aufmerksamkeit?
- I. 2.2 Was ist bei Aufmerksamkeitsdefizit gestört?
- I. 2.3 Nomenklatur
- I. 3 Klassifikation
- I. 4 Epidemiologie
- I. 5 Verlauf
- I. 6 Ursachen
- I. 6.1 Neurobiologische Faktoren
- I. 6.2 Genetische Faktoren
- I. 6.3 Strukturelle Schädigungen des Gehirns
- I. 6.4 Allergische Reaktionen
- I. 6.5 Psychosoziale Aspekte
- I. 6.6 Neurophysiologische Aspekte
- I. 6.7 Neuropsychologische Aspekte
- I. 6.8 ADHS und Trauma
- I. 6.9 die Jäger-Hypothese (nach Hartmann)
- I. 7 Komorbidität
- I. 7.1 ADHS und Tic-Störungen
- I. 7.2 ADHS und Störung des Sozialverhaltens
- I. 7.3 Affektive und/oder Angsterkrankungen
- I. 7.4 ADHS und Zwang
- I. 7.5 ADHS und umschriebene Entwicklungsstörungen - insbesondere Lese-Rechtschreib-Schwäche
- I. 7.6 ADHS und Trotzverhalten
- I. 8 Was kann allgemein helfen?
- I. 9 Die multimodale Therapie von Kindern und Jugendlichen mit hyperkinetischen Störungen
- I. 9.1 Pharmakotherapie
- I. 9.2 Psychotherapie
- I. 10 Andere Therapieformen
- I. 10.1 Therapeutisches Reiten
- I. 10.2 Trommeln
- I. 10.3 Schwimmen bei ADHS-Kindern
- II. Standortbestimmung des Sozialarbeiters/Sozialpädagogen in der Behandlung psychischer Störungen
- II. 1.1 Umfeldbezogene Maßnahmen bei ADHS
- II. 1.2 Begriff Beratung
- II. 1.3 Grundsätze
- II. 1.4 Fachrichtungen in der Familienberatungsstelle
- II. 1.5 Anlässe für Familienberatung
- II. 1.6 Psychotherapie in der Beratung
- II. 1.7 Auslösender Moment
- II. 1.8 Gestaltung der Begegnung des Ratsuchenden
- II. 1.9 Gesprächsführung und Beratungsablauf
- II. 1.10 Rechtsgrundlagen
- II. 1.11 Finanzierung
- II. 1.12 Zugangsbarrieren
- II. 1.13 Ziele einer Beratung allgemein
- II. 1.14 Beratung hinsichtlich der ADHS-Problematik
- II. 1.15 der ADHS-Teufelskreis
- II. 2 Elterntraining - ein pädagogisch bedeutsames Hilfsangebot
- II. 2.1 Elterntraining exemplarisch
- II. 2.2 Ein weiteres Elterntraining
- II. 2.3 Triple-P Elterntraining
- II. 3 Tipps für Eltern
- II. 4 Familientherapie
- II. 4.1 Therapieprogramm für Kinder mit hyperkinetischem und oppositionellem Problemverhalten: (Thop)
- II. 4.2 Abgrenzung zwischen Beratung und Psychotherapie
- III. Interventionen in der Schule hinsichtlich der ADHS-Problematik
- III. 1 Konstellation Schule und Jugendhilfe
- III. 2 Chance für die Schulsozialarbeit
- III. 2.1 Modelle der Schulsozialarbeit
- III. 2.2 Ein systemischer Ansatz von Schulsozialarbeit
- III. 2.3 Ziele von Schulsozialarbeit
- III. 2.4 Methoden und Tätigkeitsfelder der Schulsozialarbeit
- III. 3 Theorie von Hans Biegert (2001)
- III. 3.1 Konsequenzen für die Schulpädagogik
- III. 3.2 Umsicht und Übersicht behalten ist das Stichwort
- III. 4 Weitere vertiefende Aspekte
- III. 5 Integrationsklassen
- IV. Neue Behandlungsansätze
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Problematik von ADHS bei Kindern und Jugendlichen und beleuchtet die Rolle der Sozialen Arbeit in der Intervention. Ziel ist es, Möglichkeiten der Unterstützung von betroffenen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien im Elternhaus und in der Schule aufzuzeigen.
- Definition und Erscheinungsformen von ADHS
- Ursachen und Komorbiditäten von ADHS
- Multimodale Therapieansätze bei ADHS
- Interventionen der Sozialen Arbeit im familiären und schulischen Kontext
- Beratung und Elterntraining als unterstützende Maßnahmen
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den aktuellen gesellschaftlichen Kontext von Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen und führt in die Thematik der Diplomarbeit ein. Sie verweist auf die steigende Anzahl an Verhaltensauffälligkeiten und die zunehmende Überforderung von Eltern und Lehrern. Der Bezug zum eigenen Hochschulpraktikum in der Kinder- und Jugendpsychiatrie wird hergestellt, um die Motivation für die Arbeit zu verdeutlichen. Die Methode der Sozialen Arbeit (Beratung) in den Lebensbereichen Elternhaus und Schule wird als Fokus der Arbeit genannt, ebenso wie die Einbeziehung von Elementen der empirischen Sozialforschung.
I. 6 Ursachen: Dieses Kapitel befasst sich ausführlich mit den verschiedenen Ursachen von ADHS. Es werden neurobiologische, genetische, strukturelle, allergische, psychosoziale, neurophysiologische und neuropsychologische Aspekte beleuchtet. Die Jäger-Hypothese wird ebenfalls vorgestellt. Der Abschnitt verdeutlicht die Komplexität der Ursachen, die oft in einem Zusammenspiel verschiedener Faktoren liegen und nicht auf eine einzelne Ursache zurückgeführt werden können. Die Ausführungen bilden eine wichtige Grundlage für das Verständnis der Erkrankung und der Notwendigkeit multimodaler Therapieansätze.
I. 9 Die multimodale Therapie von Kindern und Jugendlichen mit hyperkinetischen Störungen: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Therapieformen bei ADHS, wobei der Schwerpunkt auf der multimodalen Therapie liegt, die pharmakologische und psychotherapeutische Ansätze kombiniert. Die einzelnen Komponenten der multimodalen Therapie werden erläutert und deren Bedeutung für einen ganzheitlichen Behandlungsansatz hervorgehoben. Der Abschnitt betont die Notwendigkeit einer individuellen Therapieplanung, die auf die spezifischen Bedürfnisse des Kindes abgestimmt ist.
II. Standortbestimmung des Sozialarbeiters/Sozialpädagogen in der Behandlung psychischer Störungen: Dieses Kapitel fokussiert die Rolle des Sozialarbeiters in der Behandlung von Kindern mit ADHS. Es beschreibt den Beratungsansatz, die Prinzipien der Beratung, die verschiedenen Fachrichtungen und Anlässe für Familienberatung und schließlich die Ziele und Methoden der Beratung im Umgang mit der ADHS Problematik. Der „ADHS-Teufelskreis“ wird erläutert und die Bedeutung von professioneller Beratung für die Familien hervorgehoben.
II. 2 Elterntraining - ein pädagogisch bedeutsames Hilfsangebot: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Elterntraining als wichtigen Bestandteil der ADHS-Therapie. Es beschreibt unterschiedliche Elterntrainingsprogramme und deren jeweilige Herangehensweise. Der Abschnitt betont die Rolle der Eltern als wichtigste Bezugspersonen und die Bedeutung ihrer Unterstützung im Umgang mit der Erkrankung ihres Kindes. Es werden konkrete Beispiele und Methoden des Elterntrainings vorgestellt.
III. Interventionen in der Schule hinsichtlich der ADHS-Problematik: Dieses Kapitel beschreibt Interventionen in der Schule, insbesondere die Rolle der Schulsozialarbeit. Es thematisiert die Kooperation von Schule und Jugendhilfe und beschreibt verschiedene Modelle und Ziele der Schulsozialarbeit. Ein systemischer Ansatz wird vorgestellt, sowie die Methoden und Tätigkeitsfelder der Schulsozialarbeit im Kontext von ADHS. Die Bedeutung der Schulsozialarbeit für die Inklusion von Kindern mit ADHS wird hervorgehoben.
Schlüsselwörter
ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, multimodale Therapie, Elterntraining, Familienberatung, Schulsozialarbeit, Intervention, Komorbidität, Sozialarbeit, Psychotherapie, Pharmakotherapie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: ADHS bei Kindern und Jugendlichen – Interventionen der Sozialen Arbeit
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Problematik von ADHS bei Kindern und Jugendlichen und beleuchtet insbesondere die Rolle der Sozialen Arbeit in der Intervention. Der Fokus liegt auf der Unterstützung betroffener Kinder, Jugendlicher und ihrer Familien im Elternhaus und in der Schule.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Erscheinungsformen von ADHS, Ursachen und Komorbiditäten, multimodale Therapieansätze, Interventionen der Sozialen Arbeit im familiären und schulischen Kontext, Beratung und Elterntraining als unterstützende Maßnahmen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Hauptteile: Einleitung mit Definitionen, Ursachen und Klassifizierung von ADHS; Standortbestimmung des Sozialarbeiters/Sozialpädagogen mit Fokus auf Beratung, Elterntraining und Familientherapie; Interventionen in der Schule, insbesondere die Rolle der Schulsozialarbeit; und schließlich neue Behandlungsansätze. Jedes Kapitel enthält detaillierte Unterabschnitte, wie im Inhaltsverzeichnis ersichtlich.
Welche Ursachen von ADHS werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet eine Vielzahl von Ursachen für ADHS, darunter neurobiologische, genetische, strukturelle, allergische, psychosoziale, neurophysiologische und neuropsychologische Aspekte. Die Jäger-Hypothese wird ebenfalls diskutiert. Die Arbeit betont die Komplexität der Ursachen und das Zusammenspiel verschiedener Faktoren.
Welche Therapieansätze werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt verschiedene Therapieformen, mit Schwerpunkt auf der multimodalen Therapie, die pharmakologische und psychotherapeutische Ansätze kombiniert. Zusätzliche Therapieformen wie therapeutisches Reiten, Trommeln und Schwimmen werden ebenfalls erwähnt. Die Notwendigkeit einer individuellen Therapieplanung wird hervorgehoben.
Welche Rolle spielt die Soziale Arbeit?
Die Soziale Arbeit spielt eine zentrale Rolle in der Unterstützung von Familien mit ADHS-Kindern. Die Arbeit beschreibt den Beratungsansatz, die Prinzipien der Beratung, verschiedene Fachrichtungen und Anlässe für Familienberatung. Sie betont die Bedeutung von Elterntraining und Familientherapie sowie die Zusammenarbeit mit Schulen und Jugendhilfe.
Was ist Elterntraining und warum ist es wichtig?
Elterntraining wird als wichtiger Bestandteil der ADHS-Therapie beschrieben. Die Arbeit stellt verschiedene Elterntrainingsprogramme vor und betont die Rolle der Eltern als wichtigste Bezugspersonen und die Bedeutung ihrer Unterstützung im Umgang mit der Erkrankung ihres Kindes.
Welche Rolle spielt die Schule bei ADHS?
Die Arbeit beschreibt Interventionen in der Schule, insbesondere die Rolle der Schulsozialarbeit. Sie thematisiert die Kooperation von Schule und Jugendhilfe, verschiedene Modelle und Ziele der Schulsozialarbeit, und einen systemischen Ansatz. Die Bedeutung der Schulsozialarbeit für die Inklusion von Kindern mit ADHS wird hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, multimodale Therapie, Elterntraining, Familienberatung, Schulsozialarbeit, Intervention, Komorbidität, Soziale Arbeit, Psychotherapie, Pharmakotherapie.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Kapiteln?
Das detaillierte Inhaltsverzeichnis im Dokument bietet einen umfassenden Überblick über alle Kapitel und Unterkapitel der Arbeit und deren Inhalte.
- Quote paper
- Hagen Gomille (Author), 2006, Hilfe das Kind dreht durch - Interventionen bei ADHS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151173