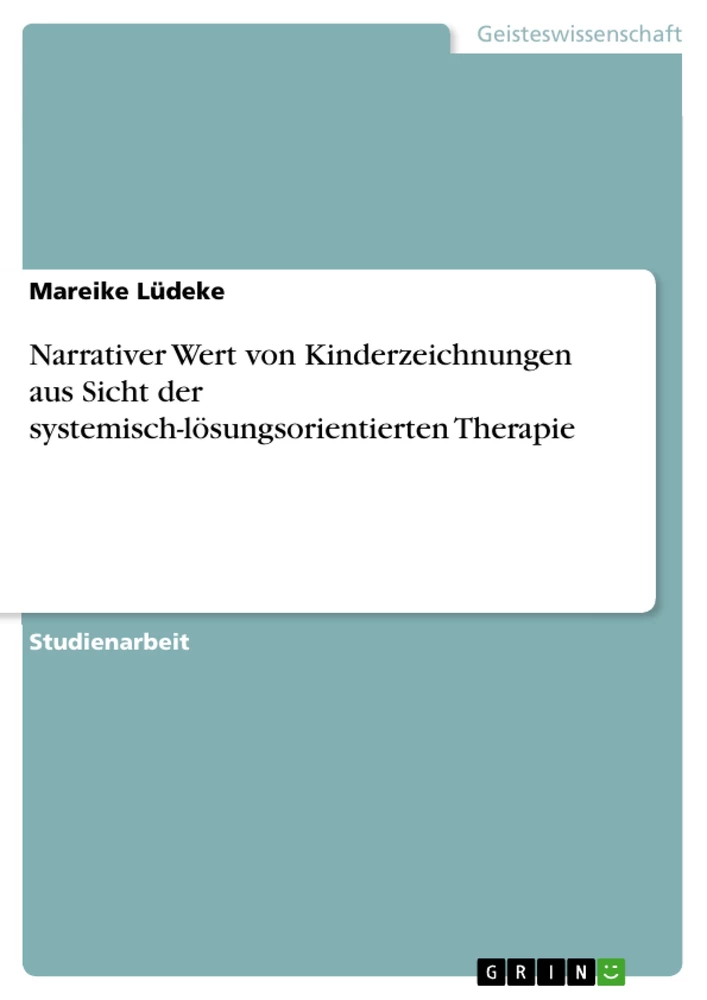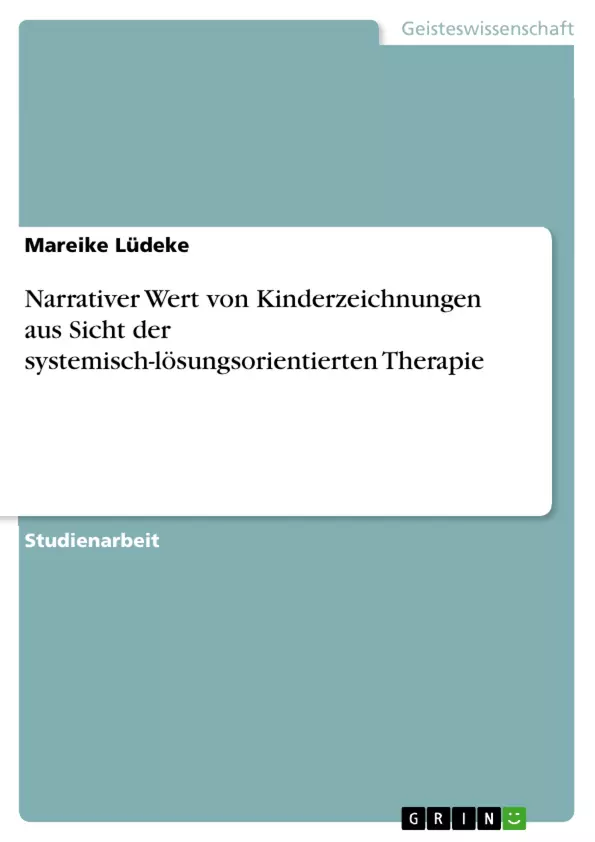Die narrativ-orientierte Kunsttherapie entnimmt ihre Therapieansätze aus der Systemtheorie, d.h. sie wirft ihren Blick auch auf die Bezüge, in denen der Klient sich befindet und stellt nicht nur den Klienten, sondern das gesamte System Familie bzw. die Schulklasse etc. in den Vordergrund der Therapie.
Die Aufgabe des Therapeuten besteht darin, festgefahrene Muster, bestimmte Kommunikationsformen und Verhaltensweisen innerhalb eines Systems durch Verstörungen aufzubrechen, um Veränderungen herbeizuführen. Verstörungen werden verbal durch gezielte Fragetypen der systemischen Therapie herbeigerufen, durch Gesprächsübungen und durch künstlerisch- praktische Übungen.
In der Arbeit werden zunächst die narrativen Therapieansätze aus der systemisch-lösungsorientierten Therapie beschrieben. Ich gehe dabei auf unterschiedliche Aspekte systemischen Denkens ein und beziehe mich bei den allgemeinen Informationen über die Systemtheorie auf jeden Altersbereich. Die Literatur von Wirtz gibt Informationen über die Familie als System, über Lösungsorientierung, über die Wechselwirkungen innerhalb der Systeme und über das Gleichgewicht, das jedes System anstrebt. Die allgemeinen Informationen über diese Aspekte systemischen Denkens sind die Grundlage für die Therapie mit Erwachsenen als auch mit Kindern und Jugendlichen. In der Praxis müssen dann Aussagen altersgerecht formuliert werden.
Weitere Grundlagen der systemisch- lösungsorientierten Therapie sind der Konstruktivismus und die speziellen Fragetypen der systemischen Therapie nach Tomm, auf die in der Hausarbeit eingegangen wird.
In der narrativ orientierten Kunsttherapie haben verbale Erzählungen als auch Aussagen über die Bildsprache einen sehr hohen Stellenwert. Demnach wird im nächsten Kapitel auf das Thema „Erzählung und Erzählen“ eingegangen. Der Leser erhält hierbei Definitionen von dem Begriff „Erzählen“ und erfährt den Sinn, den das Erzählen, einer Person geben kann.
Kapitel vier beschreibt dann den narrativen Wert einer Kinderzeichnung nach Widlöcher und liefert praktische Beispiele der Interpretation eines Kinderbildes.
Im letzten Kapitel der Hausarbeit werden die zwei unterschiedlichen Methoden „Biografische Erkundungen“ und „Linienland“ der narrativ- therapeutischen Kunsttherapie aufgeführt. Bei der ersten Übung stehen hierbei verbale Erzählungen im Vordergrund. Bei der zweiten Übung liegt der Schwerpunkt auf der künstlerisch-praktischen Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Narrative Therapieansätze aus der systemisch-lösungsorientierten Therapie
- 2.1 Familie als System
- 2.2 Homeostase
- 2.3 Wechselwirkungen
- 2.4 Konstruktivismus
- 2.5 Lösungsorientierung
- 2.6 Vier Fragetypen in der systemischen Therapie [nach Tomm 1994]
- 3. Die Erzählung und das Erzählen
- 4. Der narrative Wert in Kinderzeichnungen nach Widlöcher
- 5. Methoden der narrativ-therapeutischen Kunsttherapie
- 5.1 Gesprächsübung: Biografische Erkundungen
- 5.2 Künstlerisch-praktische Übung: „Linienland“
- 6. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht den narrativen Wert von Kinderzeichnungen im Kontext der systemisch-lösungsorientierten Therapie. Ziel ist es, die Anwendung narrativer Therapieansätze in der Kunsttherapie zu beleuchten und praktische Methoden vorzustellen. Die Arbeit verbindet theoretische Grundlagen der Systemtheorie mit der praktischen Anwendung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
- Narrative Therapieansätze in der systemisch-lösungsorientierten Therapie
- Der narrative Wert von Kinderzeichnungen
- Lösungsorientierung in der Kunsttherapie
- Methoden der narrativ-therapeutischen Kunsttherapie
- Systemisches Denken in der therapeutischen Praxis
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der narrativ-orientierten Kunsttherapie ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem narrativen Wert von Kinderzeichnungen im Kontext der systemisch-lösungsorientierten Therapie. Die „Wunderfrage“ wird als Beispiel für lösungsorientiertes Denken eingeführt und der Fokus auf die Lösungsfindung statt auf die Problematik selbst hervorgehoben. Die Struktur der Hausarbeit und die verwendeten methodischen Ansätze werden kurz umrissen.
2. Narrative Therapieansätze aus der systemisch-lösungsorientierten Therapie: Dieses Kapitel beschreibt die theoretischen Grundlagen der systemisch-lösungsorientierten Therapie. Es werden zentrale Konzepte wie die Familie als System, Homeostase, Wechselwirkungen innerhalb des Systems, Konstruktivismus und Lösungsorientierung erläutert. Die Bedeutung der gezielten Fragestellungen nach Tomm (1994) zur Herbeiführung von Veränderungen wird betont. Das Kapitel unterstreicht, dass der Fokus nicht auf dem Individuum allein, sondern auf dem gesamten System und dessen Interaktionen liegt.
3. Die Erzählung und das Erzählen: Dieses Kapitel befasst sich mit der Bedeutung von Erzählungen und dem Akt des Erzählens selbst. Es liefert Definitionen des Begriffs „Erzählen“ und untersucht den Sinn und die Funktion von Erzählungen für den Einzelnen. Die Kapitel legt den Grundstein für die Interpretation von Kinderzeichnungen als narrative Artefakte.
4. Der narrative Wert in Kinderzeichnungen nach Widlöcher: Dieses Kapitel widmet sich der Interpretation von Kinderzeichnungen nach Widlöcher. Es präsentiert praktische Beispiele und erläutert die methodischen Ansätze zur Entdeckung des narrativen Gehalts in den Bildern. Es verdeutlicht, wie Kinderzeichnungen als Ausdruck innerer Zustände und Erfahrungen interpretiert werden können und wie diese Interpretationen in den therapeutischen Prozess integriert werden können.
5. Methoden der narrativ-therapeutischen Kunsttherapie: Das Kapitel stellt zwei konkrete Methoden der narrativ-therapeutischen Kunsttherapie vor: „Biografische Erkundungen“ mit Schwerpunkt auf verbalen Erzählungen und „Linienland“ mit Fokus auf künstlerisch-praktische Arbeit. Es zeigt die Anwendung der systemischen Therapieansätze in der praktischen Arbeit und veranschaulicht, wie durch gezielte Übungen festgefahrene Muster aufgebrochen und Veränderungen angeregt werden können.
Schlüsselwörter
Systemisch-lösungsorientierte Therapie, Narrative Kunsttherapie, Kinderzeichnungen, Bildinterpretation, Lösungsorientierung, Systemtheorie, Kommunikation, Verhaltensmuster, Erzählung, Konstruktivismus.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Narrativer Wert von Kinderzeichnungen in der systemisch-lösungsorientierten Kunsttherapie
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht den narrativen Wert von Kinderzeichnungen im Kontext der systemisch-lösungsorientierten Therapie. Das Ziel ist es, die Anwendung narrativer Therapieansätze in der Kunsttherapie zu beleuchten und praktische Methoden vorzustellen. Die Arbeit verbindet theoretische Grundlagen der Systemtheorie mit der praktischen Anwendung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt narrative Therapieansätze in der systemisch-lösungsorientierten Therapie, den narrativen Wert von Kinderzeichnungen, Lösungsorientierung in der Kunsttherapie, Methoden der narrativ-therapeutischen Kunsttherapie und systemisches Denken in der therapeutischen Praxis.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung, Narrative Therapieansätze aus der systemisch-lösungsorientierten Therapie, Die Erzählung und das Erzählen, Der narrative Wert in Kinderzeichnungen nach Widlöcher, Methoden der narrativ-therapeutischen Kunsttherapie und Schlussbemerkung.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung führt in die Thematik der narrativ-orientierten Kunsttherapie ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach dem narrativen Wert von Kinderzeichnungen im Kontext der systemisch-lösungsorientierten Therapie. Die „Wunderfrage“ wird als Beispiel für lösungsorientiertes Denken eingeführt. Die Struktur der Hausarbeit und die verwendeten methodischen Ansätze werden kurz umrissen.
Welche theoretischen Grundlagen werden im zweiten Kapitel behandelt?
Kapitel 2 beschreibt die theoretischen Grundlagen der systemisch-lösungsorientierten Therapie. Zentrale Konzepte wie die Familie als System, Homeostase, Wechselwirkungen innerhalb des Systems, Konstruktivismus und Lösungsorientierung werden erläutert. Die Bedeutung der gezielten Fragestellungen nach Tomm (1994) wird betont. Der Fokus liegt auf dem gesamten System und dessen Interaktionen.
Worum geht es im Kapitel über Erzählung und Erzählen?
Kapitel 3 befasst sich mit der Bedeutung von Erzählungen und dem Akt des Erzählens. Es liefert Definitionen des Begriffs „Erzählen“ und untersucht den Sinn und die Funktion von Erzählungen für den Einzelnen. Es legt den Grundstein für die Interpretation von Kinderzeichnungen als narrative Artefakte.
Wie werden Kinderzeichnungen nach Widlöcher interpretiert?
Kapitel 4 widmet sich der Interpretation von Kinderzeichnungen nach Widlöcher. Es präsentiert praktische Beispiele und erläutert die methodischen Ansätze zur Entdeckung des narrativen Gehalts in den Bildern. Es verdeutlicht, wie Kinderzeichnungen als Ausdruck innerer Zustände und Erfahrungen interpretiert werden können und wie diese Interpretationen in den therapeutischen Prozess integriert werden können.
Welche Methoden der narrativ-therapeutischen Kunsttherapie werden vorgestellt?
Kapitel 5 stellt zwei konkrete Methoden vor: „Biografische Erkundungen“ (verbale Erzählungen) und „Linienland“ (künstlerisch-praktische Arbeit). Es zeigt die Anwendung der systemischen Therapieansätze in der praktischen Arbeit und veranschaulicht, wie durch gezielte Übungen festgefahrene Muster aufgebrochen und Veränderungen angeregt werden können.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Systemisch-lösungsorientierte Therapie, Narrative Kunsttherapie, Kinderzeichnungen, Bildinterpretation, Lösungsorientierung, Systemtheorie, Kommunikation, Verhaltensmuster, Erzählung, Konstruktivismus.
- Arbeit zitieren
- Mareike Lüdeke (Autor:in), 2008, Narrativer Wert von Kinderzeichnungen aus Sicht der systemisch-lösungsorientierten Therapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151194