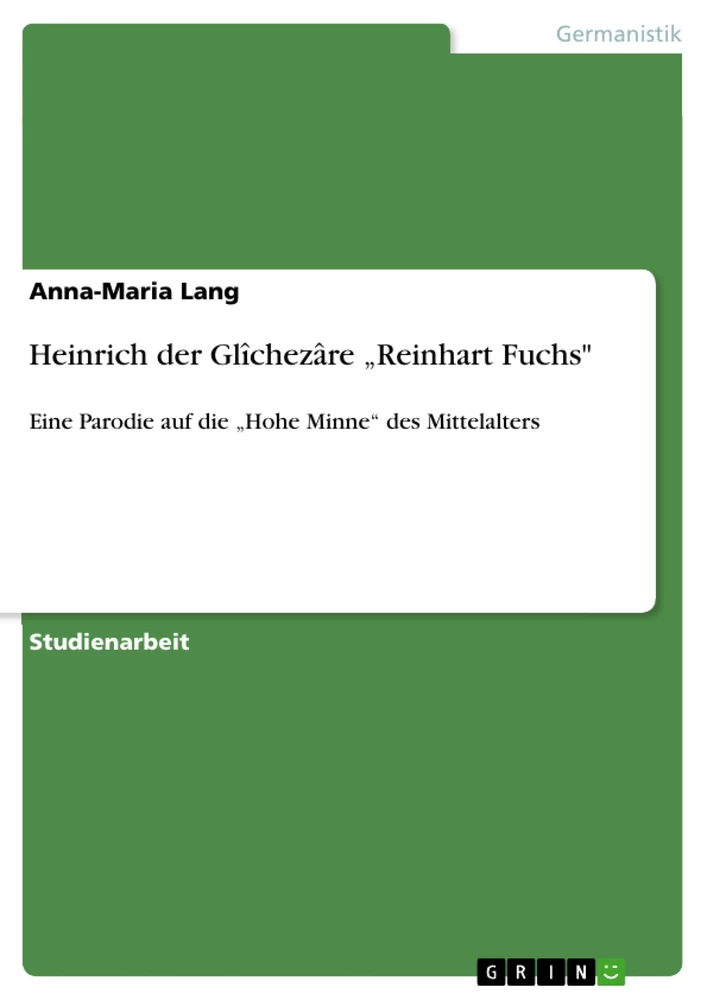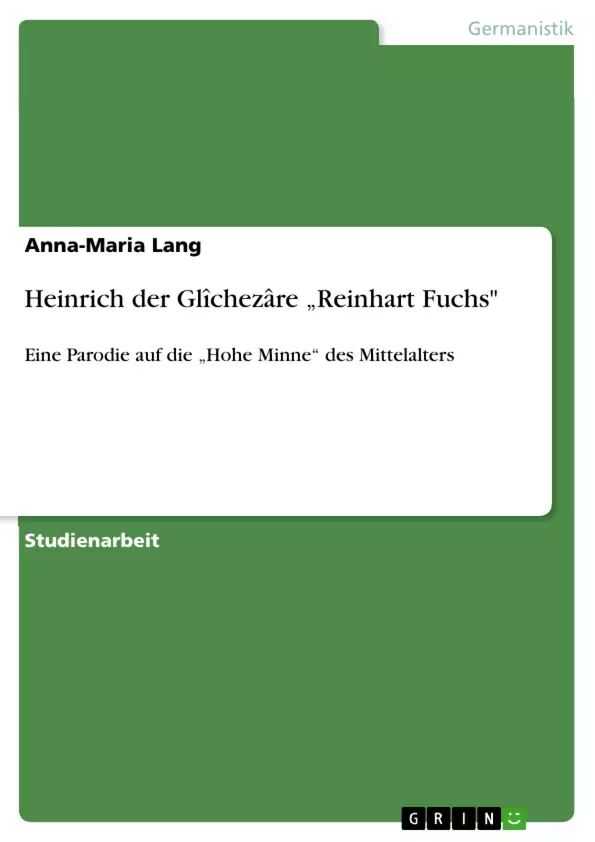Der Fuchs in der Literatur - dargestellt als listig, verschlagen und nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Er ist hinterhältig, lügt, betrügt und kümmert sich nicht um die Konsequenzen, die sein Handeln für andere Lebewesen hat.
Auch im Gedicht „Reinhart Fuchs“ von Heinrich dem Glîchezâren wird der Fuchs auf diese Weise präsentiert.
Besonders interessant wird in dem Werk die Minnewerbung des Fuchses Reinhart um die Wölfin Hersant dargestellt. Wie wirbt Reinhart um die Angebetete? Wie reagiert Hersant? Und wie gestaltet sich das Verhältnis zwischen den beiden?
Anhand jener Fragestellungen soll das Gedicht „Reinhart Fuchs“ in dieser Facharbeit untersucht werden. Berücksichtigt werden soll weiterhin die Idealvorstellung von Minnewerbung zur Entstehungszeit dieses Werkes, um deutlich zu machen, dass der Autor in seinem Gedicht eine Parodie schuf, die sich von der üblichen Minnelyrik abhebt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Heinrich der Glîchezâre und sein Werk
- Inhaltsangabe: „Reinhart Fuchs“
- Definition von „Parodie“
- Das Ideal der „Hohen Minne“
- Der höfische „Frauendienst“
- Die Parodie der „Hohen Minne“ im „Reinhart Fuchs“
- Die Minnewerbung des Fuchses um Hersant
- Die Folgen der „Minnewerbung“ Reinharts
- Die Minneparodie
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Facharbeit analysiert das Gedicht „Reinhart Fuchs“ von Heinrich dem Glîchezâren, wobei der Fokus auf der Parodie der „Hohen Minne“ im Werk liegt. Die Arbeit untersucht die Minnewerbung des Fuchses Reinhart um die Wölfin Hersant und analysiert, wie diese Darstellung von der traditionellen Minnelyrik abweicht. Dabei wird die Idealvorstellung von Minnewerbung zur Entstehungszeit des Werkes berücksichtigt, um die satirische Intention des Autors deutlich zu machen.
- Die Darstellung des Fuchses Reinhart als Gegenbild zum idealisierten Minnesänger
- Die Parodie der höfischen Minnewerbung durch Reinharts Verhalten gegenüber Hersant
- Die satirische Kritik an gesellschaftlichen Normen und Konventionen der Zeit
- Die Verwendung von Sprache und Stilmitteln zur Hervorhebung der Parodie
- Die Bedeutung des Werkes im Kontext der mittelalterlichen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Fuchs in der Literatur vor und führt das Thema der Minnewerbung im „Reinhart Fuchs“ ein. Kapitel 2 gibt Informationen über den Autor Heinrich den Glîchezâren und sein Werk. Kapitel 3 bietet eine Zusammenfassung der Handlung des Gedichts „Reinhart Fuchs“. In Kapitel 4 wird der Begriff „Parodie“ definiert und die satirische Absicht des Autors erläutert. Kapitel 5 befasst sich mit dem Ideal der „Hohen Minne“ und den typischen Merkmalen dieser Form der Liebeslyrik. Kapitel 6 analysiert die Parodie der „Hohen Minne“ im „Reinhart Fuchs“ und untersucht die Minnewerbung des Fuchses Reinhart. Die Arbeit schließt mit einem Fazit, das die wichtigsten Erkenntnisse zusammenfasst.
Schlüsselwörter
Die Facharbeit beschäftigt sich mit den Themen „Reinhart Fuchs“, „Heinrich der Glîchezâre“, „Parodie“, „Hohe Minne“, „Minnewerbung“, „Mittelalterliche Literatur“, „Satire“, „Gesellschaftliche Normen“, „Konventionen“, „Sprache“, „Stilmittel“.
Häufig gestellte Fragen zu „Reinhart Fuchs“
Wer schrieb das Gedicht „Reinhart Fuchs“?
Das Werk wurde von Heinrich dem Glîchezâren verfasst, einem oberdeutschen Dichter des späten 12. Jahrhunderts.
Was ist das Besondere an der Figur des Fuchses Reinhart?
Reinhart wird als listig, verschlagen und skrupellos dargestellt. Er nutzt seinen Verstand, um stärkere Tiere (wie den Wolf oder den Löwen) zu betrügen und seinen eigenen Vorteil zu suchen.
Wie parodiert das Werk die „Hohe Minne“?
Anstatt die Frau (Wölfin Hersant) verehrungsvoll und distanziert zu umwerben, wie es das höfische Ideal vorschreibt, agiert Reinhart triebgesteuert und hinterhältig. Die „Minne“ wird hier ins Lächerliche gezogen.
Was ist das Ziel einer literarischen Parodie im Mittelalter?
Sie dient oft der Kritik an starren gesellschaftlichen Normen und ritterlichen Idealen, indem sie diese durch Übersteigerung oder Umkehrung verspottet.
Was bedeutet der Beiname „Glîchezâre“?
Der Name bedeutet übersetzt etwa „der Gleisner“ oder „der Heuchler“. Es ist unklar, ob dies ein echter Beiname des Autors war oder ein Pseudonym in Anlehnung an seine Figuren.
- Arbeit zitieren
- Anna-Maria Lang (Autor:in), 2006, Heinrich der Glîchezâre „Reinhart Fuchs", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151256