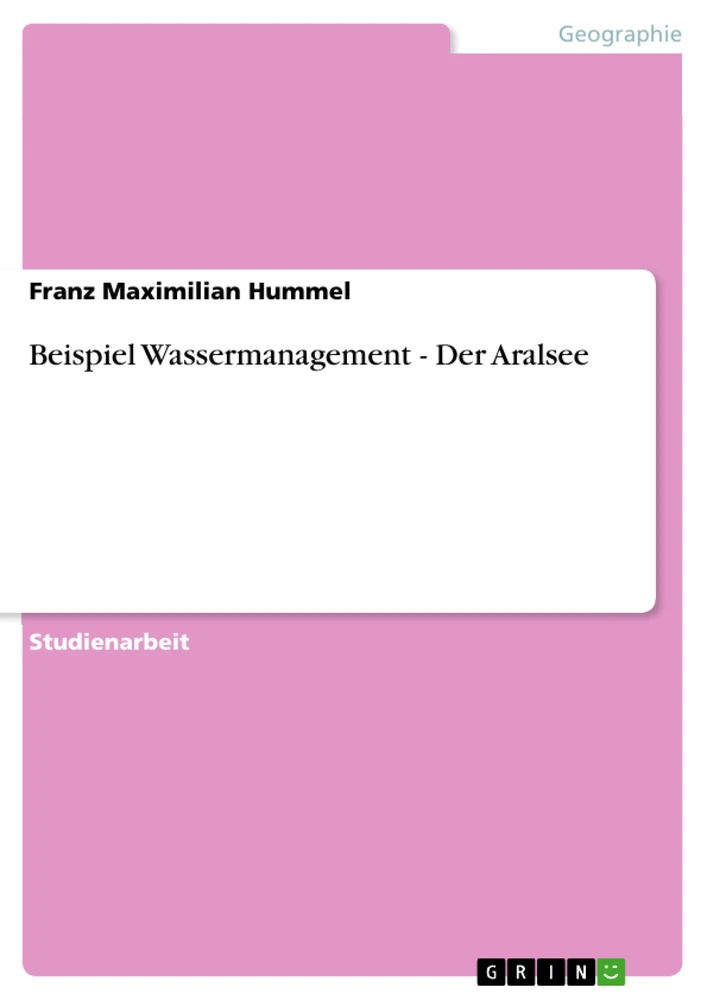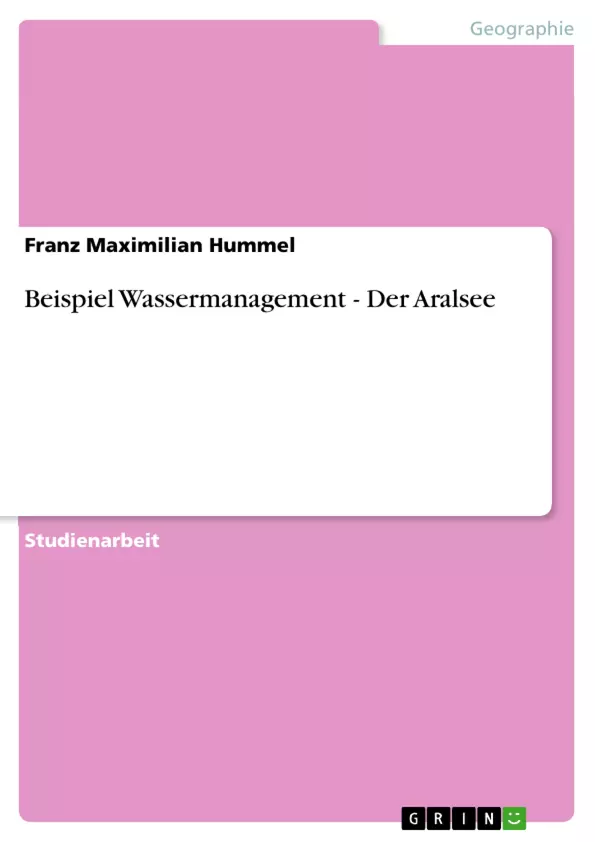Der Aralsee war 1960 mit einer Ausdehnung von 66.000 km² der viertgrößte See auf der Erde. Bewässerungsprojekte, die mit der Entnahme von Wasser aus den Zuflüssen des Sees bewerkstelligt wurden, stellten einen großen Eingriff in seinen Wasserhaushalt dar. Dies ließ den Aralsee zwischen 1960 und 2007 auf etwa ein Viertel seiner einstigen Fläche zurückgehen. Der Salzgehalt im See erhöhte sich um das Vierfache. Das Ökosystem Aralsee, dass sich einst als Erholungsgebiet Zentralasiens mit seiner Vielzahl an Feuchtbiotopen, Tierarten und reichen Fischbeständen auszeichnete, wurde dadurch immer mehr zerstört. Zudem brachten Rückkopplungseffekte, die sich aufgrund der Veränderungen des Sees und der intensiven großflächigen Bewässerung einstellten, weitere Probleme mit sich.
Im Rahmen dieser Hauptseminararbeit wird die Wirkungskette aufzeigt, die zu den oben beschriebenen Problemen in der Aralseeregion geführt haben. Ausgehend von den natürlichen Gegebenheiten des Aralseebeckens (Aral Sea Basin ASB), wird im Folgenden auf die Nutzung dieses Großraums durch die dort lebenden Menschen, sowie auf die Folgen für den Aralsee und die Region eingegangen. Am Ende zeigt diese Arbeit Handlungsmöglichkeiten auf, wie man im Sinne eines nachhaltigen Wassermanagements den Problemen im ASB begegnen könnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Der Naturraum des Aralseebeckens
- 1.1 Lage und Grenzen
- 1.2 Relief
- 1.3 Klima
- 1.4 Vegetationszonen und Böden
- 1.5 Die Wasserressourcen
- 1.6 Der Aralsee
- 2. Der Mensch im Aralseebecken
- 2.1 Landnutzung
- 2.2 Der Rückgang des Aralsees
- 2.3 Die zunehmende Salinität im Aralsee
- 2.4 Rückkopplungseffekte
- 3. Wassermanagement als ein Weg aus der Krise?
- 3.1 Wasserbeschaffungsmanagement (Water Supply Management)
- 3.2 Wasserbedarfsmanagement (Water Demand Management)
- 3.3 Was bringt die Zukunft?
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Ursachen und Folgen der ökologischen Krise des Aralsees, einem einst bedeutenden Binnenmeer in Zentralasien. Sie untersucht den Einfluss menschlicher Aktivitäten auf das Ökosystem Aralsee und die Auswirkungen der Wasserentnahme für Bewässerungsprojekte auf den Wasserhaushalt des Sees.
- Naturräumliche Gegebenheiten des Aralseebeckens
- Menschliche Nutzung des Aralseebeckens und ihre Folgen
- Rückgang des Aralsees und zunehmende Salinität
- Rückkopplungseffekte und die Bedeutung eines nachhaltigen Wassermanagements
- Handlungsmöglichkeiten zur Bewältigung der Krise
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die geographische Lage, das Relief, das Klima, die Vegetation und die Wasserressourcen des Aralseebeckens. Es gibt einen Überblick über die natürlichen Gegebenheiten der Region und stellt den Aralsee in seinen geographischen Kontext.
Kapitel 2 untersucht die menschliche Nutzung des Aralseebeckens, insbesondere die Landnutzung und die Auswirkungen der Wasserentnahme für Bewässerungsprojekte auf den Aralsee. Es beleuchtet den Rückgang des Sees und die zunehmende Salinität sowie die sich daraus ergebenden Rückkopplungseffekte.
Kapitel 3 widmet sich verschiedenen Ansätzen des Wassermanagements als potentielle Wege aus der Krise. Es diskutiert Wasserbeschaffungs- und Wasserbedarfsmanagement und blickt auf zukünftige Herausforderungen und Perspektiven.
Schlüsselwörter
Aralsee, Zentralasien, Wassermanagement, nachhaltige Entwicklung, Ökosystem, Bewässerung, Rückkopplungseffekte, Salinität, Landnutzung, Wasserressourcen, Umweltverschmutzung.
- Citation du texte
- Franz Maximilian Hummel (Auteur), 2009, Beispiel Wassermanagement - Der Aralsee, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151331