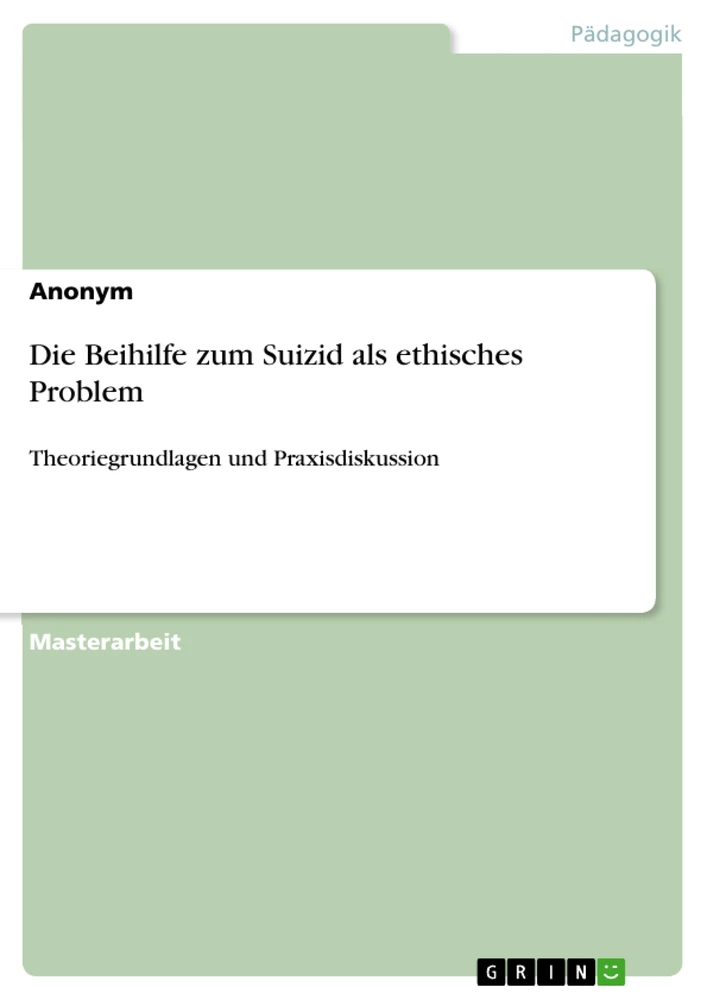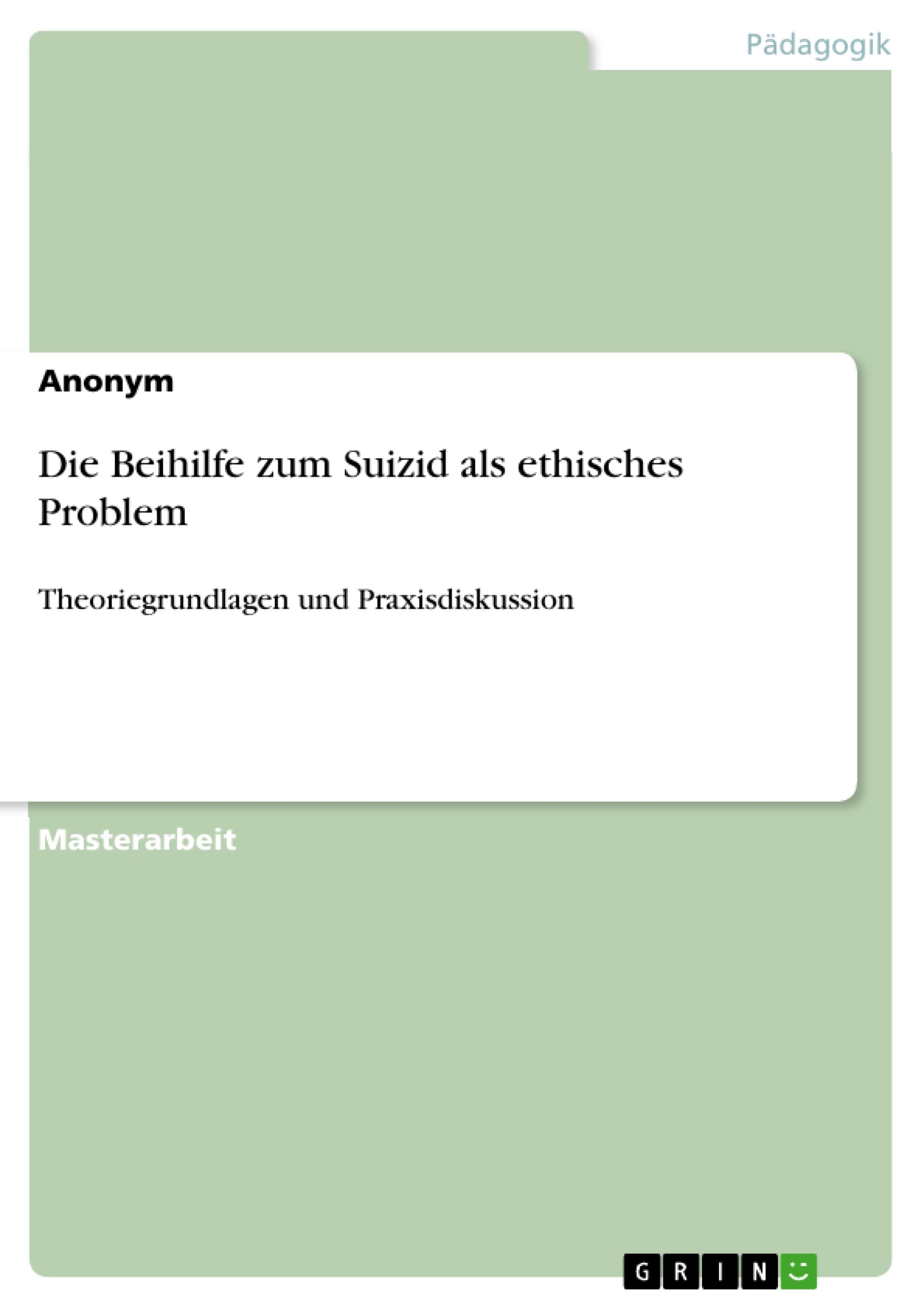Der Wunsch eines Menschen, selbstbestimmt zu sterben, ist weit umstritten. Dies liegt insbesondere der kirchlichen Verdammung des Suizids zugrunde. Da die eng miteinander verbundenen Machtbereiche der Kirche und des Staates während des Mittelalters zusammenflossen, führte dies in vielen Ländern Europas dazu, dass die kirchliche Verurteilung von Suizid, in Form von Strafen, in staatliche Gesetze integriert wurde.
Darüber hinaus wird das Thema Suizid bis heute weitgehend tabuisiert und erschwert zusätzlich, aufgrund von Scham der Betroffenen und Angehörigen, den Umgang mit solch einem essenziellen Thema. Dennoch wird durch die Intervention der Palliativ- und Hospizbewegung ein signifikanter Beitrag geleistet, sodass Sterben und Tod nicht mehr in gleichem Maße aus dem Leben verbannt werden. Allerdings scheint dies in einigen Fällen ein unzureichendes Mittel zu sein, um das Leiden desjenigen zu lindern, der den Wunsch hat, sein Leben vorzeitig und in Würde zu beenden, ohne auf die oben genannten ‚grausamen Mittel‘ zurückgreifen zu müssen.
Aktuelle Debatten in Politik und Kirche in Deutschland berufen sich auf Prinzipien der Menschenwürde und Autonomie, die, trotz der Stärkung des individuellen Selbstbestimmungsrechts, zu (noch) keinem befriedigenden Ergebnis führen, sondern zu einer rechtlichen Grauzone.
Auch wenn der Wunsch oder der Gedanke eines Suizidenten, das eigene Leben durch den bewussten Eingriff vorzeitig zu beenden, oftmals aus einem Akt der Verzweiflung, wie beispielsweise durch eine Krankheit, resultiert, gibt es äußerste ‚nichtkrankhafte‘ Ausnahmefälle, die in dieser Ausarbeitung aus der ethischen Perspektive von Wilhelm Kamlah beleuchtet werden.
Aber auch die kirchliche Perspektive steht hier im Fokus. Der ‚Hass‘ des Lebens bezieht sich nicht auf einen Selbsthass, sondern darauf, sich keine allzu großen Gedanken über das eigene Leben zu machen und Christus über die eigenen Interessen zu stellen. Dabei ist das ‚Loslassen-können‘ ein wesentliches Stichwort, welches in dieser Ausarbeitung eine essenzielle Rolle einnimmt. Doch wer entscheidet in einer zunehmend pluralistischen Gesellschaft, in welcher der Glaube immer mehr in den Hintergrund rückt, welches Leben lebenswert ist?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Suizid
- 2.1. Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen
- 2.2. Suizidbeihilfe oder Sterbehilfe?
- 2.2.1. Formen der Sterbehilfe
- 2.2.2. Suizidbeihilfe – Assistierter Suizid
- 2.3. Parlamentarische Debatte versus kirchliche Diskussion
- 2.3.1. Politische Entwicklungen zum assistierten Suizid
- 2.3.2. Positionierung der Kirche
- 3. Darstellung der Konzeption von Wilhelm Kamlah
- 3.1. Philosophische Anthropologie als ‚dritter Weg‘
- 3.1.1. Der Mensch als bedürftiges Wesen
- 3.1.1.1. Widerfahrnis – Handlung, Bedürftigkeit – Begehren
- 3.1.1.2. Zuwendung auf den Mitmenschen
- 3.1.2. Der Tod als pures Widerfahrnis
- 3.1.1. Der Mensch als bedürftiges Wesen
- 3.2. Ethik
- 3.2.1. Normative Ethik – Wie sollen wir leben?
- 3.2.1.1. (Praktische) Grundnorm
- 3.2.1.2. Institutionelle Pflichten und Normen
- 3.2.1.3. Das ‚Wenn-Dann-Gefüge‘
- 3.2.2. Eudämonistische Ethik: Die ars vitae - Wie können wir (gut) leben?
- 3.2.2.1. ‚Am Leben sein‘ versus ‚Leben können‘
- 3.2.2.2. Grunderfahrung – Grundeinsicht – Paradoxer Ratschlag
- 3.2.2.3. Lebensbedingungen und vitale Güter
- 3.2.1. Normative Ethik – Wie sollen wir leben?
- 3.3. Der sanfte Freitod – Bedingungen für die ethische Qualität
- 3.1. Philosophische Anthropologie als ‚dritter Weg‘
- 4. Darstellung der kirchlichen Position in Deutschland
- 4.1. Das Leben als Gabe Gottes
- 4.2. Gott – Ein Freund des Lebens
- 4.3. Der Mensch und sein Lebensauftrag
- 4.4. Suizidbeihilfe
- 4.5. Schutz des menschlichen Lebens
- 5. Diskussion
- 5.1. Praktische Grundnorm versus Gott?
- 5.1.1. Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- 5.1.2. Kritischer Vergleich
- 5.2. Die ethische Frage nach dem (ärztlich) assistierten Suizid
- 5.1. Praktische Grundnorm versus Gott?
- 6. Schluss
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die ethischen Probleme der Suizidbeihilfe, indem sie theoretische Grundlagen und praktische Diskussionen analysiert. Das Ziel ist es, eine ethische Beurteilung des assistierten Suizids unter Berücksichtigung der Philosophien von Wilhelm Kamlah und der christlichen Kirche zu liefern.
- Die Definition und Abgrenzung des Begriffs Suizid
- Die verschiedenen Formen der Sterbehilfe und ihre ethische Implikation
- Die philosophische Anthropologie von Wilhelm Kamlah und ihre Relevanz für die Ethik des Sterbens
- Die Position der christlichen Kirchen in Deutschland zum assistierten Suizid
- Ein Vergleich der Positionen von Kamlah und der christlichen Kirchen und deren Anwendung auf den assistierten Suizid
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage. Kapitel 2 definiert den Begriff Suizid, differenziert zwischen Suizidbeihilfe und Sterbehilfe und beleuchtet die aktuelle politische und kirchliche Debatte. Kapitel 3 präsentiert die philosophische Anthropologie von Wilhelm Kamlah, seine ethischen Überlegungen und seine Position zum Freitod. Kapitel 4 beschreibt die Position der christlichen Kirchen in Deutschland zum assistierten Suizid, wobei die Bedeutung des Lebens als Gabe Gottes, die Rolle des Menschen und die ethischen Bedenken im Vordergrund stehen. Kapitel 5 vergleicht die Positionen von Kamlah und der Kirche und diskutiert die ethische Beurteilung des assistierten Suizids.
Schlüsselwörter
Assistierter Suizid, Suizidbeihilfe, Sterbehilfe, ethische Beurteilung, Wilhelm Kamlah, Philosophische Anthropologie, christliche Kirche, Menschenwürde, Selbstbestimmung, praktische Grundnorm, Eudämonismus, Lebensqualität, Lebensbedingungen, vitale Güter, Tod als Widerfahrnis, Parlamentarische Debatte, kirchliche Position.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2023, Die Beihilfe zum Suizid als ethisches Problem, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1513750