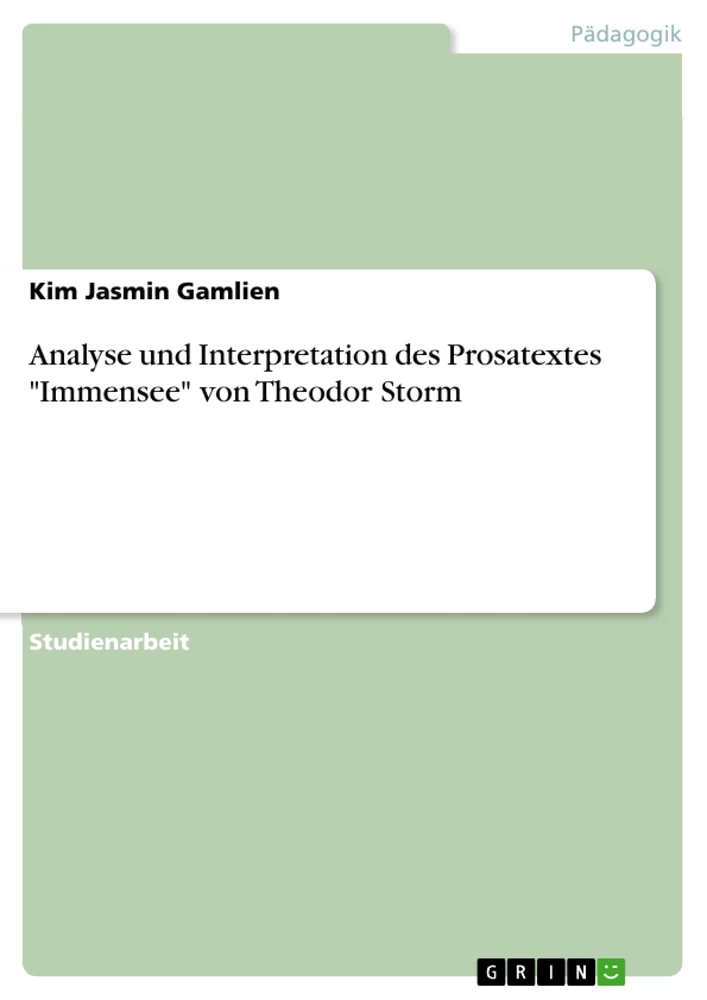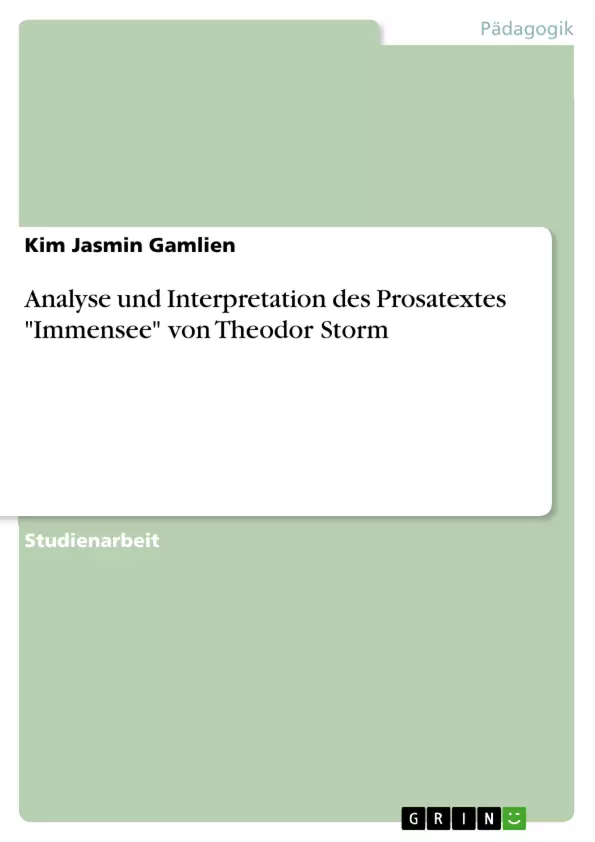Im Rahmen des Seminars "Theodor Storm" haben wir uns mit der Analyse und Interpretation der Novelle "Immensee" beschäftigt. Die Novelle beschreibt die Veränderung der Beziehung zwischen Elisabeth und Reinhard, die seit ihrer jungen Kindheit befreundet sind. Während Reinhards Abwesenheit zur Studienzeit heiratet Elisabeth als junge Frau dessen Freund Erich. Es kommt später nur noch ein Mal zu einem Zusammentreffen zwischen Elisabeth und Reinhard auf Gut Immensee.
Nach erstmaligem Lesen dieser Novelle haben wir den Eindruck von einer dramatischen Beziehungsgeschichte gewonnen, die einen negativen Ausgang findet. Es handelt sich um den Wunsch einer Beziehung der beiden Hauptfiguren, der aus nicht explizit genannten Gründen unerfüllt bleibt.
In unserer Arbeit gehen wir auf verschiedene Aspekte der Erzähltextanalyse ein, die uns zum besseren Verständnis dieser Novelle als hilfreich erscheinen. Hierbei stellt sich die Frage, welche Umstände genau dazu führen, dass es den Hauptfiguren verwehrt bleibt, ein gemeinsames Leben zu führen.
Zunächst werden wir eine Handlungsanalyse aus den Perspektiven der beiden Hauptfiguren Reinhard und Elisabeth vornehmen. Daran schließen wir die Figurenanalysen dieser Figuren an. Im darauf folgenden Teil werden wir in einer Isotopieanalyse näher auf die Beziehung zwischen Reinhard und Elisabeth sowie auf die dargestellten Räume eingehen. Zuletzt vergleichen wir unsere Interpretation der Novelle noch einmal mit einer weiteren, öffentlichen Interpretation sowie mit einer im Seminar "Theodor Storm" interpretierten Kurzgeschichte und reflektieren abschließend unseren ersten Leseeindruck.
Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass in dieser Hausarbeit mit dem Reclam-Heft “Immensee und andere Novellen“ von Theodor Storm (siehe Literaturverzeichnis S.17) gearbeitet wurde und Zitate nur durch entsprechende Seitenangaben kenntlich gemacht wurden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Handlungsanalyse
- Figurenanalyse
- Figurenanalyse Reinhard
- Figurenanalyse Elisabeth
- Isotopieanalyse
- Untersuchung der Beziehung zwischen Elisabeth und Reinhard
- Untersuchung der Räume
- Resumé
- Bezug zur Forschungsliteratur
- Bezug zum Seminar "Theodor Storm"
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit beschäftigt sich mit der Analyse und Interpretation der Novelle "Immensee" von Theodor Storm. Die Arbeit untersucht die Beziehung zwischen Elisabeth und Reinhard, die seit ihrer Kindheit befreundet sind, und analysiert die Umstände, die ein gemeinsames Leben der beiden Protagonisten verhindern.
- Analyse der Handlung aus der Perspektive der beiden Hauptfiguren
- Untersuchung der Figurencharakteristika von Reinhard und Elisabeth
- Isotopieanalyse der Beziehung zwischen Elisabeth und Reinhard sowie der dargestellten Räume
- Vergleich der Interpretation mit anderen Interpretationen der Novelle
- Reflexion des ersten Leseeindrucks
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Novelle "Immensee" und ihre zentralen Figuren, Elisabeth und Reinhard, vor. Sie beschreibt den Ausgangspunkt der Geschichte und die Frage, warum die beiden Protagonisten kein gemeinsames Leben führen können. Die Handlungsanalyse untersucht die Beziehung zwischen Elisabeth und Reinhard aus der Perspektive beider Figuren und zeigt die Faktoren auf, die zu einer Komplikation und Auflösung der Beziehung führen. Die Figurenanalyse geht auf die Charakteristika von Reinhard und Elisabeth ein, während die Isotopieanalyse die Beziehung zwischen den beiden Figuren sowie die dargestellten Räume näher beleuchtet. Das Resumé fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und setzt die Interpretation in Bezug zu anderen Interpretationen der Novelle sowie zum Seminar "Theodor Storm". Das Fazit reflektiert den ersten Leseeindruck und zieht abschließende Schlussfolgerungen.
Schlüsselwörter
Die Hausarbeit befasst sich mit den Themen der literarischen Textanalyse, der Figurencharakterisierung, der Isotopieanalyse, der Beziehung zwischen Elisabeth und Reinhard, den Räumen in der Novelle, der Interpretation von Theodor Storms "Immensee" und der Reflexion des ersten Leseeindrucks.
- Quote paper
- Kim Jasmin Gamlien (Author), 2009, Analyse und Interpretation des Prosatextes "Immensee" von Theodor Storm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151382