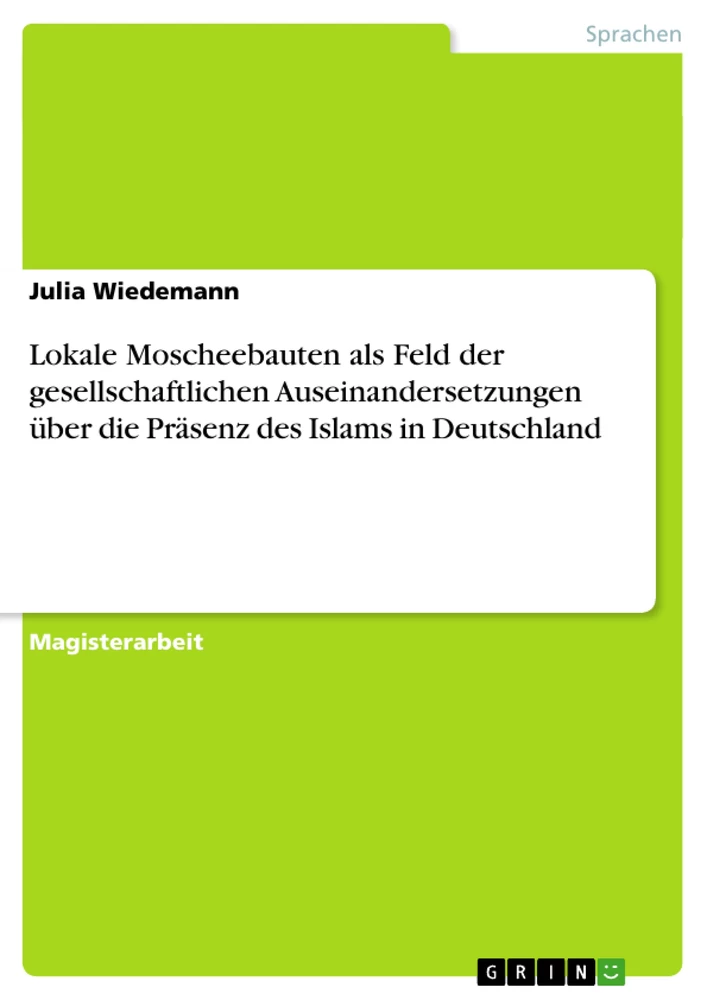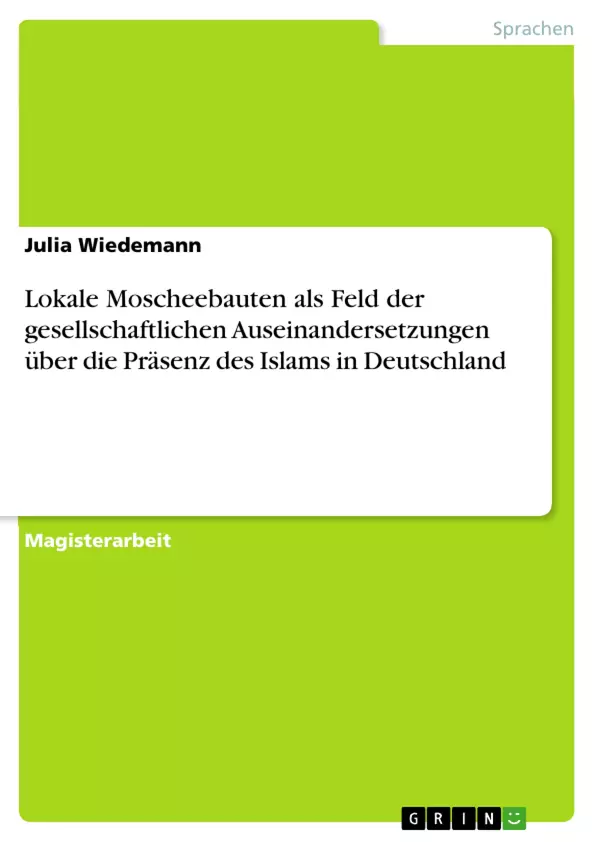Der Bau repräsentativer Moscheen, die Errichtung eines Minaretts oder die Einführung des Gebetsrufes in einigen Städten ist heute kein Einzelfall mehr. Längst haben die in Deutschland lebenden Muslime, bei denen es sich größtenteils um Einwanderer oder deren Nachkommen handelt, es in die Hand genommen, ihre Religion selbstbewusst und sichtbar nach außen zu vertreten. Sie sind keine Fremden
mehr, keine Gäste, die sich in den Nischen zurück ziehen, die ihnen von der Gesellschaft zugestanden werden, sondern sind selbst Teil dieser Gesellschaft, Bürger, Mitbürger, die sich ihren Platz suchen. Dieser Prozess geht häufig mit Konflikten und Auseinandersetzungen einher, sei es in der Debatte um das Kopftuch, das für einige als Symbol der Unterdrückung muslimischer Frauen steht, für andere
als Zeichen des selbstbewussten Nach-Außen-Tragens der eigenen religiösen Selbstverortung gewertet wird, und als klares Bekenntnis zur eigenen Religion. Oder in den Diskussionen um Moscheeneubauten, die von einigen als Landnahme strikt abgelehnt, von anderen als Symbol des Angekommenseins in der neuen Heimat begrüßt werden.
Das Thema Moscheekonflikte ist in den vergangenen Jahren häufig
Untersuchungsgegenstand gewesen. Mittlerweile sind zahlreiche Publikationen erschienen, viele davon entstanden aus Diplomarbeiten oder Dissertationen. Mehrheitlich stammen sie aus der Tastatur von Sozialwissenschaftlern oder Stadtund Raumplanern, eine Veröffentlichung von islamwissenschaftlicher Seite ist mir bislang nicht bekannt.[...]
- Arbeit zitieren
- Julia Wiedemann (Autor:in), 2009, Lokale Moscheebauten als Feld der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen über die Präsenz des Islams in Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151383