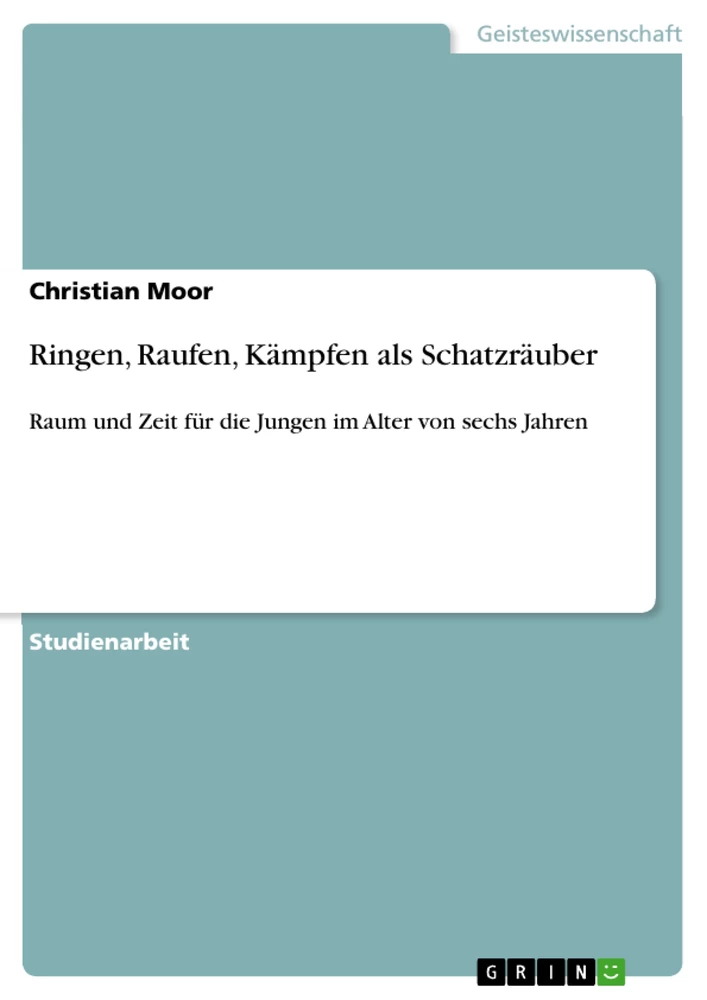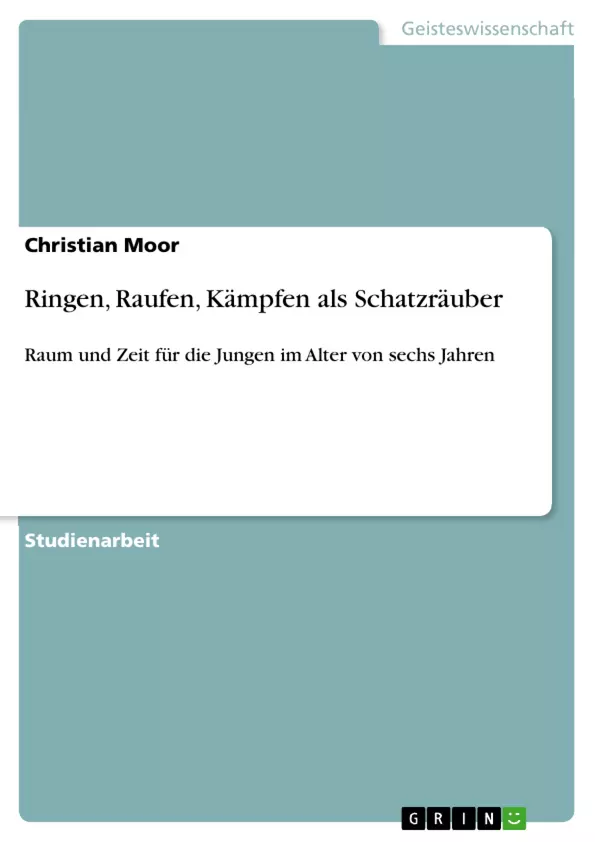Kinder haben einen instinktiven Bewegungsdrang, der durch veränderte Lebenssituationen vermehrt eingeschränkt wird. So gibt es weniger Bewegungsräume und –spiele durch verändertes Freizeitverhalten, elektronische Medien, oftmals kleine, hellhörige Wohnungen, Verplanung der Kinder, aber auch teilweise durch geringe Wertschätzung des freien Spiels im Freien. Vor 20 Jahren gingen Kinder zum Kindergarten und zur Schule, heute werden sie gebracht. So schränken Technisierung und evtl. Zeitmangel Bewegungsräume ebenfalls ein. Dabei haben gerade Jungen im Alter von 6 Jahren eine ausgeprägte Bewegungslust. Motorische Fertigkeiten stehen im Vordergrund. Sie „erleben durch ihre körperlichen Aktivitäten, dass sie selbst im Stande sind, etwas zu leisten, … dass sie mit ihren Handlungen etwas bewirken können“. Sind Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt, können keine altersgemäßen motorische Leistungen erzielt. Dabei sind Jungen von motorischen Entwicklungsstörungen stärker betroffen als Mädchen (im Verhältnis 2 : 1). Jungen im Alter von sechs Jahren rangeln, schieben, raufen und kämpfen. Sie wollen damit aber vielleicht gar keine Konflikte lösen. Es geht ihnen darum, sich zu spüren, anzustrengen, gar zu messen und Spaß zu haben. Erwachsene verbieten meistens schon im Ansatz dieses Kräftemessen und haben Angst vor einer Eskalation hin zur brutalen Gewalt. Gerade Jungen, wenn auch nicht alle, lieben es, sich auf dem Boden zu wälzen und zu zeigen was man „drauf hat“. Dadurch, dass die Möglichkeiten zu kämpfen zunehmend beschränkt werden, verlieren Kinder den Zugang, beim Raufen Grenzen einzuhalten und sich entsprechend zu erfahren und auch darin ihr Selbstbild zu entwickeln.
Inhaltsverzeichnis
- Bemerkungen zur Zielgruppe
- Beschreibung des Angebotes
- Wahl eines Themas
- Vorbemerkungen, Hintergründe
- Ablaufplanung
- Spielbeschreibungen
- Zielvorstellungen, Anregungspunkte
- Methodisch-didaktische Überlegungen und Bemerkungen
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Planungsbeispiel im Modul 4 der Sozialen Arbeit konzentriert sich auf die Anwendung von bewegungs-, erlebnispädagogischen und sportorientierten Kenntnissen und Methoden auf die Zielgruppe von Jungen im Alter von sechs Jahren. Das Ziel ist es, ihnen Raum und Zeit für Ringen, Raufen und Kämpfen zu bieten, um so ihre Bewegungsbedürfnisse zu befriedigen und gleichzeitig ihre soziale und motorische Entwicklung zu fördern.
- Bedeutung von Bewegung und Spiel für die Entwicklung von Jungen im Alter von sechs Jahren
- Ringen, Raufen und Kämpfen als Mittel zur Förderung von Sozialkompetenz, Selbstvertrauen und Motorik
- Kreative Gestaltung von Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten für diese Altersgruppe
- Integration von Jungen in Gruppen durch gezielte Spielanregungen
- Methodisch-didaktische Überlegungen zur Planung und Durchführung von Bewegungsangeboten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die besonderen Bedürfnisse von Jungen im Alter von sechs Jahren, die durch veränderte Lebensumstände und gesellschaftliche Normen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden. Es wird auf die Bedeutung von Bewegung und Spiel für die Entwicklung dieser Altersgruppe eingegangen und auf die Notwendigkeit, ihnen ausreichend Raum und Zeit für diese Aktivitäten zu bieten.
Kapitel 2 beschreibt das gewählte Thema „Ringen, Raufen, Kämpfen als Schatzräuber“ und dessen Relevanz für die Bedürfnisse der Zielgruppe. Es wird auf die Förderung der motorischen Fähigkeiten und die Bedeutung von Bewegungsspielen für die Entwicklung von Selbstkompetenz und Sozialkompetenz eingegangen.
Kapitel 3 skizziert die Ablaufplanung des Angebots, wobei die einzelnen Phasen und deren Inhalte, Methoden und Ziele detailliert dargestellt werden.
Kapitel 4 bietet eine Beschreibung der einzelnen Spiele, die im Rahmen des Angebots eingesetzt werden.
Kapitel 5 befasst sich mit den Zielvorstellungen und Anregungspunkten des Angebots.
Kapitel 6 widmet sich den methodisch-didaktischen Überlegungen und Bemerkungen zur Planung und Durchführung des Angebots.
Schlüsselwörter
Bewegung, Spiel, Ringen, Raufen, Kämpfen, Jungen, sechs Jahre, Sozialpädagogik, Psychomotorik, Selbstkompetenz, Sozialkompetenz, Integration, Gruppenarbeit, Spielanregungen, methodisch-didaktische Überlegungen, Planung, Durchführung.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Raufen und Kämpfen für Jungen wichtig?
Es dient dazu, den eigenen Körper zu spüren, sich anzustrengen, Kräfte zu messen und dabei soziale Grenzen sowie das eigene Selbstbild zu entwickeln.
Was ist das Ziel des Projekts "Schatzräuber"?
Es soll Jungen im Alter von sechs Jahren einen sicheren Raum für kontrolliertes Ringen und Kämpfen bieten, um Motorik und Sozialkompetenz zu fördern.
Führt Raufen automatisch zu Gewalt?
Nein, die Arbeit argumentiert, dass Kinder durch kontrolliertes Kämpfen lernen, Regeln einzuhalten und Eskalationen zu vermeiden, anstatt sie zu provozieren.
Welche Auswirkungen hat Bewegungsmangel auf Jungen?
Eingeschränkte Bewegungsräume können zu motorischen Entwicklungsstörungen führen, von denen Jungen statistisch häufiger betroffen sind als Mädchen.
Wie können Erwachsene dieses Kräftemessen pädagogisch begleiten?
Durch methodisch-didaktische Spielanregungen und klare Regeln können Pädagogen den instinktiven Bewegungsdrang in positive Bahnen lenken.
- Citation du texte
- Christian Moor (Auteur), 2009, Ringen, Raufen, Kämpfen als Schatzräuber, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151399