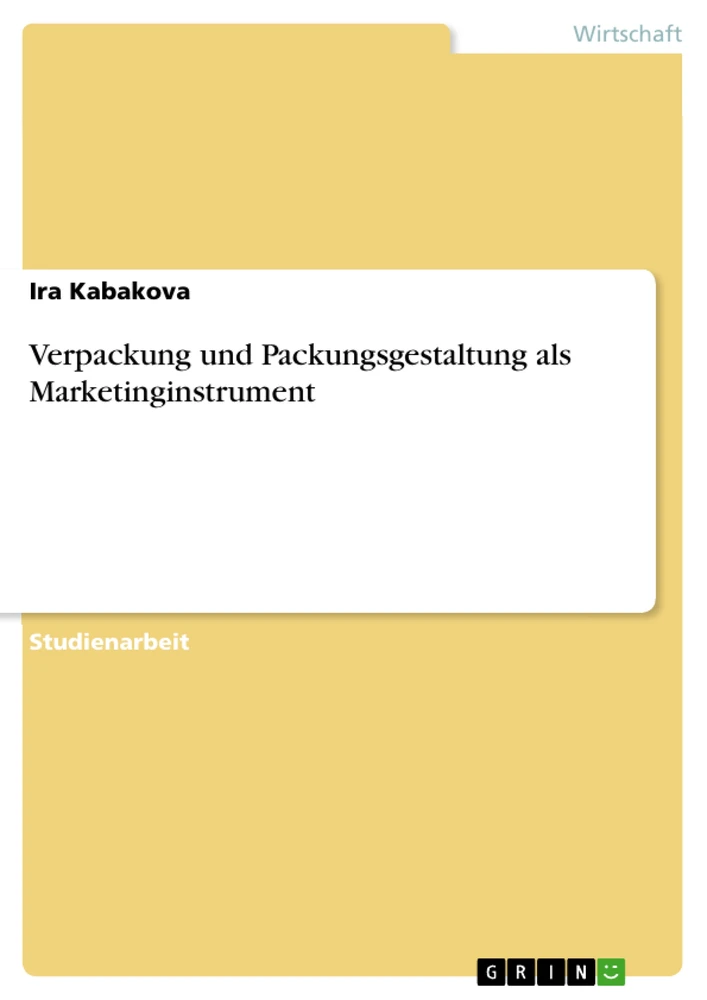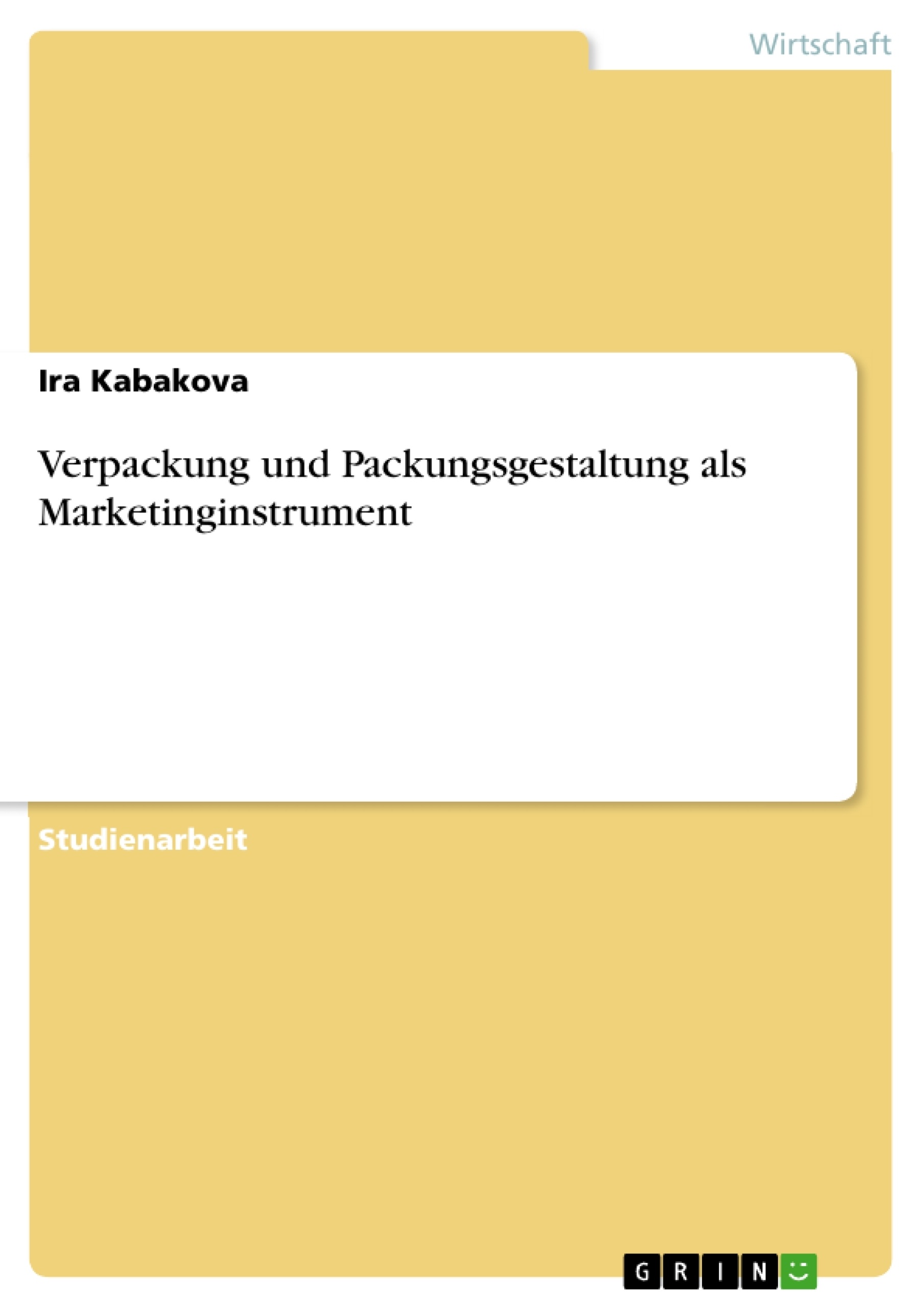Inhaltsverzeichnis
Einführung 1
1 Grundlagen zur Verpackung als Marketinginstrument 2
1.1 Begriffliche Abgrenzungen 5
1.2 Historische Entwicklung 6
2 Anforderungen an Verpackungen 9
2.1 Anforderungen seitens der Verbraucher 10
2.2 Anforderungen seitens der Hersteller und des Handels 11
2.3 Anforderungen seitens des Staates 12
3 Funktionen einer Verpackung 13
3.1 Grundfunktionen 13
3.1.1 Schutzfunktion 14
3.1.2 Lager- und Logistikfunktion 15
3.2 Zusatzfunktionen 17
3.2.1 Markenindikation 17
3.2.2 Informationsfunktion 18
3.2.3 Werbefunktion 19
4 Verpackungsgestaltung 20
5 Verpackung und Packungsgestaltung bei der Fa. xy 24
Fazit 33
Abbildungsverzeichnis 34
Quellenverzeichnis 35
Einführung
Oft ist die Verpackung eines Produkts das erste, was ein Kunde sieht und erlebt. Sie hat deshalb entscheidenden Einfluss auf das Kaufverhalten. Hersteller von Markenartikeln, insbesondere im Lebensmittel- und Konsumbereich wissen das.
Der Verpackung wird demnach in Expertenkreisen eine starke Verkaufskraft zugeschrieben. So wirkt die Verpackung als Konsumverstärker unmittelbar vor dem Kaufakt und versucht an die Wünsche und Bedürfnisse der Konsumenten anzuknüpfen. Sie bietet somit eine Fläche für Werbebotschaften, die auch eine langfristige Kundenbindung anstreben. Marke und Verpackung bilden dabei eine Einheit. Die Verpackung muss das Produkt am Point of Sale (PoS) verkaufen, denn dort ist die Erlebniswelt millionenteurer TV-Spots längst verblasst.
Ziel dieser Arbeit ist, einen Überblick über wesentliche Faktoren zu geben, welche für die „ideale Verpackung“ ausschlaggebend sind und zu einem erfolgreichen Einsatz jener als Marketinginstrument führt.
Zuerst wird auf den Begriff und die Grundlagen der Verpackung eingegangen, danach werden Anforderungen und Funktionen einer Verpackung aufgeführt. Im Kapitel „Verpackungsgestaltung“ wird das neue Konzept „multisensorisches Packaging“ kurz erläutert und im letzten Kapitel die Verpackungsgestaltung anhand eines Beispiels bei der Fa. xy GmbH dargestellt.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- 1 Grundlagen zur Verpackung als Marketinginstrument
- 1.1 Begriffliche Abgrenzungen
- 1.2 Historische Entwicklung
- 2 Anforderungen an Verpackungen
- 2.1 Anforderungen seitens der Verbraucher
- 2.2 Anforderungen seitens der Hersteller und des Handels
- 2.3 Anforderungen seitens des Staates
- 3 Funktionen einer Verpackung
- 3.1 Grundfunktionen
- 3.1.1 Schutzfunktion
- 3.1.2 Lager- und Logistikfunktion
- 3.2 Zusatzfunktionen
- 3.2.1 Markenindikation
- 3.2.2 Informationsfunktion
- 3.2.3 Werbefunktion
- 4 Verpackungsgestaltung
- 5 Verpackung und Packungsgestaltung bei der Fa. xy
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Verpackung als Marketinginstrument und hat zum Ziel, die wesentlichen Faktoren für eine „ideale Verpackung" aufzuzeigen, die zu einem erfolgreichen Einsatz im Marketing führt.
- Begriff und Grundlagen der Verpackung
- Anforderungen und Funktionen einer Verpackung
- Verpackungsgestaltung und das Konzept „multisensorisches Packaging"
- Verpackungsgestaltung am Beispiel der Fa. xy GmbH
- Der Einfluss der Verpackung auf das Kaufverhalten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Verpackung als Marketinginstrument ein und hebt ihre Bedeutung für das Kaufverhalten von Konsumenten hervor. Im ersten Kapitel werden der Begriff und die Grundlagen der Verpackung definiert, während das zweite Kapitel die Anforderungen an Verpackungen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das dritte Kapitel widmet sich den Funktionen einer Verpackung, sowohl den Grundfunktionen wie Schutz und Logistik als auch den Zusatzfunktionen wie Markenindikation, Informationsvermittlung und Werbung. Das Kapitel „Verpackungsgestaltung“ stellt das Konzept des „multisensorischen Packaging“ vor, das die Sinne der Konsumenten gezielt anspricht. Abschließend wird im Kapitel „Verpackung und Packungsgestaltung bei der Fa. xy“ die Gestaltung von Verpackungen am Beispiel eines Unternehmens betrachtet.
Schlüsselwörter
Verpackung, Marketinginstrument, Markenstrategie, Markenpolitik, Konsumentenverhalten, Kaufverhalten, Markenindikation, Informationsfunktion, Werbefunktion, multisensorisches Packaging, Point of Sale (POS).
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Verpackung ein wichtiges Marketinginstrument?
Sie ist oft der erste Kontaktpunkt am Point of Sale (PoS) und beeinflusst unmittelbar das Kaufverhalten und die Markenbindung.
Was sind die Grundfunktionen einer Verpackung?
Die Arbeit nennt die Schutzfunktion sowie die Lager- und Logistikfunktion als fundamentale Aufgaben.
Welche Zusatzfunktionen erfüllt eine Verpackung im Marketing?
Dazu gehören die Markenindikation (Wiedererkennung), die Informationsfunktion und die Werbefunktion.
Was ist „multisensorisches Packaging“?
Ein Gestaltungskonzept, das gezielt mehrere Sinne der Konsumenten (Haptik, Optik etc.) anspricht, um die Verkaufskraft zu steigern.
Welche Anforderungen stellt der Staat an Verpackungen?
Neben Herstellern und Verbrauchern stellt auch der Staat rechtliche Anforderungen, die in der Arbeit in Kapitel 2.3 behandelt werden.
- Quote paper
- Ira Kabakova (Author), 2009, Verpackung und Packungsgestaltung als Marketinginstrument, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151471