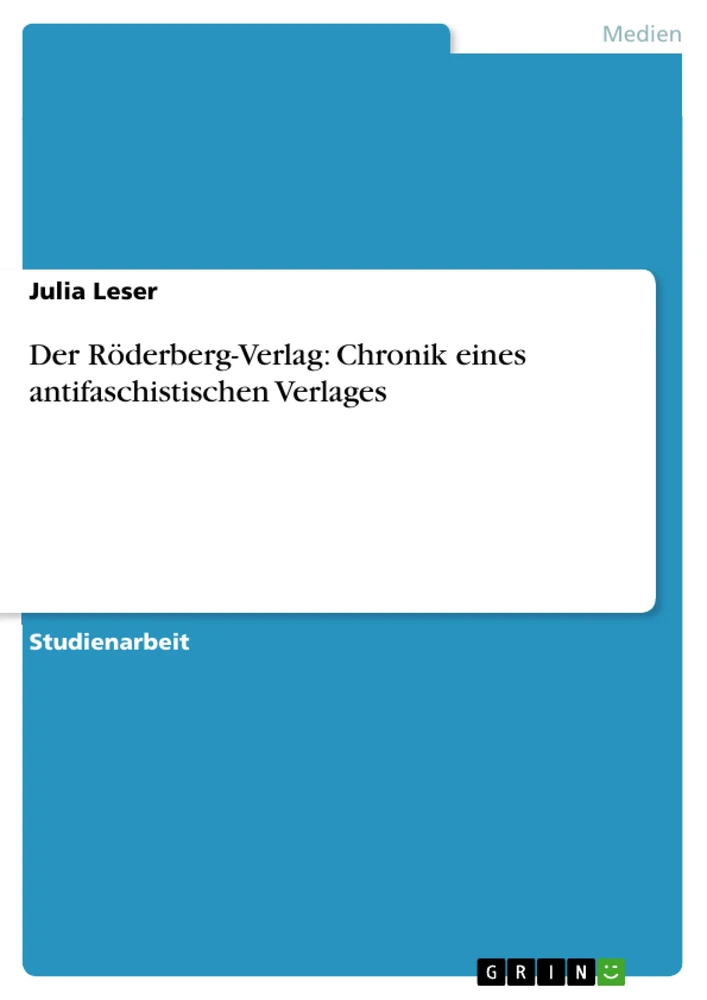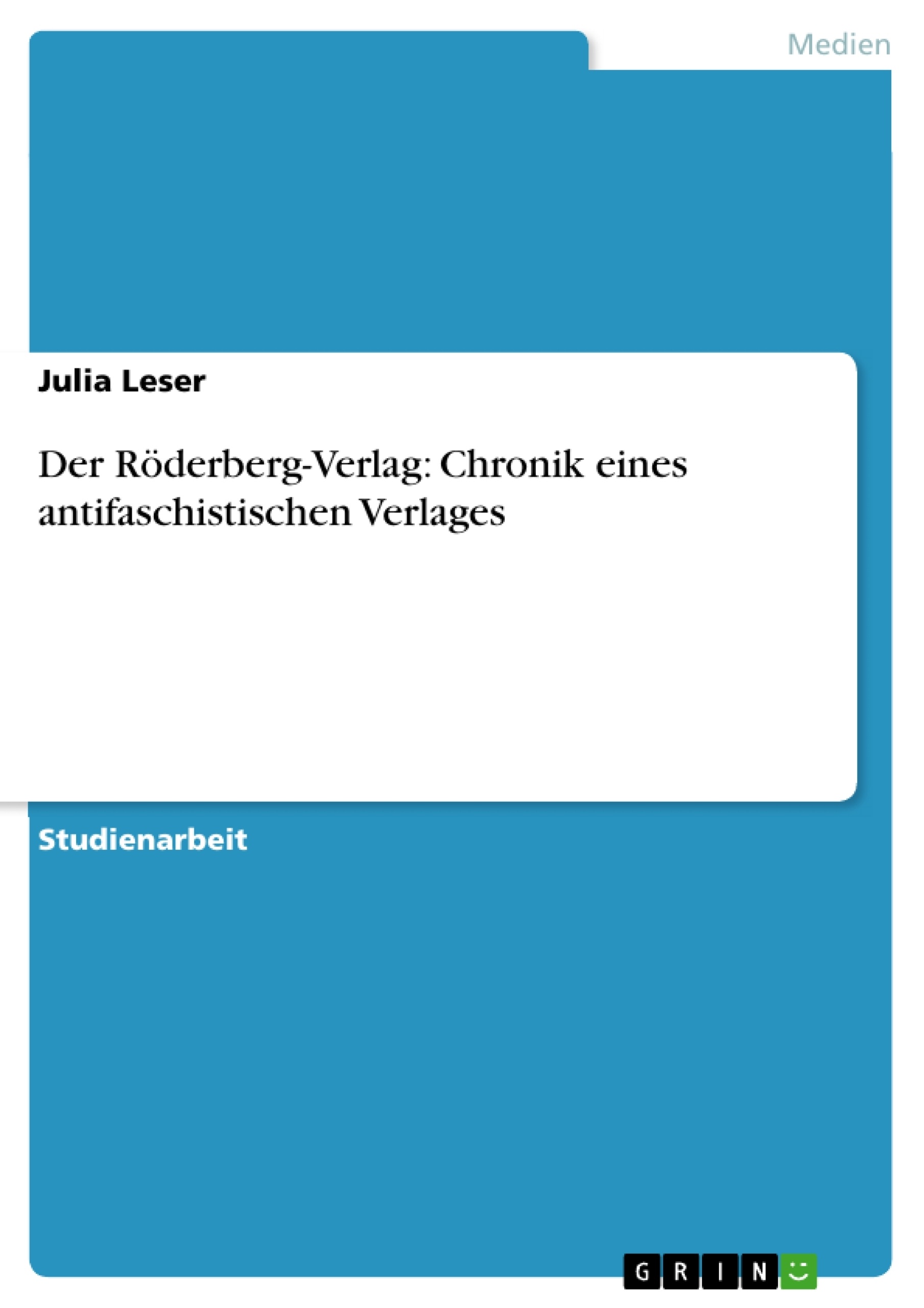„Wir schwören deshalb vor aller Welt auf diesem Appellplatz, an dieser Stätte des faschistischen Grauens: Wir stellen den Kampf erst ein, wenn auch der letzte Schuldige vor den Richtern der Völker steht! Die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln ist unsere Losung. Der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel. Das sind wir unseren gemordeten Kameraden, ihren Angehörigen schuldig.“
So formulierten die kommunistischen Widerstandskämpfer ihre Entschlossenheit auf der Trauerkundgebung des Internationalen Lagerkomitees für die Toten von Buchenwald am 19. April 1945.
Der so genannte „Schwur von Buchenwald“ entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem wichtigen Symbol für die ehemaligen politischen Häftlinge unter dem Gewaltregime Adolf Hitlers. Die im März 1947 gegründete „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“, kurz: VVN, begriff den Schwur als Kampfansage für ihre politische Arbeit im Rahmen der Entnazifizierung, Demokratisierung und Vergangenheitsbewältigung Deutschlands. Den Terror, den die Verfolgten am eigenen Leib erfahren hatten, wollten sie getreu dem „Schwur von Buchenwald“ nie wieder Wirklichkeit werden lassen. Auch der „hauseigene“ Röderberg-Verlag der VVN, den die vorliegende Arbeit zum Inhalt hat, stellte den Schwur einigen seiner Publikationen voran. Die politische Richtung des Verlages wird eindeutig: Im Verlagsprogramm finden sich neben Sachbüchern über Faschismus und Widerstand auch antifaschistische Romane sowie Einzeldarstellungen nationalsozialistischer Konzentrationslager. Man wollte informieren, aufklären, aufarbeiten. Inwieweit diese Ziele erfüllt wurden und woran der Verlag schließlich scheiterte, soll in der vorliegenden Arbeit untersucht werden.
Aufgrund der geringen Quellenlage zum „Röderberg-Verlag“ soll das Thema aus verschiedenen historischen, oft auch kontroversen Perspektiven erschlossen werden. Denn wie die meisten politischen Richtungsverlage der frühen Bundesrepublik spiegelt auch der Röderberg-Verlag historische Aspekte rund um die Frage nach einer deutschen Identität im Kontext einer traurigen Vergangenheit wider. Viele politische Verlage der frühen Bundesrepublik wirken fast wie Kommentatoren einer konfliktreichen BRD-Geschichte; hier bildet der Röderberg-Verlag keine Ausnahme.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gründungsjahre des Röderberg-Verlages
- Gründung und Konflikt der VVN nach 1945
- Die antifaschistische Wochenzeitung „die tat“
- Erste Publikationen des Röderberg-Verlages
- Der Durchbruch des Verlages
- Die „Bibliothek des Widerstandes“
- Beiträge zur Demokratisierung
- Weitere Reihen, gewichtige Einzeltitel und Schwerpunkte im Verlag
- Der Verlag in der Krise
- Verlagsfusionen
- Der große Schwachpunkt der VVN
- Das Ende des Röderberg-Verlages
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Röderberg-Verlag, der von der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ (VVN) gegründet wurde und der die Veröffentlichung von Sachbüchern, antifaschistischen Romanen und Einzeldarstellungen nationalsozialistischer Konzentrationslager zum Ziel hatte. Die Arbeit untersucht, inwieweit die Ziele des Verlages erreicht wurden und woran er letztendlich scheiterte.
- Die Gründung des Röderberg-Verlages und seine enge Verbindung zur VVN
- Die politischen und gesellschaftlichen Bedingungen in der frühen Bundesrepublik
- Der antifaschistische Konsens und die Rolle der VVN in der Entnazifizierung und Demokratisierung
- Die Herausforderungen des Kalten Krieges für die VVN und den Röderberg-Verlag
- Der Einfluss der VVN auf die politische Landschaft im Nachkriegsdeutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Gründungsjahre des Röderberg-Verlages und die politischen Rahmenbedingungen in der frühen Bundesrepublik. Es werden die Ziele und Herausforderungen der VVN im Kontext der Entnazifizierung und Demokratisierung diskutiert. Das zweite Kapitel analysiert den Durchbruch des Verlages, einschließlich der Veröffentlichung der „Bibliothek des Widerstandes“ und anderer wichtiger Publikationen. Das dritte Kapitel untersucht die Krise des Röderberg-Verlages, die durch Verlagsfusionen, den wachsenden Einfluss des Antikommunismus und die Abgrenzung von Teilen der VVN geprägt war.
Schlüsselwörter
Röderberg-Verlag, VVN, Antifaschismus, Entnazifizierung, Demokratisierung, Kalter Krieg, Westintegration, politische Richtungsverlage, deutsche Identität, Nachkriegsdeutschland.
Häufig gestellte Fragen
Was war der Röderberg-Verlag?
Der Röderberg-Verlag war der hauseigene Verlag der „Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes“ (VVN), der sich auf antifaschistische Literatur und Sachbücher über Widerstand und KZs spezialisierte.
Was besagt der „Schwur von Buchenwald“?
Der Schwur von 1945 forderte die Vernichtung des Nazismus mit seinen Wurzeln und den Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit. Er war das Leitmotiv des Verlages.
Warum scheiterte der Röderberg-Verlag schließlich?
Gründe waren unter anderem die politische Isolation der VVN im Kalten Krieg, der wachsende Antikommunismus in der frühen BRD und wirtschaftliche Schwierigkeiten durch Verlagsfusionen.
Was war die „Bibliothek des Widerstandes“?
Dies war eine bedeutende Buchreihe des Verlages, die authentische Berichte und wissenschaftliche Analysen über den Kampf gegen das NS-Regime veröffentlichte.
Welche Rolle spielte der Verlag für die deutsche Identität nach 1945?
Er fungierte als wichtiges Organ der Vergangenheitsbewältigung und Aufklärung, um eine demokratische Identität auf Basis des antifaschistischen Konsenses zu fördern.
- Citation du texte
- Julia Leser (Auteur), 2009, Der Röderberg-Verlag: Chronik eines antifaschistischen Verlages, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151527