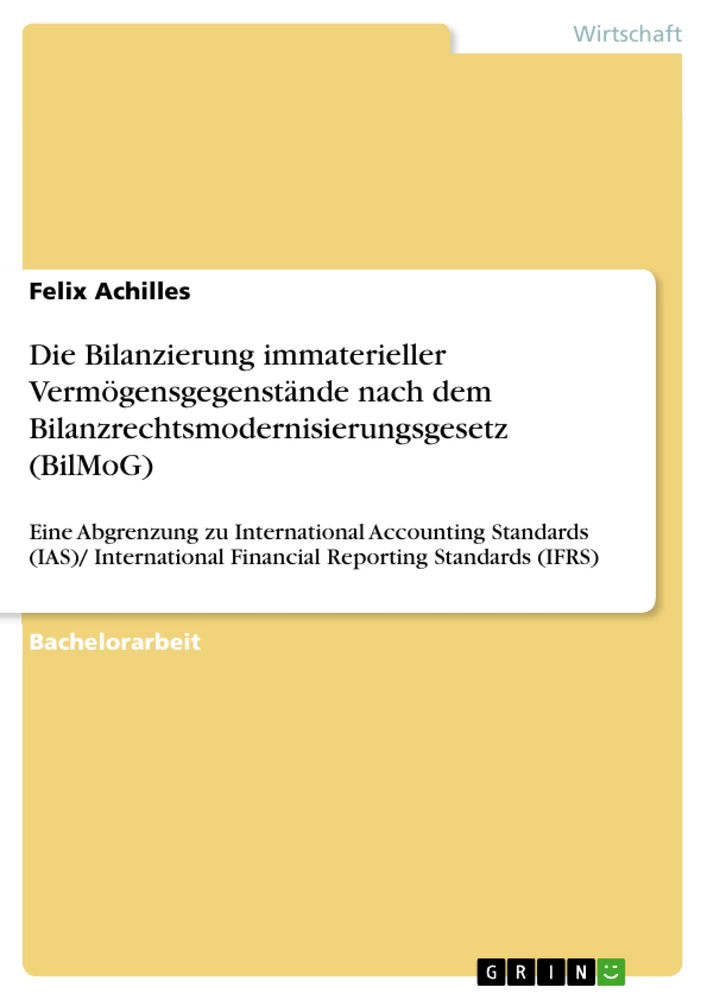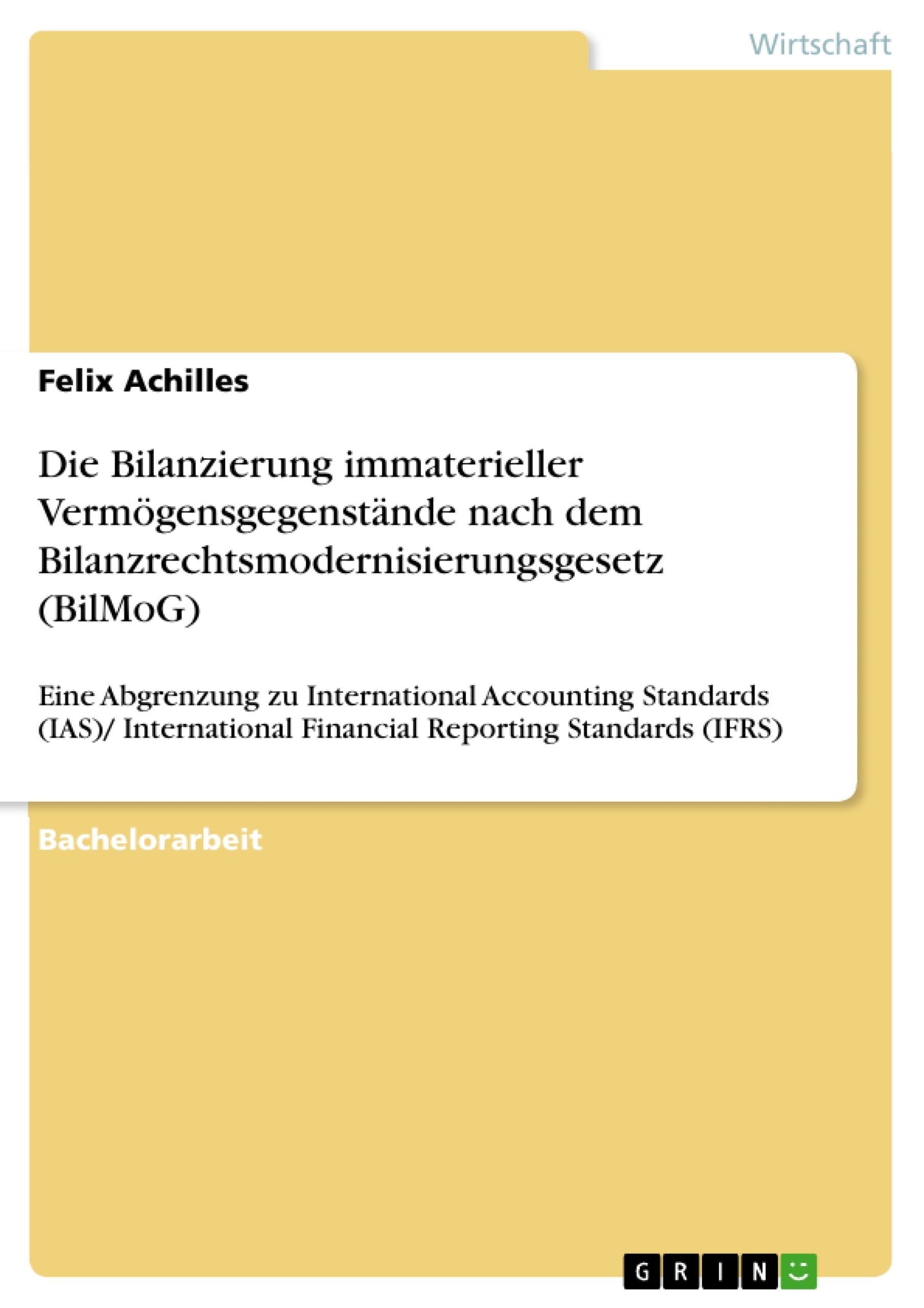Immaterielle Werte gelten, bedingt durch einen Strukturwandel hin zu einer wissensbasierten Gesellschaft, als relevante Wertetreiber für Unternehmen. Indes stellt die Behandlung immaterieller Werte die Rechnungslegung vor große Herausforderungen. Bereits im Jahre 79 galten immaterielle Werte als „ewige Sorgenkinder des Bilanzrechts“. Dies liegt darin begründet, dass sich bei immateriellen Werten Bewertungsprobleme ergeben können. Besonders schwierig ist die Behandlung selbst geschaffener immaterieller Werte, deren Wert grundsätzlich nicht eindeutig ermittelt werden kann, da i.d.R. kein aktiver Markt zur Verfügung steht. Hier können sich Objektivierungsdefizite ergeben. Aufgrund der nicht vorhandenen Marktbestätigung gilt im Handelsgesetzbuch gemäß § 248 Abs. 2 HGB a.F., aus Vorsichtsgründen und dem Gläubigerschutzgedanken, ein Aktivierungsverbot von nicht entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.
Im Gegensatz zu dem Vorsichtsprinzip im HGB a.F. steht bei der Bilanzierung nach IFRS die Informationsvermittlung im Vordergrund. Immaterielle Werte können ein entscheidender Informationenvermittler sein. Daher schreibt IFRS unter bestimmten Voraussetzungen auch den Ansatz von selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerten vor.
In einer globalen Welt ist eine vergleichbare und informationsreiche Rechnungslegung für Unternehmen sowie für (potenzielle) Investoren unentbehrlich. Daher war eine Modernisierung des HGB notwendig und zu erwarten. Dies wurde durch das BilMoG umgesetzt. Ferner soll das BilMoG EU-rechtliche Vorgaben erfüllen.
Laut der Gesetzesbegründung erhebt das BilMoG den Anspruch, Unternehmen in Deutschland eine moderne, eigenständige und vollwertige Bilanzierungsgrundlage zur Verfügung zu stellen, welche jedoch einfacher und kostengünstiger im Verhältnis zu IFRS ist. Hierzu soll die Informationsfunktion des HGB gestärkt werden ohne die Kernpunkte des Bilanzrechts aufzugeben. Der Bedeutungswandel immaterieller Werte blieb dem Gesetzgeber nicht verborgen. Da durch das strikte Aktivierungsverbot selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im HGB a.F. die tatsächliche Vermögens- und Ertragslage der Unternehmen nur eingeschränkt darstellbar war, wurde ein Aktivierungswahlrecht für diesen Posten eingeführt, der die Informationsfunktion stärkt. Der Einfluss immaterieller Werte und die bedeutsamen Änderungen im Handelsrecht rechtfertigen eine genauere Auseinandersetzung mit diesem Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Problemstellung
- Gang der Untersuchung
- Definition und Einordnung
- Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach Handelsrecht
- Ansatz
- Grundsätzliche Anforderungen
- Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände
- Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände
- Immaterielle Vermögensgegenstände bei Unternehmenszusammenschlüssen
- Bewertung
- Zugangsbewertung
- Anschaffungskosten
- Herstellungskosten
- Folgebewertung
- Zugangsbewertung
- Ausweis
- Ansatz
- Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach IAS/ IFRS
- Ansatz
- Grundsätzliche Anforderungen
- Einzelerwerb
- Selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte
- Im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses
- Bewertung
- Zugangsbewertung
- Bewertung bei Zugang durch Einzelerwerb
- Bewertung originärer immaterielle Vermögenswerte
- Bewertung im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses
- Folgebewertung
- Anschaffungskostenmodell
- Neubewertungsmodell
- Zugangsbewertung
- Ausweis
- Ansatz
- Besonderheiten des Geschäfts- oder Firmenwertes
- Nach Handelsrecht
- Nach IAS/IFRS
- Schlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
- Gesetzesmaterialien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte im deutschen Handelsrecht und nach IAS/IFRS. Ziel ist es, die unterschiedlichen Regelungen und deren Auswirkungen auf die Bilanzierungspraxis zu analysieren und zu vergleichen.
- Definition und Einordnung immaterieller Vermögenswerte
- Ansatz und Bewertung immaterieller Vermögenswerte nach Handelsrecht und IAS/IFRS
- Besonderheiten der Bilanzierung des Geschäfts- oder Firmenwertes
- Vergleich der Bilanzierungsvorschriften im deutschen Handelsrecht und nach IAS/IFRS
- Relevanz der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte für die Informationsvermittlung und die Entscheidungsfindung von Investoren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Problemstellung der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte ein und erläutert die Relevanz des Themas im Kontext des Strukturwandels hin zu einer wissensbasierten Gesellschaft.
Das zweite Kapitel definiert und ordnet immaterielle Vermögenswerte ein und beleuchtet die Herausforderungen, die sich bei deren Bilanzierung ergeben.
Das dritte Kapitel widmet sich der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach Handelsrecht. Es werden die Anforderungen an den Ansatz, die Bewertung und den Ausweis immaterieller Vermögensgegenstände im Detail dargestellt.
Das vierte Kapitel behandelt die Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach IAS/IFRS. Es werden die Unterschiede zu den handelsrechtlichen Vorschriften aufgezeigt und die Besonderheiten der Bilanzierung nach IAS/IFRS erläutert.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den Besonderheiten des Geschäfts- oder Firmenwertes, einem wichtigen immateriellen Vermögensgegenstand, der sowohl im Handelsrecht als auch nach IAS/IFRS eine besondere Behandlung erfährt.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen immaterielle Vermögenswerte, Bilanzierung, Handelsrecht, IAS/IFRS, Geschäfts- oder Firmenwert, Ansatz, Bewertung, Ausweis, Informationsvermittlung, Entscheidungsfindung, Investoren, Strukturwandel, wissensbasierte Gesellschaft.
Häufig gestellte Fragen
Was änderte das BilMoG bei immateriellen Vermögenswerten?
Das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) führte ein Aktivierungswahlrecht für selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im HGB ein.
Warum waren immaterielle Werte früher „Sorgenkinder“ des Bilanzrechts?
Wegen Bewertungsproblemen und dem Fehlen aktiver Märkte, was zu Objektivierungsdefiziten führt. Das Vorsichtsprinzip verbot daher lange die Aktivierung nicht entgeltlich erworbener Werte.
Wie unterscheidet sich die Bilanzierung nach IFRS vom HGB?
Bei IFRS steht die Informationsvermittlung im Vordergrund, weshalb der Ansatz selbst geschaffener immaterieller Werte unter bestimmten Voraussetzungen oft zwingend vorgeschrieben ist.
Was ist der Unterschied zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten?
Anschaffungskosten fallen beim Erwerb von Dritten an, während Herstellungskosten bei der Eigenentwicklung (selbst geschaffene Werte) relevant sind.
Wie wird der Geschäfts- oder Firmenwert (Goodwill) behandelt?
Die Arbeit analysiert die spezifischen Regeln für den Goodwill sowohl nach deutschem Handelsrecht als auch nach IAS/IFRS, insbesondere im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen.
Warum ist die Modernisierung des HGB für Investoren wichtig?
In einer wissensbasierten Gesellschaft sind immaterielle Werte zentrale Wertetreiber. Eine modernisierte Bilanzierung bietet eine bessere Informationsgrundlage für Investitionsentscheidungen.
- Quote paper
- Felix Achilles (Author), 2009, Die Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151614