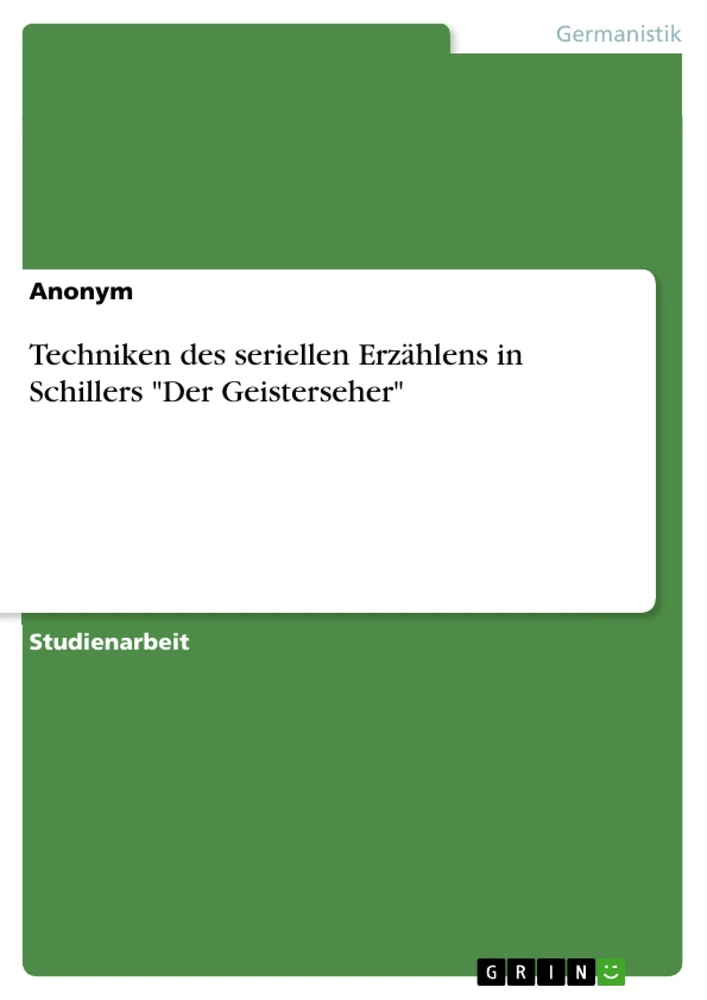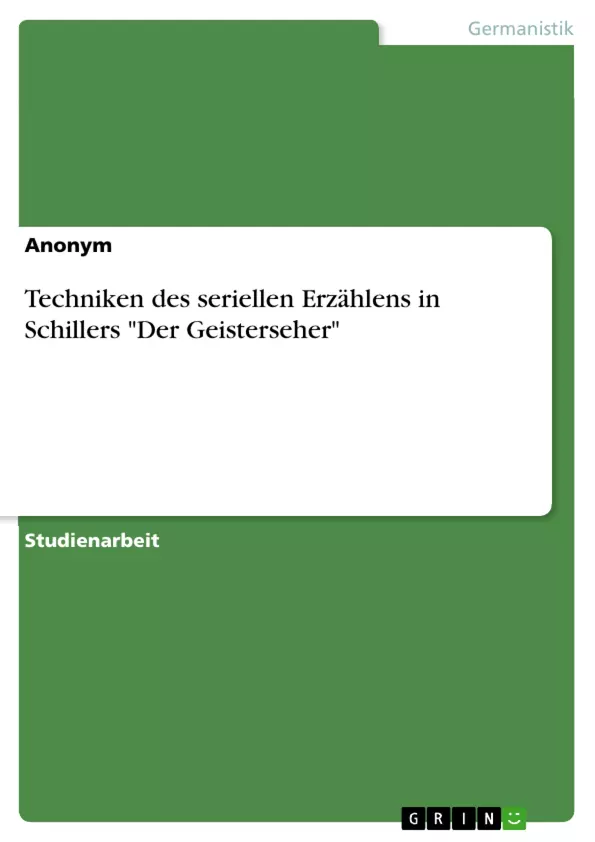Friedrich Schillers "Der Geisterseher" - ein fragmentarisches Werk, das erstmals 1787 veröffentlicht wurde - faszinierte das Publikum durch eine raffinierte Erzählstrategie: Immer dann, wenn die Handlung auf eine Lösung des Mysteriums zusteuert, bricht die Erzählung ab und lässt die Leser mit offenen Fragen zurück. Dieses geschickte Spiel mit Unterbrechungen und dem gezielten Spannungsaufbau fesselt die Leser und weckt in ihnen das Bedürfnis, die Handlung weiter zu verfolgen. Diese Arbeit beleuchtet diese und andere strukturelle und inhaltliche Techniken, die Schiller in "Der Geisterseher" einsetzt, um Leserbindung und Spannung zu erzeugen. Die Arbeit behandelt dabei auch die Publikationsform, -geschichte sowie die Rezeptionsgeschichte des Werkes, die einen zentralen Konflikt der Literaturwissenschaft zwischen Trivial- und Hochliteratur abbildet.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Einordnung von Schillers Der Geisterseher
- 2.1 Publikationsgeschichte und -modus
- 2.2 Publikationsort
- 3. Serielles Erzählen
- 3.1 Die Serie
- 3.2 Das Prinzip der Mehrteiligkeit
- 3.3 Strategien der Leserbindung
- 4. Strukturanalyse von Schillers Der Geisterseher
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Techniken des seriellen Erzählens in Schillers „Der Geisterseher“, insbesondere die Mittel der Leserbindung und Spannungserzeugung. Es wird analysiert, wie inhaltliche und strukturelle Erzählunterbrechungen eingesetzt werden und welche Rolle diese für den enormen Publikumserfolg des Werkes spielten. Die Publikationsgeschichte und der zeitgeschichtliche Kontext werden ebenfalls beleuchtet.
- Serielles Erzählen in der Aufklärung und beginnenden Romantik
- Analyse der Strategien zur Leserbindung in „Der Geisterseher“
- Bedeutung von Erzählunterbrechungen für Spannung und Rezeption
- Der Einfluss der Schauerliteratur auf Schillers Werk
- Publikationsgeschichte und Rezeption von Schillers „Der Geisterseher“
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 (Einleitung): Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach den Techniken der Leserbindung in Schillers „Der Geisterseher“ in den Mittelpunkt. Sie bezieht sich auf eine Rezension des ersten Fragments und deutet die Bedeutung von Erzählunterbrechungen für die Spannung an.
Kapitel 2 (Einordnung von Schillers Der Geisterseher): Dieses Kapitel ordnet Schillers „Der Geisterseher“ in den zeitgeschichtlichen Kontext ein, beleuchtet die Entstehungsgeschichte im Spannungsfeld von Aufklärung und Romantik sowie den Einfluss der Schauerliteratur. Es wird der Roman als „Geheimbundroman“ und seine Rezeptionsgeschichte diskutiert.
Kapitel 2.1 (Publikationsgeschichte und -modus): Hier wird die Publikationsgeschichte als Fortsetzungsroman in der Zeitschrift „Thalia“ detailliert beschrieben und die Gründe für die serielle Veröffentlichung erläutert. Der Gegensatz zwischen Publikumserfolg und dem negativen Urteil Schillers wird hervorgehoben.
Kapitel 3 (Serielles Erzählen): Dieses Kapitel befasst sich allgemein mit dem Phänomen des seriellen Erzählens, untersucht die Eigenschaften von Serien und analysiert die Techniken der Spannungserzeugung und Leserbindung.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2020, Techniken des seriellen Erzählens in Schillers "Der Geisterseher", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1516250