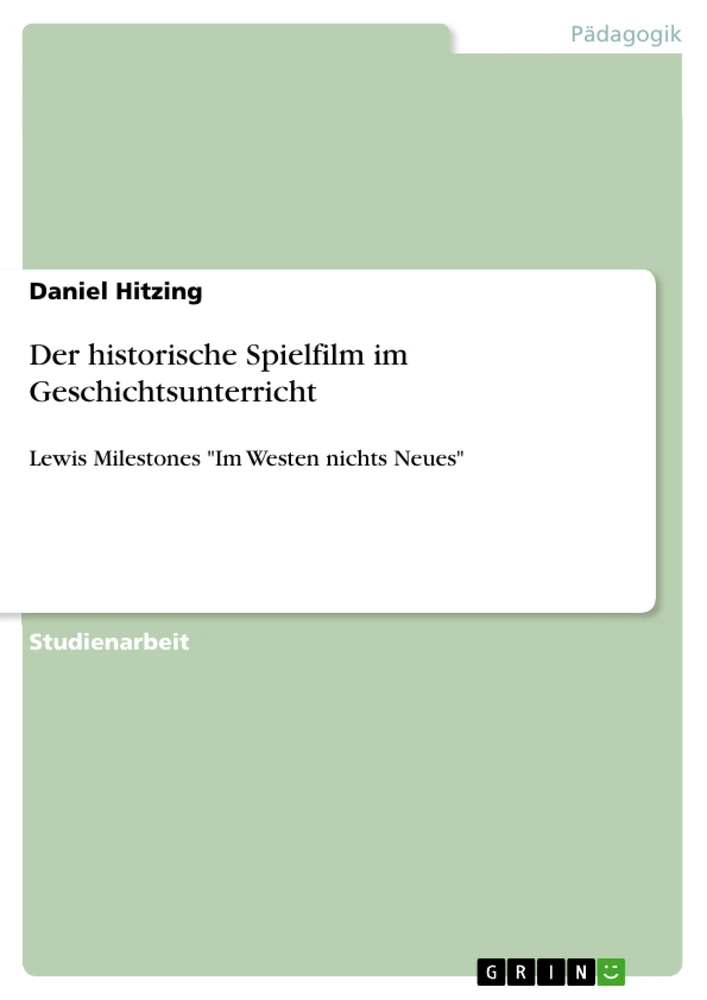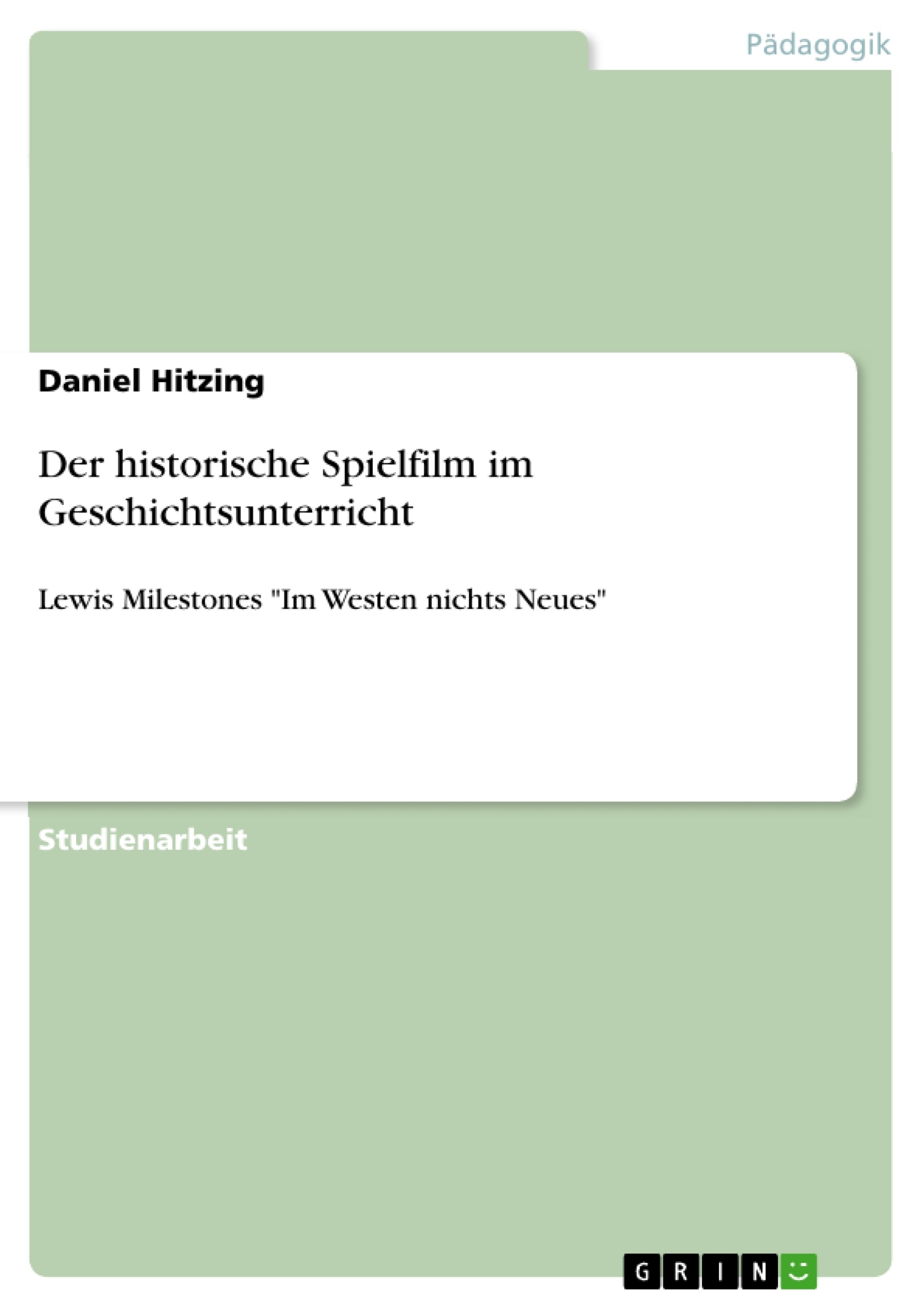Bodo von Borries leitet seinen Aufsatz Geschichte im Fernsehen – und Geschichtsfernsehen in der Schule mit dem Satz „Das Fernsehen beeinflußt historisches Interesse, Wissen, Verständnis und Bewußtsein mehr als die Schule, erst recht mehr als der Geschichts- und Politikunterricht“ ein. Wenn man nun bedenkt, dass der Einsatz von Filmen in der Schule eher selten geschieht, wird es verständlich, warum sich die vorliegende Arbeit mit den Einsatzmöglichkeiten des Films Im Westen nichts Neues (IWNN) von Lewis Milestone aus dem Jahr 1930 im Geschichtsunterricht beschäftigt. Somit bewegt sie sich im Bereich der Didaktik, jedoch nicht nur eine mediendidaktische, sondern auch eine geschichtsdidaktische Perspektive muss eingenommen werden. Daher geht es zunächst darum die Chancen eines Einsatzes des Mediums Film im Un-terricht allgemein herauszustellen und dann den Fokus auf die Besonderheiten, die der Film als Quelle und als Medium für den Geschichtsunterricht hat, zu legen.
In einem weiteren Schritt wird der Film selbst zum Gegenstand der Analyse. Hierbei stehen neben der Handlung und der eingesetzten filmischen Mittel, vor allem der Ent-stehungskontext und die Rezeptionsgeschichte des Films im Mittelpunkt der Aufmerk-samkeit.
Daran anschließend ist es das Ziel, auf Grundlage der bis dahin gewonnenen Ergebnisse, die Einsatzmöglichkeiten im Unterricht von IWNN darzustellen. Nach einer kurzen Verortung in den Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für den Geschichtsunter-richt in der gymnasialen Oberstufe, wird ein konkreter Unterrichtsvorschlag skizziert.
Dessen Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern Methoden und Wissen für den Umgang mit in Filmen gezeigter Geschichte an die Hand zu geben. Dadurch sollen sie befähigt werden, selbst kritisch über, in Spielfilmen oder Dokumentation dargestellter Geschichte, zu reflektieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Film im (Geschichts)unterricht
- Lewis Milestones ,,Im Westen nichts Neues❝
- ,,Im Westen nichts Neues\" im Geschichtsunterricht
- Verortung in den Richtlinien
- Einsatzmöglichkeiten
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Einsatzmöglichkeiten des Films „Im Westen nichts Neues“ von Lewis Milestone aus dem Jahr 1930 im Geschichtsunterricht. Dabei werden die Chancen des Filmeinsatzes im Unterricht allgemein betrachtet, sowie die Besonderheiten des Films als Quelle und Medium für den Geschichtsunterricht beleuchtet.
- Analyse des Films „Im Westen nichts Neues“ hinsichtlich Handlung, filmischer Mittel, Entstehungskontext und Rezeptionsgeschichte
- Darlegung der Einsatzmöglichkeiten des Films im Unterricht anhand der Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für den Geschichtsunterricht in der gymnasialen Oberstufe
- Entwicklung eines konkreten Unterrichtsvorschlags, der Schülerinnen und Schülern Methoden und Wissen für den Umgang mit in Filmen gezeigter Geschichte vermittelt
- Fokus auf die Förderung von Medienkompetenz und Handlungsfähigkeit der Lernenden
- Reflexion der Rolle des Films als Leitmedium im Unterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Film „Im Westen nichts Neues“ und seine Relevanz für den Geschichtsunterricht vor. Es wird erläutert, warum der Einsatz des Films im Unterricht relevant ist und welche didaktischen Perspektiven betrachtet werden sollen.
Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Einsatz von Filmen im Geschichtsunterricht allgemein. Dabei werden die verschiedenen Lernziele, die durch den Einsatz von Filmen erreicht werden können, vorgestellt und die Bedeutung von Medienkompetenz in diesem Zusammenhang beleuchtet.
Kapitel 3 widmet sich dem Film „Im Westen nichts Neues“ und untersucht dessen Handlung, filmische Mittel, Entstehungskontext und Rezeptionsgeschichte.
Kapitel 4 diskutiert die Einsatzmöglichkeiten des Films „Im Westen nichts Neues“ im Geschichtsunterricht. Es werden die Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen für den Geschichtsunterricht in der gymnasialen Oberstufe betrachtet und ein konkreter Unterrichtsvorschlag skizziert, der Methoden und Wissen für den Umgang mit in Filmen gezeigter Geschichte vermitteln soll.
Schlüsselwörter
Geschichtsunterricht, Spielfilm, „Im Westen nichts Neues“, Lewis Milestone, Medienpädagogik, Medienkompetenz, Handlungsorientierung, Didaktik, Unterrichtsgestaltung, Unterrichtsvorschlag, Richtlinien, Medienanalyse, Rezeptionsgeschichte, Entstehungskontext.
Häufig gestellte Fragen
Warum eignet sich der Film „Im Westen nichts Neues“ für den Geschichtsunterricht?
Der Film von 1930 bietet eine eindringliche Darstellung der Schrecken des Ersten Weltkriegs und dient als wertvolle Quelle zur Analyse von Antikriegs-Botschaften.
Welche Lernziele verfolgt der Einsatz von Filmen im Unterricht?
Neben historischem Wissen soll vor allem die Medienkompetenz gefördert werden, damit Schüler Darstellungen von Geschichte kritisch reflektieren können.
Was ist der Unterschied zwischen einem Film als Quelle und als Medium?
Als Quelle gibt der Film Aufschluss über seine Entstehungszeit; als Medium dient er der Vermittlung historischer Inhalte an die Lernenden.
Wie wird die Rezeptionsgeschichte des Films in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht, wie das Publikum und die Politik zu verschiedenen Zeiten auf die drastischen Kriegsdarstellungen des Films reagiert haben.
Gibt es konkrete Unterrichtsvorschläge für die Oberstufe?
Ja, die Arbeit skizziert einen Vorschlag gemäß den Richtlinien von NRW, der Schülern Methoden zur Analyse filmischer Geschichtsbilder vermittelt.
- Quote paper
- Bachelor Daniel Hitzing (Author), 2010, Der historische Spielfilm im Geschichtsunterricht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151649