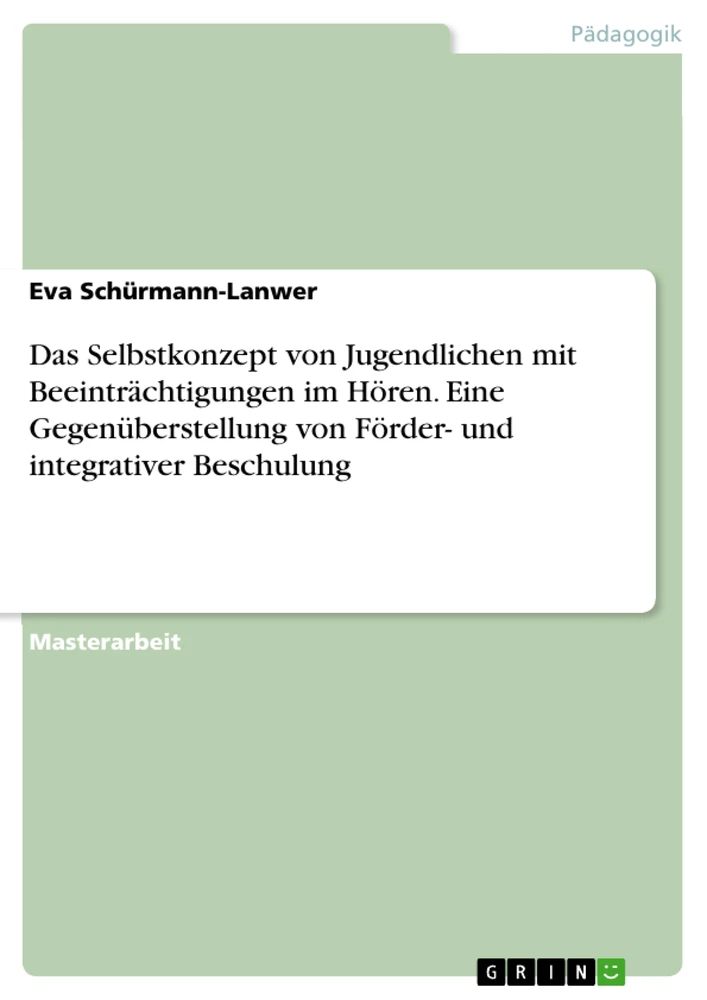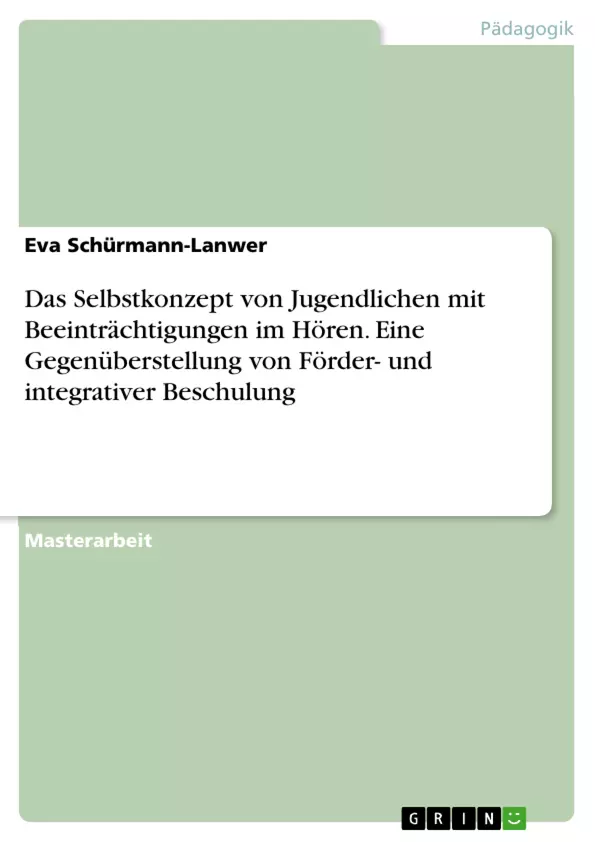Im Rahmen dieser Masterarbeit wird untersucht, wie sich unterschiedliche Beschulungsformen auf das Selbstkonzept hörbeeinträchtigter Jugendlicher auswirken. Verglichen werden dabei Förderschulen und integrative Schulen mit Fokus auf psychologische, pädagogische, medizinische und soziale Faktoren. Die Autorschaft betrachtet theoretische Aspekte des Selbstkonzepts sowie der Hörbeeinträchtigung und führt eine empirische Studie durch, die darauf ausgerichtet ist, mittels quantitativer Methoden die Selbstwahrnehmung der betroffenen Jugendlichen und die elterliche Fremdwahrnehmung zu erfassen. Intendiert wird, herauszufinden, inwieweit die Schulform das Selbstbild der Jugendlichen beeinflusst und wie sich integrative versus segregative Ansätze auf das psychosoziale Wohlbefinden und die persönliche Entwicklung der Schüler:innen auswirken.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretischer Teil
- 2.1 Das Selbstkonzept im Kontext der Persönlichkeit
- 2.1.1 Die Strukturierung des Selbstkonzepts
- 2.1.2 Theoretische Ansätze
- 2.1.3 Entwicklungspsychologische Aspekte
- 2.1.4 Das Selbstkonzept im Kontext der Adoleszenz
- 2.2 Das menschliche Ohr und dessen Beeinträchtigungen
- 2.2.1 Anatomie und Physiologie des menschlichen Hörorgans
- 2.2.2 Das Sujet der Hörbeeinträchtigung
- 2.2.3 Begriffliche Abgrenzungen
- 2.2.4 Einteilung von Hörbeeinträchtigungen
- 2.2.5 Auswirkungen von Hörbeeinträchtigungen
- 2.2.6 Fördermöglichkeiten auf der medizinisch-technischen Ebene
- 2.2.7 Kommunikation mit dem Kind mit Hörbeeinträchtigung
- 2.3 Beschulungsformen von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich Hören
- 2.3.1 Etymologischer Hintergrund der Begrifflichkeiten Integration und Separation
- 2.3.2 Sonderpädagogische Sichtweise auf den Integrationsbegriff
- 2.3.3 Hörgeschädigtenpädagogisches Verständnis der (schulischen) Integration von Personen mit Hörbeeinträchtigung
- 2.3.4 Von der Integration zur Inklusion
- 2.3.4.1 Die Sichtweise des inklusiven Konzeptes
- 2.3.4.2 Abgrenzung zum Konzept der Integration
- 2.3.4.3 Ziele der Inklusion
- 2.3.5 Modelle der schulischen Integration von Kindern mit einer Hörbeeinträchtigung in Deutschland
- 2.3.5.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen
- 2.3.5.2 Mobiler Sonderpädagogischer Dienst
- 2.3.6 Förderzentrum - begriffliche Bestimmung und Aufgabenbeschreibung
- 2.3.7 Voraussetzungen für die schulische Integration von Personen mit Hörbeeinträchtigung
- 2.3.7.1 Räumliche, organisatorische und technische Aspekte
- 2.3.7.2 Didaktisch-methodische Aspekte
- 2.3.7.3 Personale Aspekte
- 2.3.8 Vor- und Nachteile der schulischen Integration von Personen mit Hörbeeinträchtigung
- 2.3.8.1 Vorteile einer integrativen Beschulung
- 2.3.8.2 Risiken einer integrativen Beschulung
- 2.3.8.3 Vorteile einer segregativen Beschulung
- 2.3.8.4 Nachteile einer segregativen Beschulung
- 2.4 Stand der gegenwärtigen Forschung
- 2.5 Forschungsanliegen und Thesen der vorliegenden Studie
- 3 Empirischer Teil
- 3.1 Ansätze der quantitativen Sozialforschung
- 3.2 Anforderungen an Studien der quantitativen Sozialforschung
- 3.3 Grundkonzeption der empirischen Studie
- 3.3.1 Überblick über die gewählte Methodologie
- 3.3.2 Beschreibung der Datenerhebungsinstrumente
- 3.3.3 Beschreibung der Stichprobe
- 3.3.4 Durchführung der empirischen Studie
- 3.3.5 Methode der Datenauswertung
- 4 Ergebnisse
- 4.1 Deskriptive Ergebnisse
- 4.2 Zusammenfassende Betrachtung
- 5 Diskussion
- 6 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit Hörbeeinträchtigungen. Ziel ist es, die Unterschiede im Selbstkonzept zwischen Kindern in Förder- und integrativen Beschulungskontexten zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet sowohl theoretische Grundlagen als auch empirische Befunde.
- Selbstkonzept von Schülern mit Hörbeeinträchtigungen
- Vergleich integrative und segregative Beschulung
- Einfluss von Hörbeeinträchtigung auf die Selbstwahrnehmung
- Theoretische Modelle des Selbstkonzepts
- Methodologie der empirischen Untersuchung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 dient als Einleitung. Kapitel 2 behandelt theoretische Grundlagen zum Selbstkonzept, Hörbeeinträchtigungen, und verschiedenen Beschulungsformen. Die verschiedenen Modelle der Integration und Inklusion werden diskutiert. Kapitel 3 beschreibt die Methodik der empirischen Studie. Kapitel 4 präsentiert die deskriptiven Ergebnisse der Untersuchung, während Kapitel 5 eine Diskussion der Ergebnisse vornehmen wird (ohne Ergebnisse aus Kapitel 5 und 6).
Schlüsselwörter
Selbstkonzept, Hörbeeinträchtigung, inklusive Beschulung, integrative Beschulung, segregative Beschulung, Förderzentrum, empirische Forschung, quantitative Sozialforschung.
- Arbeit zitieren
- Eva Schürmann-Lanwer (Autor:in), 2012, Das Selbstkonzept von Jugendlichen mit Beeinträchtigungen im Hören. Eine Gegenüberstellung von Förder- und integrativer Beschulung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1516847