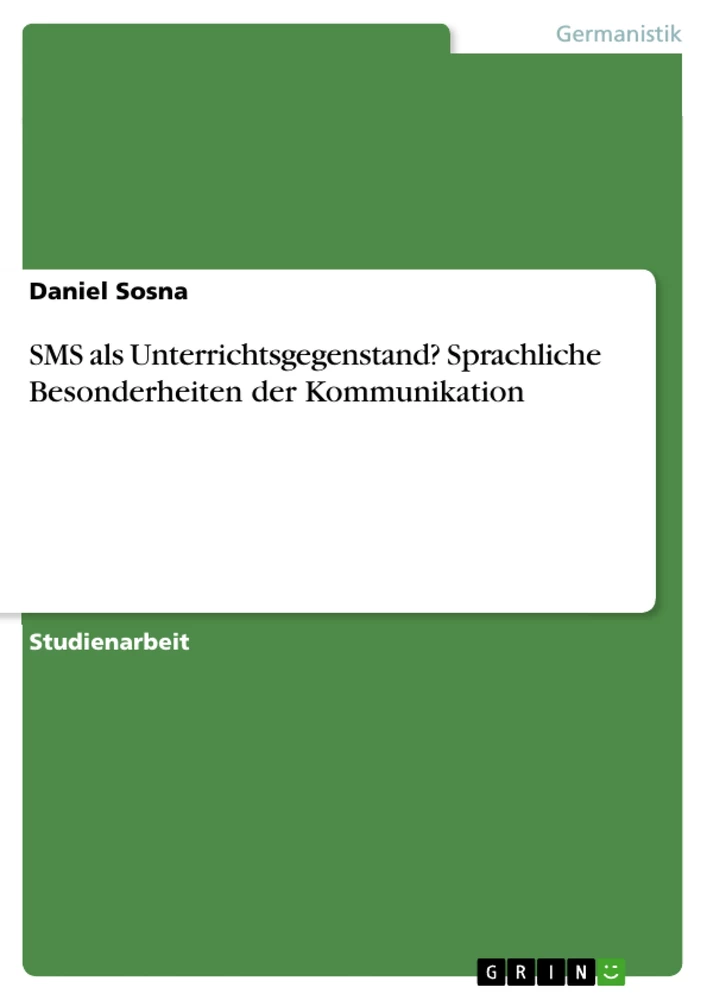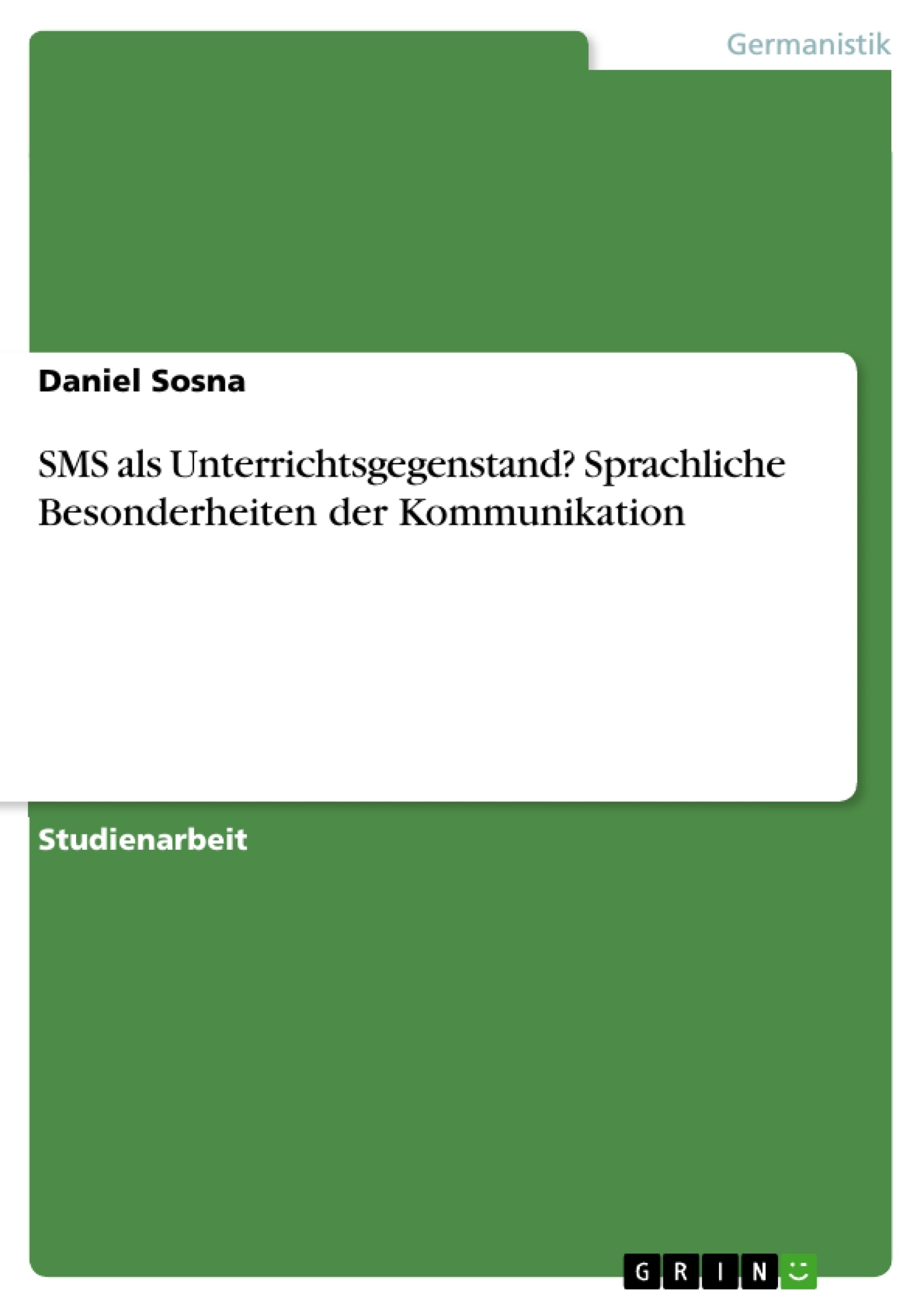Die vorliegende Eruierung beschäftigt sich beginnend mit den sprachlichen Besonderheiten der SMS-Kommunikation. Dazu sollen zunächst die Kommunikationsform SMS und ihre Funktionen untersucht werden. Um dem begrenzten Umfang der Arbeit gerecht zu werden, sollen anschließend drei ausgewählte sprachliche Phänomene, die besonders häufig in Kurznachrichten Anwendung finden, einer genaueren Betrachtung unterzogen werden: die Verwendung von Abkürzungen und Akronymen, die Groß- und Kleinschreibung in SMS und die Verwendung von Emoticons.
Bei allen Erscheinungen soll herausgearbeitet werden, wie sie im Einzelnen in Textnachrichten zu finden sind und welche Funktion sie erfüllen. Die Ergebnisse beanspruchen dabei keinesfalls ein absolutes Höchstmaß an Allgemeingültigkeit und Validität, da die sprachlichen Merkmale von SMS-Botschaften nicht nur durch das Medium Mobiltelefon bestimmt sind, sondern eben auch durch die Eigenschaften und persönlichen Beziehungen der Kommunizierenden.
Da SMS im Alltag von Kindern und Jugendlichen eine immense Rolle spielen – sowohl in kommunikativer als auch finanzieller Hinsicht –, soll im zweiten Teil der Arbeit untersucht werden, inwieweit aktuelle Deutsch-Schulbücher und die Fachdidaktik die Thematik aufnehmen, wie sie sie präsentieren und inwiefern es überhaupt sinnvoll ist, eine sich so schnell verändernde Technik in Schulbüchern bzw. im Unterricht zu verorten. Die Ergebnisse des theoretischen Teils der Arbeit werden dabei mit etwaigen bereits vorhandenen Unterrichtsmaterialien abgeglichen, um so ihre Durchführbarkeit und wissenschaftliche Korrektheit zu evaluieren sowie gegebenenfalls Vorschläge zu unterbreiten, wie diese verbessert oder ergänzt werden können.
Als Grundlage für die Argumentation dieser Arbeit dienten vor allem die Beiträge von Nicola Döring, Christa Dürscheid, Jannis Androutsopoulos und Peter Schlobinski. Insgesamt ist die Forschungsliteratur zum Thema jedoch als übersichtlich einzuschätzen. Da sich der Mobilfunkmarkt in den letzten Jahren preislich sehr zugunsten der Verbraucher verändert hat, werden auch wesentlich mehr SMS (auch in der Massenkommunikation) gesendet.
Hierzu fehlen allerdings neuere Studien, sodass für die vorliegende Arbeit noch mit den SMS-Korpora und Untersuchungsergebnissen von 2001/2002 gearbeitet werden muss, deren Argumentation und Ergebnisse angesichts der rasant fortschreitenden technologischen Entwicklung im Jahre 2010 zuweilen äußerst veraltet und beinahe lächerlich wirken.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Eigenschaften von SMS und ihre Funktionen
- Sprachliche Besonderheiten in der SMS-Kommunikation
- Abkürzungen, Akronyme und Reduktionen
- Besonderheiten hinsichtlich der Groß- und Kleinschreibung
- Emoticons
- SMS als Unterrichtsgegenstand
- SMS in Lehrbüchern
- Bewusstmachung der Abweichungen von standard(schrift)sprachlichen Normen in SMS?
- Christa Dürscheid und die Unsichtbarkeit des Mediums
- Fazit
- Literatur- und Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der sprachlichen Besonderheit der SMS-Kommunikation. Ziel ist es, die Kommunikationsform SMS und ihre Funktionen zu untersuchen und drei ausgewählte sprachliche Phänomene, die in Kurznachrichten häufig vorkommen, genauer zu betrachten: Abkürzungen und Akronyme, die Groß- und Kleinschreibung sowie die Verwendung von Emoticons. Darüber hinaus wird die Relevanz von SMS als Unterrichtsgegenstand diskutiert und die Frage aufgeworfen, inwiefern aktuelle Deutsch-Schulbücher und die Fachdidaktik die Thematik aufnehmen.
- Sprachliche Besonderheiten der SMS-Kommunikation
- Funktionen von SMS
- Relevanz von SMS als Unterrichtsgegenstand
- Analyse von Abkürzungen, Akronymen, Groß- und Kleinschreibung sowie Emoticons in SMS
- Bewertung der Darstellung von SMS in Schulbüchern und der Fachdidaktik
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beleuchtet die wachsende Bedeutung der SMS-Kommunikation im Alltag. Sie führt in die Thematik ein und erläutert die Forschungsfrage und die Vorgehensweise der Arbeit.
Das erste Kapitel befasst sich mit den Eigenschaften der Kommunikationsform SMS und ihren Funktionen. Es werden die Besonderheiten der SMS-Kommunikation im Vergleich zu anderen Kommunikationsformen herausgestellt, wie beispielsweise die asynchrone und graphische Realisierung sowie die Beschränkung auf 160 Zeichen. Darüber hinaus werden die verschiedenen Funktionen von SMS, wie die private Kontaktpflege, die Behebung von Missverständnissen und die Nutzung in der Massenkommunikation, erläutert.
Das zweite Kapitel widmet sich den sprachlichen Besonderheiten der SMS-Kommunikation. Es werden drei ausgewählte Phänomene, die besonders häufig in Kurznachrichten Anwendung finden, genauer betrachtet: die Verwendung von Abkürzungen und Akronymen, die Groß- und Kleinschreibung in SMS und die Verwendung von Emoticons. Für jedes Phänomen werden Beispiele aus SMS-Texten analysiert und die Funktionen der jeweiligen sprachlichen Besonderheiten erläutert.
Das dritte Kapitel untersucht die Relevanz von SMS als Unterrichtsgegenstand. Es wird die Frage aufgeworfen, inwiefern aktuelle Deutsch-Schulbücher und die Fachdidaktik die Thematik aufnehmen und wie sie sie präsentieren. Die Ergebnisse des theoretischen Teils der Arbeit werden mit etwaigen bereits vorhandenen Unterrichtsmaterialien abgeglichen, um ihre Durchführbarkeit und wissenschaftliche Korrektheit zu evaluieren und gegebenenfalls Vorschläge zu unterbreiten, wie diese verbessert oder ergänzt werden können.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die SMS-Kommunikation, sprachliche Besonderheiten, Abkürzungen, Akronyme, Groß- und Kleinschreibung, Emoticons, SMS als Unterrichtsgegenstand, Deutsch-Schulbücher, Fachdidaktik, Mediensprache, Sprachentwicklung, Textgestaltung.
- Quote paper
- Daniel Sosna (Author), 2010, SMS als Unterrichtsgegenstand? Sprachliche Besonderheiten der Kommunikation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151702