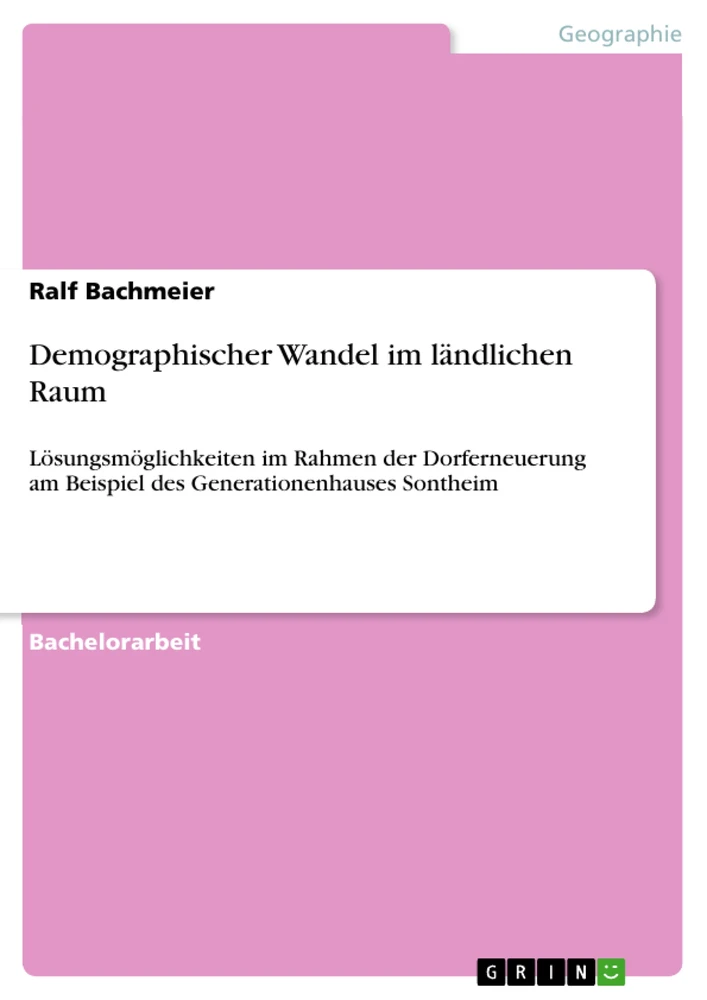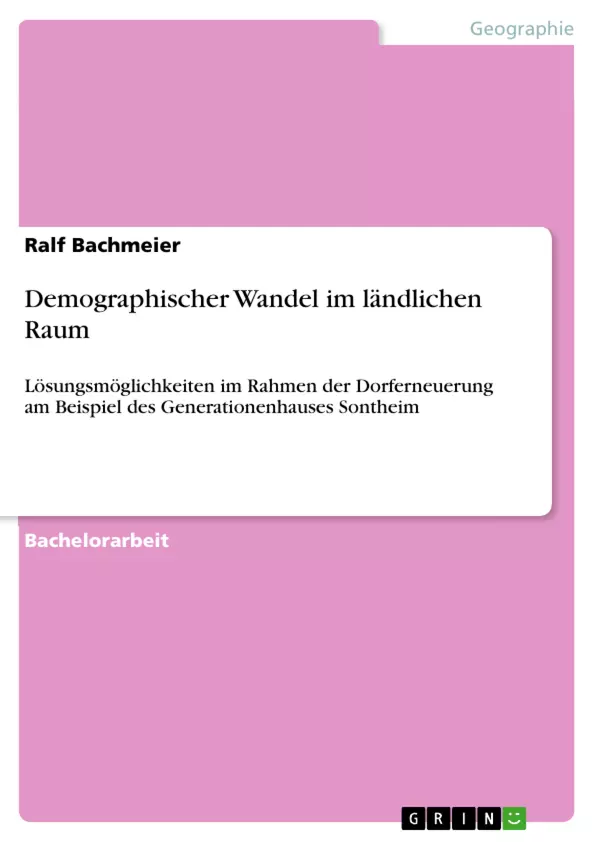Ziel dieser Arbeit ist es, anhand eines Beispieldorfes aufzuzeigen, welche Lösungsmöglichkeiten die Dorferneuerung bietet, um den Auswirkungen des Demographischen Wandels entgegenzuwirken.
Zu Beginn befasst sich die Arbeit mit den Faktoren, die den Demographischen Wandel in Deutschland bedingen. Der Rückgang der Bevölkerungszahl und der Wandel der Altersstruktur hin zu einer älteren Gesellschaft bewirkt eine erhebliche Veränderung des sozialen Gefüges und stellt vor allem die ländlichen Regionen vor enorme Herausforderungen, die in der vorliegenden Arbeit betrachtet werden. Das Bayerische Dorferneuerungsprogramm hat zum Ziel, Kommunen im ländlichen Raum bei der Bewältigung der genannten Probleme zu unterstützen. Aus den dargestellten Herausforderungen werden im Folgenden Lösungsmöglichkeiten abgeleitet, die sich im Rahmen der Durchführung der Dorferneuerungen herausgebildet haben.
Zur genauen Recherche der Lösungsansätze und Wirkung einer Dorferneuerung wurden Gespräche mit Experten geführt. Mithilfe der aus diesen Gesprächen am Beispiel der Gemeinde Sontheim gewonnenen Ergebnissen und zusätzlichem aus Literaturquellen erworbenem Fachwissen wird dargestellt, mit welchen Strategien eine Reduzierung der Konsequenzen des Demographischen Wandels in den Gemeinden im ländlichen Raum herbeigeführt werden kann. Das Beispiel des Generationenhauses Sontheim zeigt wie mit Hilfe des Einsatzes der Bürgerinnen und Bürger der eigenen Gemeinde, eine sinnvolle und praktikable Lösung in der Versorgungsproblematik der Kinder und Senioren geschaffen werden konnte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Motivation
- Fragestellungen, Überblick und Lösungsweg
- Der Demographische Wandel in Deutschland
- Begriff „Demographischer Wandel”
- Ursachen für den Demographischen Wandel
- Folgen des Demographischen Wandels
- Herausforderungen für die Gemeinden im ländlichen Raum
- Der ländliche Raum
- Probleme in der Daseinsvorsorge und Infrastruktur
- Bauliche Entwicklungen
- Soziale Problemstellungen
- Lösungsmöglichkeiten durch die Dorferneuerung
- Grundlagen
- Trägerschaft
- Strategie
- Maßnahmen
- Ablauf
- Ziele
- Innenentwicklung
- Grundlagen
- Aufgaben
- Maßnahmen
- Die Dorferneuerung in der Gemeinde Sontheim
- Ausgangssituation und Geschichte
- Veränderung der sozialen Strukturen
- Die Dorferneuerung Sontheim
- Ablauf
- Dorferneuerungsmaßnahmen
- Kosten und Finanzierung
- Das Generationenhaus Sontheim
- Grundidee und Entstehung
- Trägerschaft
- Finanzierung
- Aktivitäten
- Erfolge
- Erfolgsfaktoren
- Umsetzbarkeit für andere Gemeinden
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht anhand des Beispiels der Gemeinde Sontheim, welche Lösungsmöglichkeiten die Dorferneuerung bietet, um den Folgen des Demographischen Wandels in ländlichen Regionen entgegenzuwirken.
- Analyse des Demographischen Wandels in Deutschland: Ursachen, Folgen und Auswirkungen auf ländliche Räume
- Herausforderungen für die Daseinsvorsorge und Infrastruktur in ländlichen Gemeinden
- Das Bayerische Dorferneuerungsprogramm als Instrument zur Bewältigung des Demographischen Wandels
- Die Dorferneuerung in Sontheim als Beispiel für die praktische Umsetzung von Lösungsansätzen
- Das Generationenhaus Sontheim als Modellprojekt zur Verbesserung der sozialen Versorgung von Kindern und Senioren
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Bachelorarbeit ein und erläutert die Motivation, die Fragestellungen und den Lösungsweg der Untersuchung. Im zweiten Kapitel wird der Demographische Wandel in Deutschland beleuchtet, indem die Ursachen, Folgen und Auswirkungen auf das soziale Gefüge dargestellt werden. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den spezifischen Herausforderungen, die sich aus dem Demographischen Wandel für Gemeinden im ländlichen Raum ergeben, insbesondere im Hinblick auf Daseinsvorsorge, Infrastruktur und soziale Probleme.
Im vierten Kapitel werden die Grundlagen, Ziele und Maßnahmen der Dorferneuerung als Instrument zur Bewältigung des Demographischen Wandels erläutert. Der fünfte Abschnitt untersucht die Dorferneuerung in der Gemeinde Sontheim, die Ausgangslage, die Veränderungen der sozialen Strukturen und die konkreten Maßnahmen der Dorferneuerung. Im sechsten Kapitel wird das Generationenhaus Sontheim vorgestellt, dessen Entstehung, Trägerschaft, Finanzierung, Aktivitäten und Erfolge im Detail dargestellt werden.
Schlüsselwörter
Demographischer Wandel, ländlicher Raum, Dorferneuerung, Daseinsvorsorge, Infrastruktur, soziale Probleme, Generationenhaus, Kinder, Senioren, Sontheim, Bayerisches Dorferneuerungsprogramm.
Häufig gestellte Fragen
Welche Folgen hat der demographische Wandel für ländliche Räume?
Zu den Folgen gehören der Rückgang der Bevölkerungszahlen, eine Überalterung der Gesellschaft sowie Probleme bei der Daseinsvorsorge und der Erhaltung der Infrastruktur.
Wie hilft die Dorferneuerung gegen diese Entwicklung?
Die Dorferneuerung unterstützt Kommunen durch Strategien zur Innenentwicklung, bauliche Maßnahmen und die Förderung des sozialen Zusammenhalts, um Dörfer attraktiv zu halten.
Was ist das Generationenhaus Sontheim?
Es ist ein Modellprojekt, das durch bürgerschaftliches Engagement eine Lösung für die Versorgung von Kindern und Senioren in der Gemeinde geschaffen hat und den sozialen Austausch fördert.
Was bedeutet „Innenentwicklung“ in der Dorferneuerung?
Innenentwicklung zielt darauf ab, Leerstände im Ortskern zu nutzen und bestehende Gebäude zu sanieren, anstatt neue Baugebiete am Ortsrand auszuweisen.
Welche Rolle spielen die Bürger bei der Dorferneuerung?
Das Engagement der Bürger ist entscheidend für den Erfolg, da sie als Experten für ihren eigenen Lebensraum fungieren und Projekte wie das Generationenhaus oft selbst tragen.
- Arbeit zitieren
- Ralf Bachmeier (Autor:in), 2009, Demographischer Wandel im ländlichen Raum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151807