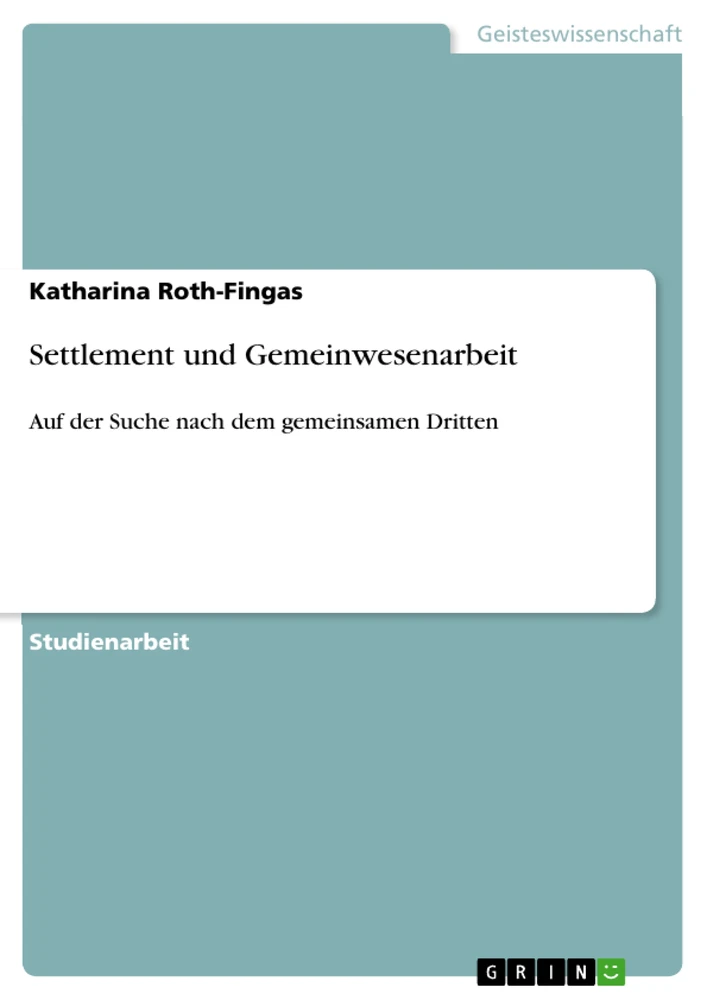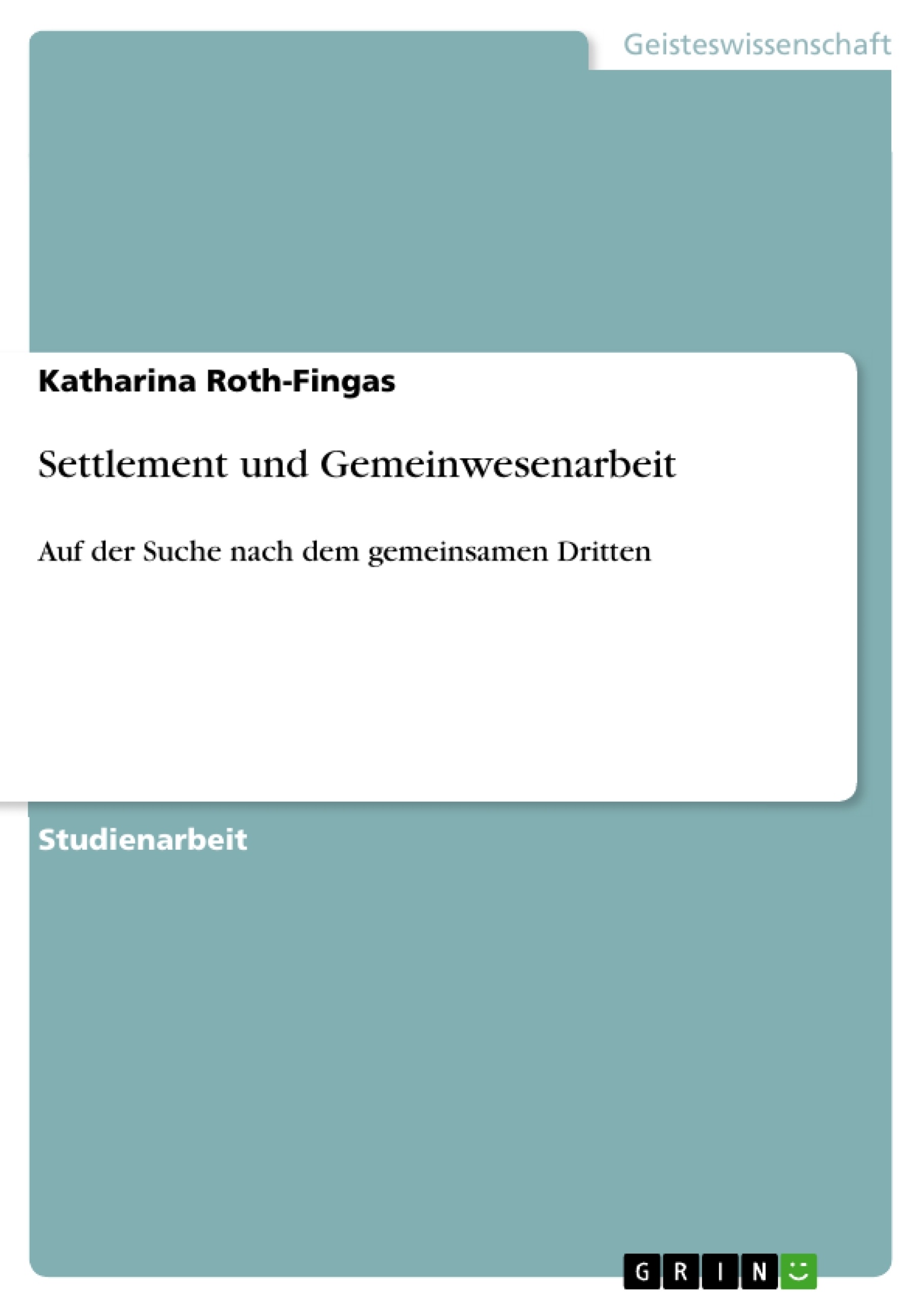Zu Zeiten der Industrialisierung entwickelten sich differente Methoden im Umgang mit Ar-men und Hilfebedürftigen. Dazu zählten u.a. Zucht-, Arbeits- und Armenhäuser. Deren Auf-gabe war es, vorhandene Armut zu beseitigen und auffällige Bürger zur Vernunft zu bringen. Dabei wurden Art und Weise wenig mit Aufmerksamkeit bedacht (vgl. Kunstreich 2002, Müller 2006).
Den Zucht-, Arbeits- und Armenhäusern standen die in England entstandenen Settlements gegenüber, die eine Lösung der Armutsproblematik ohne Gewalt und Drohung forderten. Die Settlementbewegung wollte einen Beitrag zum Umdenken leisten, indem sie den Menschen die Möglichkeiten gab, sich zu bilden, in Gemeinschaft zu leben und zu lernen, wechselseitige Beziehungen zu führen und so die Kompetenz für ein selbstbestimmendes Lebens zu erlangen. Das zu erreichen und auf längere Zeit oder gar auf Dauer zu halten, zog es die Settler in die Armen- und Arbeiterviertel der Städte, um sich vor Ort ein Bild der Problemlage zu ver-schaffen und sich dieser anzunehmen.
In Großbritannien waren dies das Pfarrerehepaar Henrietta und Samuel Barnett, als sie im Londoner Stadtteil Whitechapel Toynbee Hall als erstes Settlement gründeten. Es galt als Vorbild für einen deutlich besseren Umgang mit den Hilfebedürftigen und wurde schnell über England hinaus bekannt, was das Interesse von Jane Addams weckte, deren Kindheitstraum etwas Vergleichbares war. Nach einem Besuch nahm sie die Idee mit in die USA und gründe-te in Chicago Hull House (vgl. Kunstreich 2002, Müller 2006).
Beide Häuser legten den Grundstein für die heute bekannte Gemeinwesenarbeit und es ließe sich behaupten, dass die Settlements die erste Form dessen gewesen waren, aufgebaut mit einfachsten Mitteln und doch auch in der heutigen Zeit als Möglichkeit der Sozialen Arbeit aktuell.
Im Folgenden werde ich kurz einen historischen Überblick (1.0) geben, im Anschluss daran die Settlements (2.0) sowie die Gemeinwesenarbeit (3.0) erörtern. Danach werde ich den Kontext (4.0) darstellen und mit Schlussbemerkungen (5.0) enden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Überblick
- Die Settlementbewegung
- Definition
- Henrietta und Samuel Barnett - Toynbee Hall
- Jane Addams - Hull House
- Gemeinwesenarbeit
- Definition
- Merkmale und Ziele, Methodenvielfalt (und Grenzen)
- Kontext
- Schlussbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung der Settlementbewegung und der Gemeinwesenarbeit, zweier sozialer Bewegungen, die im 19. Jahrhundert als Reaktion auf die sozialen Missstände der Industrialisierung entstanden. Sie analysiert die Entstehung dieser Bewegungen, ihre wichtigsten Vertreter und deren Ideen, sowie die daraus resultierenden methodischen Ansätze und praktischen Anwendungen.
- Die Entstehung der Settlementbewegung als Reaktion auf die soziale Frage der Industrialisierung
- Die Rolle von Henrietta und Samuel Barnett und Jane Addams als Pioniere der Settlementbewegung
- Die zentralen Merkmale und Ziele der Gemeinwesenarbeit
- Die Verbindung zwischen der Settlementbewegung und der modernen Gemeinwesenarbeit
- Die Relevanz der Settlementbewegung und der Gemeinwesenarbeit für die Soziale Arbeit heute
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den historischen Kontext der Entstehung von Settlementbewegung und Gemeinwesenarbeit dar und skizziert die Problematik der Industrialisierung. Das zweite Kapitel bietet einen Überblick über die wichtigsten Aspekte des 19. Jahrhunderts, die die Entwicklung dieser Bewegungen beeinflusst haben, wie z.B. die Industrialisierung, die Armut, die Arbeitsbedingungen und die sozialen Missstände. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Settlementbewegung, indem es die Definition, die Begründer Henrietta und Samuel Barnett sowie deren Pionierprojekt Toynbee Hall in London, und die Bedeutung von Jane Addams und Hull House in Chicago beleuchtet. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Gemeinwesenarbeit, indem es ihre Definition, Merkmale, Ziele und Methodenvielfalt erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Sozialen Arbeit, wie z.B. Armut, soziale Ungleichheit, Industrialisierung, Settlementbewegung, Gemeinwesenarbeit, soziale Missstände, Selbsthilfe, Empowerment, Partizipation, soziales Engagement und sozialer Wandel.
- Quote paper
- BA of Arts-Social Work Katharina Roth-Fingas (Author), 2010, Settlement und Gemeinwesenarbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151817