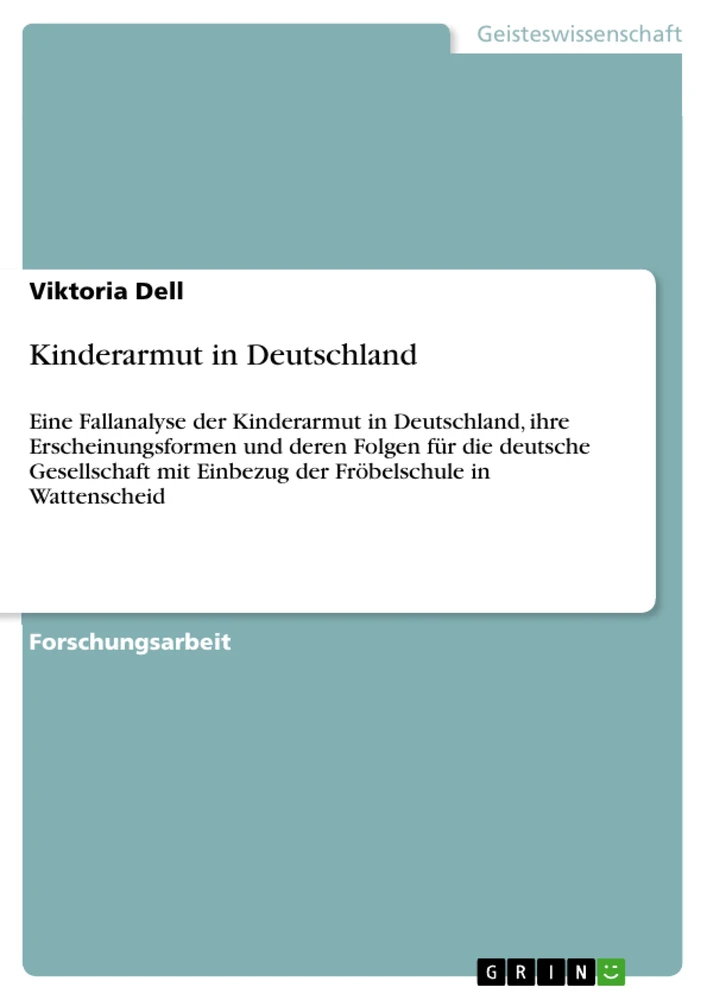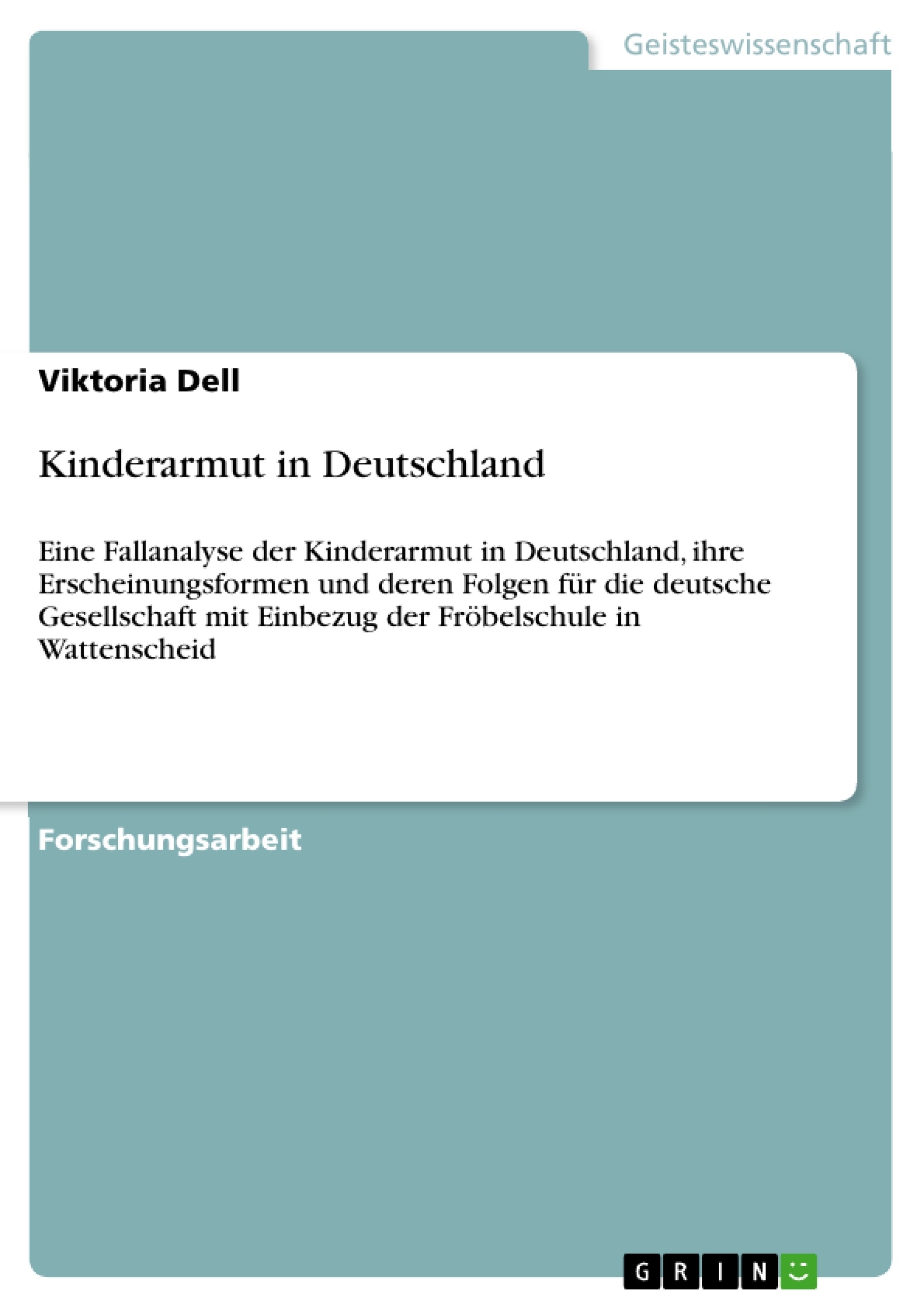Die vorliegende Fallanalyse handelt von der Kinderarmut in Deutschland, von deren Ursachen und Auswirkungen und davon, wie die Biografie eines Kindes durch Armut beeinflusst wird. Ausgangspunkt meiner Fallanalyse sind Ergebnisse der Artmutsforschung der letzten zwanzig Jahre. Für die vorliegende Arbeit wurden hauptsächlich neuere Studien des einundzwanzigsten Jahrhunderts verwendet.
Im ersten Teil werden Statistikergebnisse des aktuellen Armutsstands von Kindern und Jugendlichen aufgeführt und die Lebensstandards von Kindern und Jugendlichen dargestellt. Die wichtigsten Ergebnisse zu den Statistiken fasse ich aus dem Paritätischen Wohlfahrtsverband (2007), dem Armuts- und Reichtumsbericht (2008), dem Statistischen Bundesamt (2001) und dem Sozialbericht der EU-Kommission (2008) zusammen. Zentral geht es in meiner Fallanalyse darum, nachzuweisen mit welchen Konfliktsituationen sich Kinder und Jugendliche befassen müssen, wenn sie in armen Familienverhältnisse aufwachsen, welche Erscheinungsformen Armut aufzeigt und mit welchen Folgen die Betroffenen leben müssen und was es für die Gesellschaft bedeuten kann.
Im zweiten Teil wird die Fröbelschule in Wattenscheid, auch die Hartz-IV-Schule genannt, in Form einer Filmanalyse thematisiert. Hierbei gilt es, die Parallelen zur Fallanalyse Kinderarmut aufzuzeigen und die Folgen anhand einiger Beispiele [Film] zu benennen und mit den Ergebnissen aus der Fallanalyse abzugleichen.
Kinderarmut in Deutschland ist ein Thema, das erst in den letzten Jahren an Bedeutung gewann. Erst Studien der letzten zwanzig Jahre geben Auskunft über den Armutsstand von Kindern und Jugendlichen und über die Erscheinungsformen. Lange Zeit wurde beschwichtigt, es gebe keine Armut in unserer modernen, zivilisierten Gesellschaft. Stattdessen konzentrierte man sich auf die Armut in Ländern außerhalb von Europa, weil die Armut in Afrika, Indien und Co. greifbar ist und keinen Zweifel an ihrer Existenz erlaubt. In Deutschland jedoch schien alles Erforderliche zu existieren, Kinder könnten hier nicht verhungern, könnten ohne Schulbildung und Kultur gar nicht sein, hieß es. Doch die Zahlen über die Kinderarmut in Deutschland der letzten Jahre sprechen Bände. Die Armut ist nach wie vor nicht unbedingt sichtbar, dennoch schleicht sie sich immer mehr in unsere Gesellschaft ein und nimmt den Kindern Mut, Zuversicht und Hoffnung auf ein würdiges und lebensgerechtes Dasein in einer globalisierten Gesellschaft wie der unseren.
Inhaltsverzeichnis
EINFÜHRUNG
TEIL I: KINDERARMUT IN DEUTSCHLAND UND DIE FOLGEN
1. Einleitung
2. Definition von Armut
2.1 Infantilisierung der Armut
2.1.1 Von Sozialleistungen abhängige Kinder
2.2 Aktueller Armutsstand von Kindern und Jugendlichen
3. Lebensstandards
4. Von der Armut gefährdete Familien
5. Ursachen für die Kinderarmut in Deutschland
5.1 Erscheinungsformen
6. Folgen der Kinderarmut
6.1 Für die Betroffenen
6.1.1 Bildungschancen
6.1.2 Kulturelles Leben
6.1.3 Gesundheitsversorgung
6.1.4 Psychischer Zustand
6.2 Für die Gesellschaft
6.2.1 Sozialpolitische Fehlentwicklungen durch Kinderarmut
7. Mögliche Strategien gegen die Armut
7.1 Forderungen von einzelnen Hilfsträgern
7.2 Probleme bei der Umsetzung der Strategien
8. Resümee der Fallanalyse Kinderarmut in Deutschland
TEIL II: DIE FRÖBELSCHULE IN WATTENSCHEID
1. Einleitung
2. Die Hartz IV-Schule
3. Ergebnisse aus dem Film Die Hartz IV-Schule von Eva Müller
3.1 Die Fröbelschule
3.2 Statistiken zur Fröbelschule
3.3 Leistungen der Schule
3.4 Ansichten des Schuldirektors Christoph Graffweg
4. Fallbeispiele
4.1 Andrea
4.2 Michèle
4.3 Laura
4.4 Jasmin
5. Auswertung und Beurteilung der Fallbeispiele im Hinblick auf die Fallanalyse
LITERATURQUELLEN
FILMQUELLE
INTERNETQUELLEN
Häufig gestellte Fragen
Wie wird Kinderarmut in Deutschland definiert?
Armut wird meist relativ zum Durchschnittseinkommen definiert, wobei Kinder in Haushalten mit weniger als 60% des Medianeinkommens als armutsgefährdet gelten.
Welche Folgen hat Armut für die Biografie eines Kindes?
Armut beeinträchtigt Bildungschancen, die Gesundheit, die kulturelle Teilhabe und den psychischen Zustand der betroffenen Kinder massiv.
Was ist die "Fröbelschule" in Wattenscheid?
Sie wurde medial als "Hartz-IV-Schule" bekannt, da ein Großteil der Schüler aus Familien stammt, die von staatlichen Sozialleistungen abhängig sind.
Warum ist Kinderarmut in Deutschland oft "unsichtbar"?
In einer reichen Gesellschaft zeigt sich Armut nicht durch Verhungern, sondern durch soziale Ausgrenzung und den Mangel an Teilhabe am normalen gesellschaftlichen Leben.
Welche Ursachen gibt es für die Zunahme der Kinderarmut?
Ursachen sind unter anderem Arbeitslosigkeit der Eltern, niedrige Löhne, Alleinerziehung und sozialpolitische Fehlentwicklungen.
- Citar trabajo
- Viktoria Dell (Autor), 2009, Kinderarmut in Deutschland , Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151833