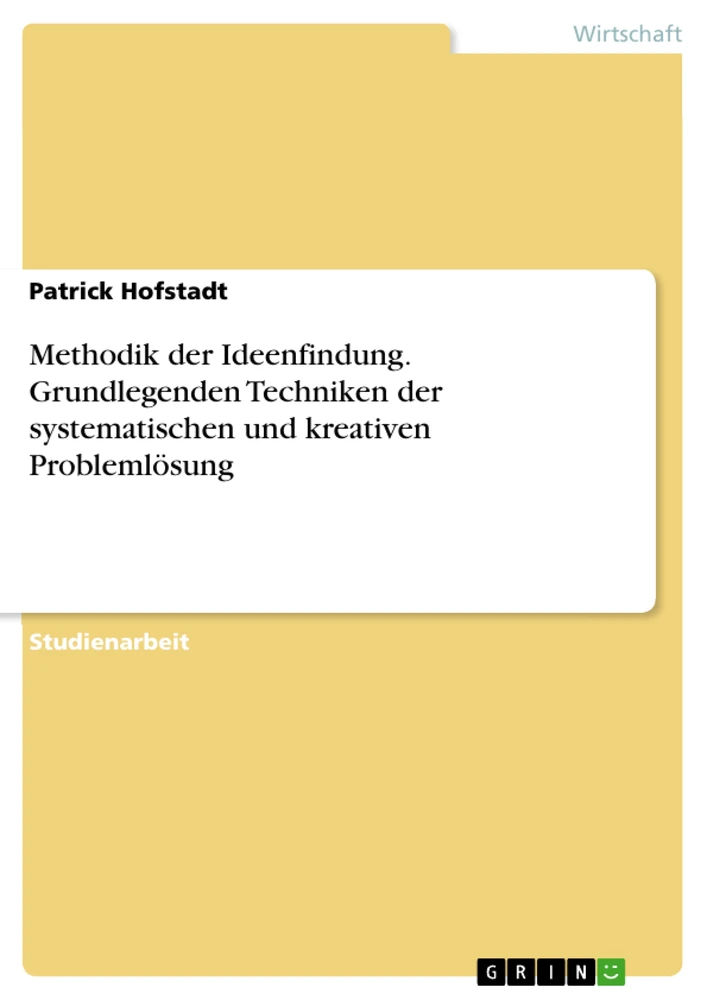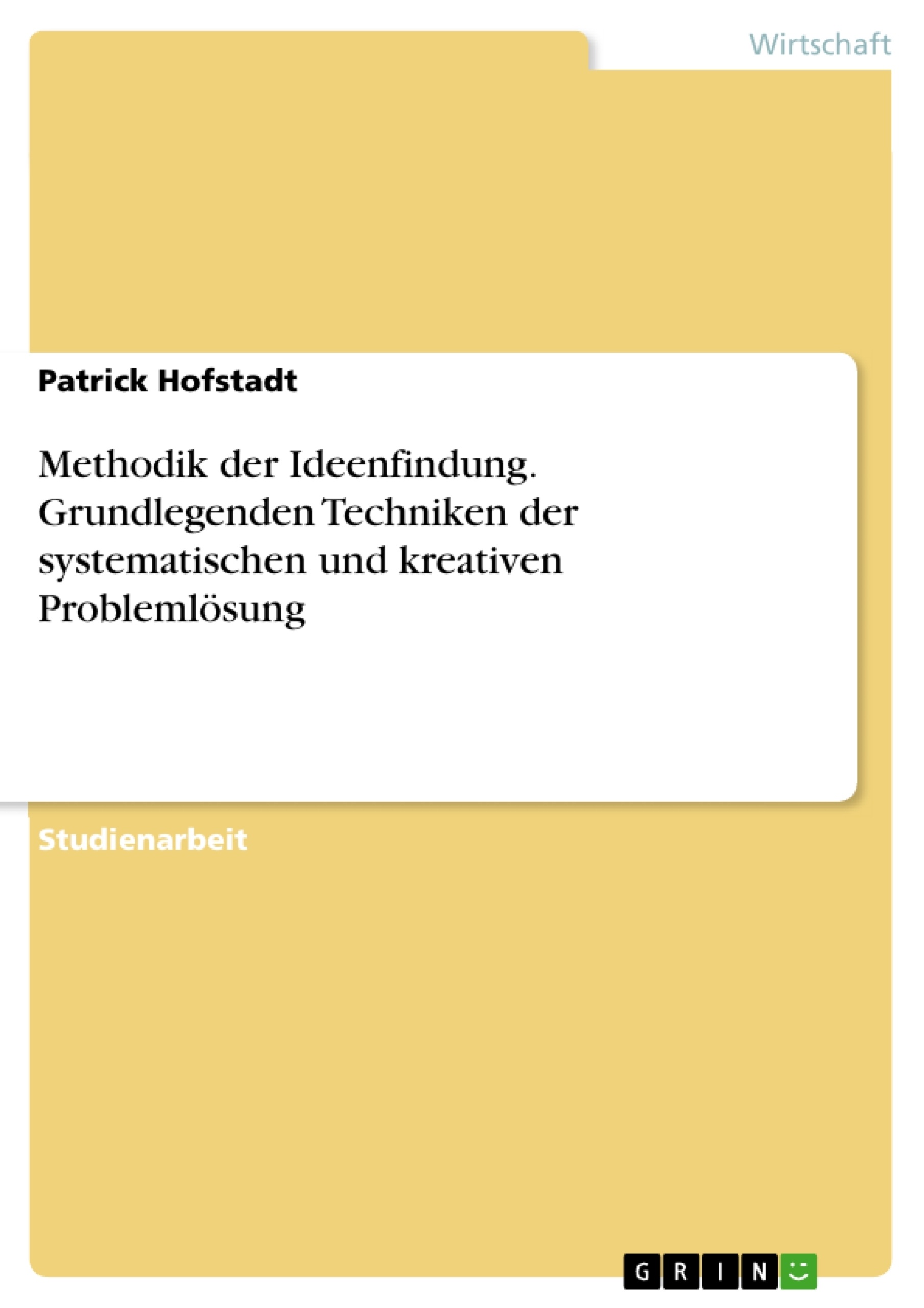Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen des Seminars „Dienstleistungsmarketing im Tourismus“ an der Universität Trier im Sommersemester 2004 verfaßt. Das Seminar richtete sich an Studierende des Hauptstudiums Betriebswirtschaftslehre.
Die Seminararbeit befaßt sich mit dem Thema Ideenfindung. Sie beinhaltet die grundlegenden Techniken der systematischen und der kreativen Problemlösung.
Die Arbeit
- erläutert die psychologischen Hintergründe, warum Menschen bei der Lösung eines Problems gegebenenfalls nicht erfolgreich arbeiten können,
- erklärt, an welcher Stelle dort geeignete Techniken ansetzen,
- führt die einzelnen gängigen Methoden der Ideenfindung auf und kategorisiert diese,
- weißt auf darüber hinausgehende Methoden hin, die entweder unterstützend oder integrierend genutzt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- Ideenfindung
- Einführung
- Die Funktionsweise des Gehirns
- Grundlegendes
- Kreativitätsblockaden und Grenzen der herkömmlichen Problemlösung
- Die vier Phasen des Problemlösens
- Die Methodik von Kreativitätsprozessen
- Einzelne Methoden der Ideenfindung
- Logisch-Systematische Methoden
- Osborn-Methode (Modifikations-Analyse)
- Vernetztes Denken
- Morphologischer Kasten / Morphologische Matrix
- Funktionsanalyse
- Produktproblemanalyse
- Umkehr-Methode
- 6-Hüte-Denken
- Intuitiv-kreative Methoden
- Bild- und Analogie-Methoden
- Visualisierung
- Bisoziation
- Reizworttechnik
- Synektik
- Synektik-Varianten
- Bionik
- Semantische Intuition
- Assoziationstechniken
- Brainstorming
- Brainstorming-Varianten
- Brainwriting / Methode 635
- Mindmapping
- Unterstützende Methoden zur Ideenfindung
- Pinnwandtechnik (Metaplantechnik)
- Ideenkasten
- Checklisten
- Zukunftswerkstatt
- Schlußbemerkung
- Literaturverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Die Funktionsweise des Gehirns und die Unterscheidung zwischen konvergentem und divergentem Denken
- Kreativitätsblockaden und die Grenzen herkömmlicher Problemlösungsansätze
- Logisch-systematische Methoden der Ideenfindung
- Intuitiv-kreative Methoden der Ideenfindung
- Unterstützende Methoden zur Ideenfindung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit dem Thema Ideenfindung und behandelt die Techniken der systematischen und kreativen Problemlösung. Sie beleuchtet die psychologischen Hintergründe, die das menschliche Denken bei der Lösung von Problemen beeinflussen und die Rolle von Ideenfindungsmethoden bei der Überwindung von Denkblockaden.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema Ideenfindung und die Bedeutung des Verständnisses der psychologischen Aspekte des Denkens für den Erfolg von Ideenfindungsmethoden vor. Kapitel 2 beleuchtet die Funktionsweise des menschlichen Gehirns und die Unterscheidung zwischen konvergentem und divergentem Denken. Es thematisiert auch den Zensor im menschlichen Gehirn, der eine Filterfunktion zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein übernimmt und die kreativen Assoziationen unterdrücken kann.
Kapitel 3 befasst sich mit einzelnen Methoden der Ideenfindung und gliedert sie in logisch-systematische und intuitiv-kreative Methoden. Die logisch-systematischen Methoden beinhalten beispielsweise die Osborn-Methode, das vernetzte Denken und die Morphologische Matrix, während die intuitiv-kreativen Methoden Techniken wie die Visualisierung, Bisoziation und Brainstorming umfassen.
Kapitel 4 präsentiert unterstützende Methoden zur Ideenfindung, wie die Pinnwandtechnik, den Ideenkasten, Checklisten und die Zukunftswerkstatt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche Ideenfindung, Problemlösung, Kreativität, divergentes Denken, konvergentes Denken, Zensor, logisch-systematische Methoden, intuitiv-kreative Methoden, Brainstorming, Morphologische Matrix, und die Unterstützung der Ideenfindung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen konvergentem und divergentem Denken?
Konvergentes Denken sucht nach der einen „richtigen“ Lösung, während divergentes Denken (kreatives Denken) darauf abzielt, viele verschiedene Ideen zu produzieren.
Was versteht man unter dem „Zensor“ im Gehirn?
Der Zensor ist eine psychologische Filterfunktion, die unbewusste, kreative Ideen unterdrückt, bevor sie das Bewusstsein erreichen, was oft zu Denkblockaden führt.
Nennen Sie Beispiele für logisch-systematische Methoden der Ideenfindung.
Dazu gehören die Osborn-Methode, der Morphologische Kasten, das vernetzte Denken und die Funktionsanalyse.
Welche intuitiv-kreativen Methoden gibt es?
Bekannte Methoden sind Brainstorming, Mindmapping, Synektik, Bionik und die Reizworttechnik.
Was ist die Methode 635?
Es ist eine Brainwriting-Technik: 6 Teilnehmer formulieren jeweils 3 Ideen in 5 Minuten, die dann im Kreis weitergegeben und ergänzt werden.
- Citar trabajo
- Dipl.-Kfm. Patrick Hofstadt (Autor), 2004, Methodik der Ideenfindung. Grundlegenden Techniken der systematischen und kreativen Problemlösung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151839