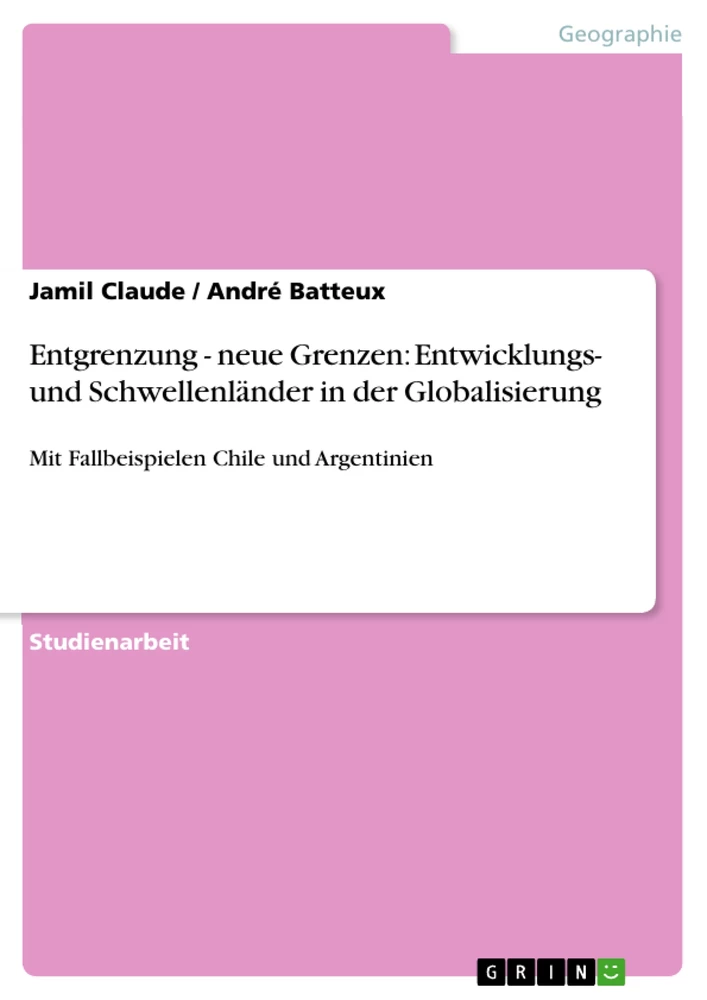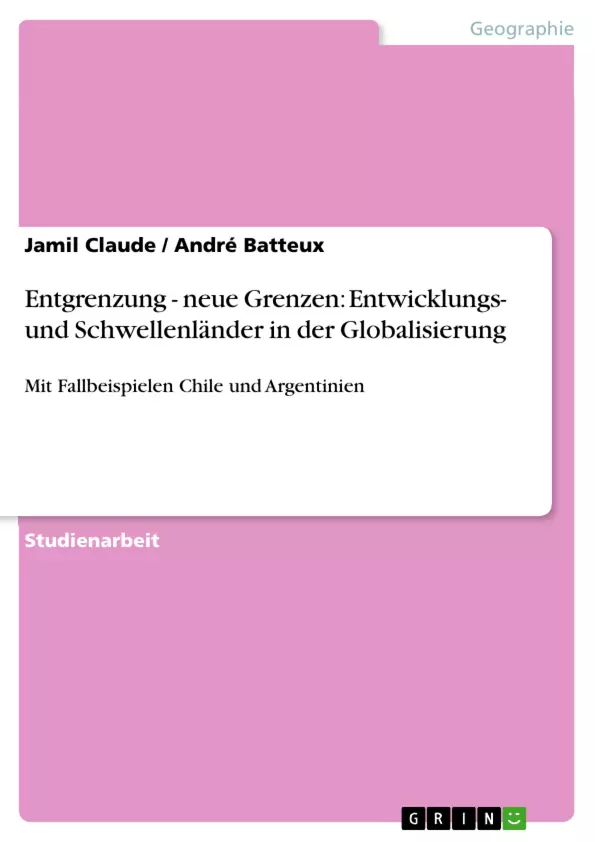Die Globalisierung ist keineswegs ein neues Phänomen des ausgehenden 20. Jahrhunderts, sondern vielmehr ein bereits 500 Jahre währender Prozess, welcher mit der Entdeckung der „Neuen Welt“ durch den Seefahrer Christoph Columbus im Jahre 1492 seinen Anfang nahm und fortan mit der Erschließung neuer, bisher unbekannter oder nicht- exploitierter Gebiete sowie einer zunehmenden Ausbreitung des Kapitals (und der kapitalistischen Marktwirtschaft) einherging. „Globalisierung, gedacht als unaufhörliche räumliche und soziale Expansion, stellt somit eine historische Konstante kapitalistischer Entwicklung dar. Sie ist aber auch eine seiner Voraussetzungen.“ (Parnreiter; Novy; Fischer 1999: 11)
Neu ist allerdings, dass dieser Globalisierungsprozess ab der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts eine sehr hohe, ihm eigene Dynamik entwickelte, in Folge derer neue Facetten (neue Entwicklungsstadien) dieses Prozesses auftauchten. Der im Rahmen dieser Hausarbeit interessante und relevante Zeitrahmen ist mit dem Ausbruch der Schuldenkrise zu datieren und dauert bis heute an. Spätestens seit 1982 lässt sich eine neue Qualität der Dynamik des Globalisierungsprozesses konstatieren, welche der deutsche Philosoph Jürgen Habermas treffender Weise als die „neue Unübersichtlichkeit“ bezeichnete.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- I.1. Definition der Globalisierung
- I.2. Die Ambivalenz des Globalisierungsprozesses
- II. Definition Fragmentierung
- II.1. Die „Theorie der fragmentierenden Entwicklung“ von Fred Scholz
- II.2. Veränderungen in der sozialen Struktur
- II.3. Die Fragmentierung des Nationalstaates
- II.3. Die neue Qualität sozialer Fragmentierung
- II.4. Informationsrevolution und Digital Divide
- III. Die Verselbstständigung der Finanzmärkte
- III.1. Welthandel / Freihandel
- IV. Die Schuldenkrise
- IV.1. Die Strukturanpassungpolitik von IWF und Weltbank
- V. Ökologische Grenzen
- VI. Fallbeispiel 1: Chile – Gewinner der Globalisierung?!
- VII. Fallbeispiel 2: Argentinien
- VII.2. Kurze Einleitung und historischer Abriss bis 1990
- VII.3. Die Situation nach 1990
- VII.4. Verlaufsprotokoll der Wirtschaftskrise
- VII.5. Die Wirtschaft Argentiniens
- VIII. Schlusswort und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Dynamik der Globalisierung, insbesondere seit der Schuldenkrise von 1982. Sie analysiert die Entgrenzung und die Entstehung neuer Grenzen im Kontext der Globalisierung für Entwicklungsländer. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Finanzwelt, der sozialen Strukturen und der ökologischen Herausforderungen.
- Die Ambivalenz der Globalisierung: Chancen und Risiken für Entwicklungsländer
- Die Fragmentierung der Gesellschaften und des Nationalstaates
- Die Rolle der Finanzmärkte und die Schuldenkrise
- Die ökologischen Folgen der Globalisierung
- Fallstudien Chile und Argentinien als Beispiele unterschiedlicher Entwicklungspfade
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung definiert Globalisierung als einen historischen Prozess, der seit der Entdeckung Amerikas andauert, aber seit den 1980er Jahren eine neue Dynamik entwickelt hat. Sie beschreibt vier neue Wesensmerkmale dieser Dynamik: die Deregulierung der Finanzwelt, die Informationsrevolution, die Veränderungen der Produktionsgeographie und die neue politische Weltordnung. Der Text betont die Ambivalenz des Prozesses, der sowohl Inklusion als auch Exklusion mit sich bringt, und kündigt die folgenden Analysen an.
II. Definition Fragmentierung: Dieses Kapitel untersucht den Prozess der Fragmentierung im Kontext der Globalisierung, basierend auf der „Theorie der fragmentierenden Entwicklung“ von Fred Scholz. Es beleuchtet die Veränderungen der sozialen Struktur, die Fragmentierung des Nationalstaates und die neue Qualität sozialer Ungleichheit. Der Digital Divide und seine Auswirkungen werden ebenfalls thematisiert, um das komplexe Bild der Fragmentierung zu vervollständigen.
III. Die Verselbstständigung der Finanzmärkte: Das Kapitel analysiert die zunehmende Deregulierung der Finanzwelt nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems und die daraus resultierende Entgrenzung der monetären Sphäre. Der Einfluss des Welthandels und des Freihandels auf diese Entwicklung wird untersucht, um die Verselbstständigung der Finanzmärkte im globalisierten Kontext zu verstehen.
IV. Die Schuldenkrise: Dieses Kapitel befasst sich mit den Ursachen und Folgen der Schuldenkrise, mit besonderem Augenmerk auf die Strukturanpassungspolitik des IWF und der Weltbank. Es analysiert den Einfluss dieser Politik auf die Entwicklungsländer und deren Auswirkungen auf die soziale und wirtschaftliche Situation.
V. Ökologische Grenzen: Dieses Kapitel thematisiert die ökologischen Folgen der Globalisierung, den hohen Naturverbrauch, Umweltzerstörung und die globale Verwertung natürlicher Ressourcen. Es untersucht die negativen Auswirkungen des Globalisierungsprozesses auf die Umwelt und die Notwendigkeit nachhaltigerer Praktiken.
VI. Fallbeispiel 1: Chile – Gewinner der Globalisierung?!: Dieses Kapitel präsentiert Chile als Fallbeispiel und analysiert dessen Entwicklung im Kontext der Globalisierung. Es untersucht die Frage, ob Chile tatsächlich von der Globalisierung profitiert hat und welche Herausforderungen das Land dennoch bewältigen muss.
VII. Fallbeispiel 2: Argentinien: Das Kapitel widmet sich Argentinien als Fallbeispiel, mit einem historischen Abriss bis 1990 und einer detaillierten Analyse der Situation nach 1990. Der Fokus liegt auf dem Verlauf der Wirtschaftskrise und der wirtschaftlichen Struktur Argentiniens im Kontext der Globalisierung.
Schlüsselwörter
Globalisierung, Entwicklungsländer, Fragmentierung, Finanzmärkte, Schuldenkrise, Strukturanpassung, ökologische Grenzen, Chile, Argentinien, Informationsrevolution, Neo-Liberalismus, Digital Divide.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Dynamik der Globalisierung
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Dynamik der Globalisierung seit der Schuldenkrise von 1982, insbesondere ihre Auswirkungen auf Entwicklungsländer. Der Fokus liegt auf der Veränderung der Finanzwelt, der sozialen Strukturen und der ökologischen Herausforderungen. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitel zur Definition von Globalisierung und Fragmentierung, die Rolle der Finanzmärkte und der Schuldenkrise, ökologische Grenzen und Fallstudien zu Chile und Argentinien.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die Ambivalenz der Globalisierung (Chancen und Risiken), die Fragmentierung von Gesellschaften und dem Nationalstaat, die Rolle der Finanzmärkte und die Schuldenkrise, die ökologischen Folgen der Globalisierung und vergleicht die Entwicklungspfade Chiles und Argentiniens anhand von Fallstudien.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert: Einleitung, Definition von Fragmentierung, Verselbstständigung der Finanzmärkte, die Schuldenkrise, ökologische Grenzen, Fallstudie Chile, Fallstudie Argentinien und ein Schlusswort. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Globalisierung und deren Auswirkungen.
Was wird unter „Fragmentierung“ verstanden?
Das Kapitel „Fragmentierung“ untersucht diesen Prozess im Kontext der Globalisierung, basierend auf der „Theorie der fragmentierenden Entwicklung“ von Fred Scholz. Es beleuchtet Veränderungen der sozialen Struktur, die Fragmentierung des Nationalstaates, neue soziale Ungleichheiten und den Einfluss des „Digital Divide“.
Welche Rolle spielen die Finanzmärkte?
Die Arbeit analysiert die zunehmende Deregulierung der Finanzwelt nach dem Ende des Bretton-Woods-Systems und die daraus resultierende Entgrenzung der monetären Sphäre. Der Einfluss des Welthandels und des Freihandels auf die Verselbstständigung der Finanzmärkte wird untersucht.
Wie wird die Schuldenkrise behandelt?
Das Kapitel zur Schuldenkrise befasst sich mit den Ursachen und Folgen, insbesondere mit der Strukturanpassungspolitik des IWF und der Weltbank und deren Auswirkungen auf Entwicklungsländer.
Welche ökologischen Aspekte werden berücksichtigt?
Die ökologischen Folgen der Globalisierung werden thematisiert, inklusive hohem Naturverbrauch, Umweltzerstörung und der globalen Verwertung natürlicher Ressourcen. Die negativen Auswirkungen auf die Umwelt und die Notwendigkeit nachhaltigerer Praktiken werden diskutiert.
Was sind die Fallstudien und was zeigen sie?
Die Arbeit beinhaltet Fallstudien zu Chile und Argentinien. Chile wird analysiert, um die Frage zu beantworten, ob es von der Globalisierung profitiert hat. Die Argentinien-Studie umfasst einen historischen Abriss bis 1990 und eine detaillierte Analyse der Situation danach, mit Fokus auf den Verlauf der Wirtschaftskrise.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Globalisierung, Entwicklungsländer, Fragmentierung, Finanzmärkte, Schuldenkrise, Strukturanpassung, ökologische Grenzen, Chile, Argentinien, Informationsrevolution, Neo-Liberalismus, Digital Divide.
- Citation du texte
- Jamil Claude (Auteur), André Batteux (Auteur), 2003, Entgrenzung - neue Grenzen: Entwicklungs- und Schwellenländer in der Globalisierung , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151862