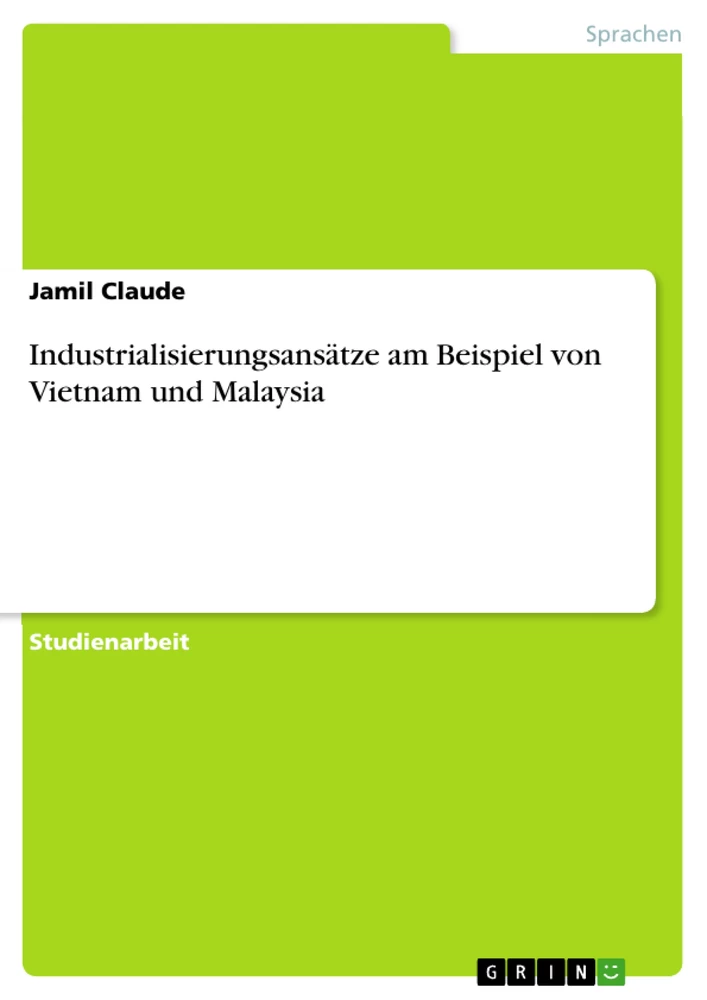Während der zweiten Hälfte des 20. Jh. kam es zu der Entstehung eines dritten
weltwirtschaftlichen Konzentrationsraums in SOA, innerhalb dessen auch Malaysia eine
besondere Rolle zukommt. Während Malaysia zum Zeitpunkt seiner Unabhängigkeit im
Jahre 1957 ein klassisches Beispiel eines Entwicklungslandes darstellte, dessen Industrie
vornehm auf dem Export von Naturressourcen (Zinnbergbau [a] und Kautschukplantagen
[b] entlang der Westküste; Anteil an den Exporterlösen (1957): [a] 25%; [b] 40%) aus dem
sogenannten „rubber and tin belt“ gründete, konnte Malaysia im Zeitraum zwischen 1977
und 1995 für sich eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 8,3% verbuchen. Mit
einem PKE von 3.890US$ (1995) gehört es heute zur Gruppe der Schwellenländer der 2.
Generation, der „Newly Industrializing Countries“ (NIC). Die erzielten Fortschritte
drücken sich z. B. in einer Reduzierung der Säuglingssterblichkeit von 45/1000 (1970) auf
12/1000 (1995), der Analphabetenrate von 40% (1975) auf 17% (1995) oder der
Haushaltsausstattung (KFZ je 1.000 Einw. 1970: 65; 1995: 339) aus. (Kulke 1998:191). Das
in Malaysia vorherrschende Politikmodell bezeichnet Johnson (1982) im Gegensatz zu dem
in traditionellen Industrieländern praktizierten „market-rational state“ als „plan-rational
state“. Dabei zeichnet sich das „plan-rational state“ Politikmodell dadurch aus, dass „… the
government will give greatest precedence to industrial policy, that is, to a concern with the
structure of domestic industry and with promoting the structure that enhences the nation’s
international competitivness. The very existence of an industrial policy implies a strategic,
or goal-oriented, approach to economy.” (Johnson 1982: 20; In: Wessel 1998: 165)
Inhaltsverzeichnis
- Malaysia
- Allgemeine Daten zu Malaysia
- Einleitung
- New Economic Policy und New Development Policy (NEP und NDP)
- Das "flying geese"- Modell
- Die 1980er Jahre
- Gründe/ Erklärungsansätze für den Erfolg der malaiischen Wirtschaftspolitik
- Regionale Disparitäten
- Malaysia und die Asienkrise
- Vision 2020 und der Multimedia Super Corridor (MSC)
- Der Bundesstaat Penang
- Einleitung
- Wirtschaft
- Transport und Verkehr
- Landnutzung
- Lebensbedingungen
- Ausblick
- Vietnam
- Allgemeine Daten zu Vietnam
- Einleitung
- Die Doi- Moi Politik des 6. Parteikongresses von 1986
- Sektorale Zusammensetzung ausländischer Direktinvestitionen
- Regionale Disparitäten
- Ausblick
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Industrialisierungsansätze in Malaysia und Vietnam. Sie beleuchtet die jeweiligen politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die zur Entwicklung dieser Länder beigetragen haben. Die Arbeit untersucht die Strategien, die zur Förderung der Industrialisierung eingesetzt wurden, und analysiert die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung, die soziale Struktur und die regionale Entwicklung.
- Politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Industrialisierung in Malaysia und Vietnam
- Strategien zur Förderung der Industrialisierung
- Auswirkungen der Industrialisierung auf die wirtschaftliche Entwicklung
- Auswirkungen der Industrialisierung auf die soziale Struktur
- Regionale Disparitäten und ihre Ursachen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit Malaysia. Es werden allgemeine Daten zu Malaysia vorgestellt, die geografische Lage, die Bevölkerungsstruktur und die wirtschaftlichen Kennzahlen. Anschließend wird die „New Economic Policy“ (NEP) und die „New Development Policy“ (NDP) vorgestellt, die die Grundlage für die Industrialisierung Malaysias bildeten. Das Kapitel beleuchtet auch das „flying geese“- Modell, das die Rolle Malaysias im asiatischen Wirtschaftsraum beschreibt. Die 1980er Jahre werden als Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs dargestellt, in der Malaysia zu einem Schwellenland avancierte. Das Kapitel analysiert die Gründe für den Erfolg der malaiischen Wirtschaftspolitik und beleuchtet die regionalen Disparitäten, die durch die Industrialisierung entstanden sind. Abschließend wird die „Vision 2020“ und der „Multimedia Super Corridor“ (MSC) vorgestellt, die die Zukunftsvisionen Malaysias für die weitere Entwicklung des Landes darstellen.
Das zweite Kapitel befasst sich mit Vietnam. Es werden allgemeine Daten zu Vietnam vorgestellt, die geografische Lage, die Bevölkerungsstruktur und die wirtschaftlichen Kennzahlen. Anschließend wird die „Doi- Moi Politik“ des 6. Parteikongresses von 1986 vorgestellt, die den Weg zur Marktwirtschaft und zur Öffnung Vietnams für ausländische Investitionen ebnete. Das Kapitel analysiert die sektorale Zusammensetzung ausländischer Direktinvestitionen und beleuchtet die regionalen Disparitäten, die durch die Industrialisierung entstanden sind. Abschließend wird ein Ausblick auf die zukünftige Entwicklung Vietnams gegeben.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die Industrialisierung, die Wirtschaftsentwicklung, die politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, die „New Economic Policy“ (NEP), die „New Development Policy“ (NDP), das „flying geese“- Modell, die „Doi- Moi Politik“, die regionalen Disparitäten, Malaysia, Vietnam und Südostasien.
Häufig gestellte Fragen
Was war die "New Economic Policy" (NEP) in Malaysia?
Die NEP war ein politisches Programm zur Armutsbekämpfung und zur Umstrukturierung der Gesellschaft, um die wirtschaftliche Dominanz ethnischer Gruppen auszugleichen.
Was besagt das "flying geese"-Modell?
Es beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung in Asien, bei der Japan als Führungsnation technologische Fortschritte an Schwellenländer wie Malaysia weitergibt.
Was ist die "Doi-Moi-Politik" in Vietnam?
Doi Moi bezeichnet die 1986 eingeleiteten Reformen zur Erneuerung der vietnamesischen Wirtschaft, die den Übergang von der Plan- zur Marktwirtschaft ermöglichten.
Warum gibt es regionale Disparitäten bei der Industrialisierung?
Industrie siedelt sich oft in Küstennähe oder Ballungsräumen an, was zu einem starken wirtschaftlichen Gefälle zwischen urbanen Zentren und ländlichen Regionen führt.
Was ist der Multimedia Super Corridor (MSC)?
Ein malaiisches Großprojekt zur Förderung der Hochtechnologie und Digitalisierung, um Malaysia bis 2020 zu einer voll entwickelten Industrienation zu machen.
- Citar trabajo
- Jamil Claude (Autor), 2003, Industrialisierungsansätze am Beispiel von Vietnam und Malaysia, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151864