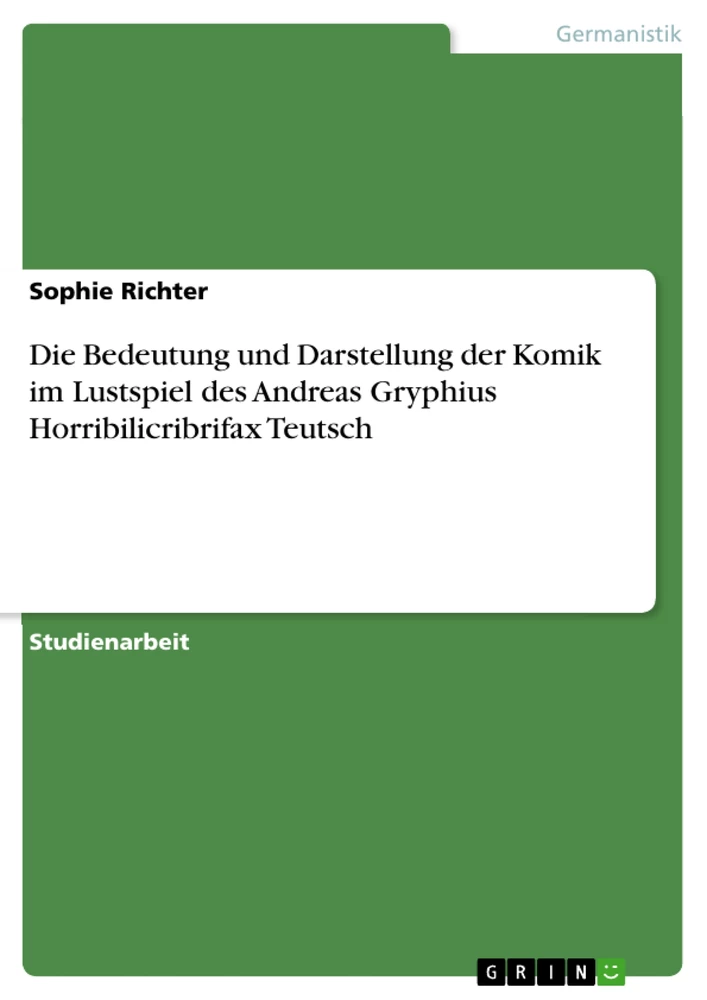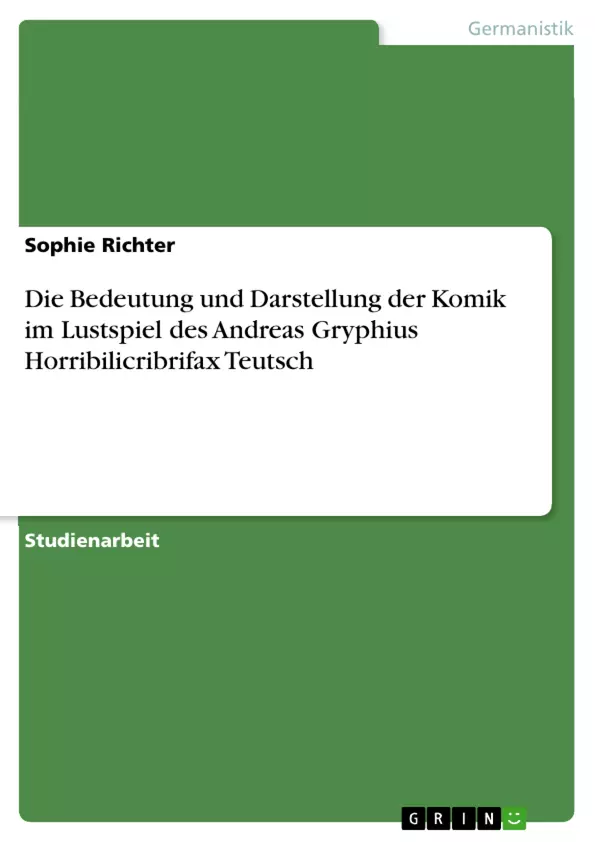Die Analyse bezieht sich auf die Komik im Lustspiel
allgemein, auf die Komik der einzelnen Figuren, sowie die Situationen, in denen sie
sich befinden und auf ihre Sprache. Im Fazit werde ich zusammenfassend zur
Bedeutung und Funktion der Komik dieses Lustspiels kommen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Barockzeit
- 1.1 Barockzeit
- 1.2 Das Leben des Andreas Gryphius
- 2 Das Drama Horribilicribrifax Teutsch
- 2.1 Titel
- 2.2 Gliederung und Gesamtaufbau
- 2.3 Figuren
- 2.4 Inhalt
- 2.5 Zur Entstehung des Dramas
- 2.6 Quellen und Vorbilder
- 3 Die Komik im Lustspiel Horribilicribrifax
- 3.1 Die Komik
- 3.2 Figurenkomik
- 3.3 Situationskomik
- 3.4 Sprachliche Komik
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung und Darstellung der Komik im Lustspiel "Horribilicribrifax Teutsch" von Andreas Gryphius. Ziel ist es, die verschiedenen Formen der Komik im Stück zu analysieren und deren Funktion im Kontext des Barocks zu beleuchten.
- Der Barock als historische und kulturelle Epoche
- Das Leben und Werk Andreas Gryphius
- Die verschiedenen Arten der Komik in "Horribilicribrifax Teutsch" (Figurenkomik, Situationskomik, sprachliche Komik)
- Die Funktion der Komik im Kontext des Stücks
- Die Bedeutung der Komik für das Verständnis des Werkes
Zusammenfassung der Kapitel
1 Barockzeit: Dieses Kapitel definiert den Begriff "Barock" und ordnet ihn zeitlich ein. Es beschreibt die kulturellen und politischen Umstände des Barocks in Deutschland, insbesondere die Auswirkungen des Dreißigjährigen Krieges und den Kontrast zwischen katholischer Liga und protestantischen Bund. Es werden die charakteristischen Merkmale der barocken Literatur und Kunst erläutert, wie z.B. Antithetik, Dualismen und die Spannung zwischen Altem und Neuem. Die Kapitel veranschaulicht die Komplexität des Barocks und die vielfältigen Einflüsse, die auf die Literatur dieser Epoche wirkten, und hebt die Bedeutung dieses Kontextes für die Interpretation von Gryphius' Werk hervor.
1.2 Das Leben des Andreas Gryphius: Dieses Kapitel skizziert das Leben des Andreas Gryphius im Kontext des Dreißigjährigen Krieges und der nachfolgenden politischen und sozialen Umbrüche in Schlesien. Es betont den Einfluss dieser Ereignisse auf Gryphius' Werk und seine religiöse Orientierung als prägende Kraft in seinem Schaffen. Das Kapitel bereitet den Boden für das Verständnis von Gryphius' "Horribilicribrifax Teutsch" durch die Darstellung seiner Biographie als Hintergrund für das künstlerische Werk.
2 Das Drama Horribilicribrifax Teutsch: Dieses Kapitel gibt eine Übersicht über Gryphius' Lustspiel "Horribilicribrifax Teutsch", einschließlich Titel, Aufbau, Figuren und Inhalt. Es dient als Einführung in das Stück und legt die Grundlage für die anschließende Analyse der komischen Elemente. Die Darstellung der Entstehungsgeschichte des Dramas und der Quellen liefert wichtige Kontextualisierung, um die spezifischen Merkmale des Stücks zu verstehen.
3 Die Komik im Lustspiel Horribilicribrifax: Dieses Kapitel analysiert die verschiedenen Formen der Komik in "Horribilicribrifax Teutsch", darunter Figurenkomik, Situationskomik und sprachliche Komik. Es untersucht, wie diese komischen Elemente zum Gesamteindruck des Stücks beitragen und welche Funktion sie im Kontext der barocken Literatur haben. Die Detailanalyse der einzelnen Komikformen und deren Interaktion zueinander liefert ein differenziertes Verständnis der komischen Wirkung des Stücks.
Schlüsselwörter
Andreas Gryphius, Horribilicribrifax Teutsch, Barock, Komik, Figurenkomik, Situationskomik, Sprachliche Komik, Dreißigjähriger Krieg, Barocke Literatur, Religiöse Aspekte.
Häufig gestellte Fragen zu Andreas Gryphius' "Horribilicribrifax Teutsch"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Komik in Andreas Gryphius' Lustspiel "Horribilicribrifax Teutsch" im Kontext des Barock. Sie untersucht verschiedene Formen der Komik (Figurenkomik, Situationskomik, sprachliche Komik) und deren Funktion innerhalb des Stücks und der Epoche.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Barock als historische und kulturelle Epoche, das Leben und Werk Andreas Gryphius, die verschiedenen Arten der Komik in "Horribilicribrifax Teutsch", die Funktion der Komik im Stück und deren Bedeutung für das Verständnis des Werkes.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zum Barock, dem Leben Gryphius', einer Beschreibung des Dramas "Horribilicribrifax Teutsch" (Titel, Aufbau, Figuren, Inhalt, Entstehung, Quellen), einer Analyse der Komik im Stück (Figurenkomik, Situationskomik, sprachliche Komik) und einem Fazit. Ein Inhaltsverzeichnis und eine Zusammenfassung der Kapitel sind enthalten.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel ist die Analyse der verschiedenen Formen der Komik in "Horribilicribrifax Teutsch" und die Beleuchtung deren Funktion im Kontext des Barocks. Es soll das Verständnis der komischen Elemente und ihrer Bedeutung für das gesamte Werk vertieft werden.
Welche Arten von Komik werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Figurenkomik, Situationskomik und sprachliche Komik in "Horribilicribrifax Teutsch".
Welchen Kontext liefert die Arbeit?
Die Arbeit liefert einen Kontext durch die Beschreibung des Barocks als Epoche, des Lebens und Werks Andreas Gryphius sowie der Entstehungsgeschichte und der Quellen des Dramas "Horribilicribrifax Teutsch".
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Andreas Gryphius, Horribilicribrifax Teutsch, Barock, Komik, Figurenkomik, Situationskomik, Sprachliche Komik, Dreißigjähriger Krieg, Barocke Literatur, Religiöse Aspekte.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
Wo finde ich mehr Informationen über Andreas Gryphius?
Weitere Informationen über Andreas Gryphius finden Sie in einschlägiger Literatur zur Barockliteratur und zu seinem Werk. Die Arbeit liefert hier eine erste Einführung in sein Leben und Schaffen.
- Quote paper
- Sophie Richter (Author), 2006, Die Bedeutung und Darstellung der Komik im Lustspiel des Andreas Gryphius Horribilicribrifax Teutsch, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151878