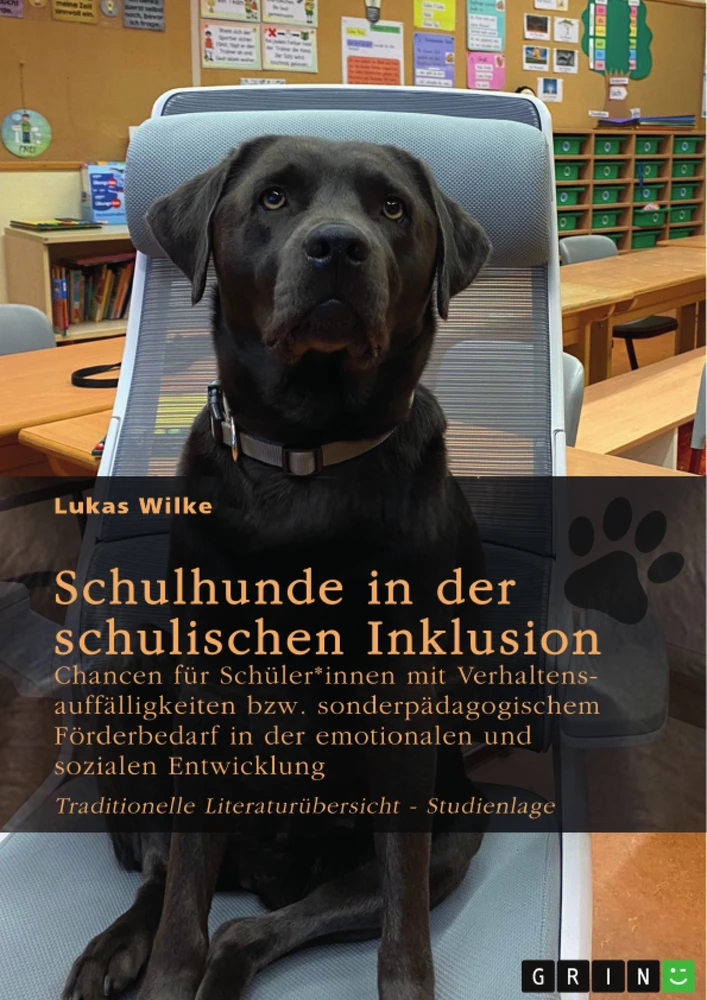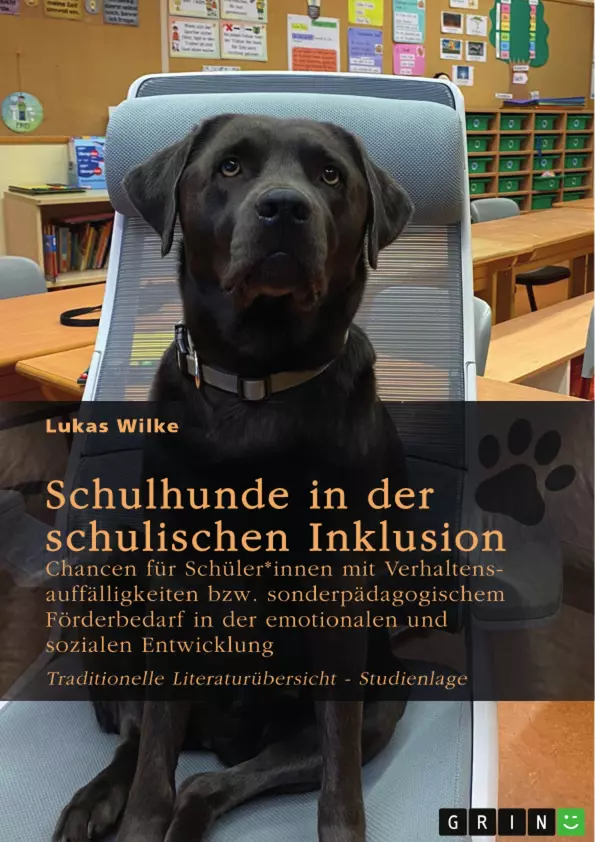Der Bedarf an (schulischen) Interventionsmöglichkeiten in dem Bereich der Verhaltensauffälligkeiten, Verhaltensstörungen bzw. Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung ist in Deutschland hoch, denn die betroffenen Schüler*innen sind die größte Herausforderung vieler Lehrer*innen. Die vorliegende Ausarbeitung setzt sich mit der Interventionsmöglichkeit Schulhunde auseinander. Das zentrale Ziel besteht darin, mithilfe der traditionellen Literaturübersicht, folgende Forschungsfrage zu beantworten:
„Welchen potenziellen Beitrag können Schulhunde allgemein und insbesondere in der schulischen Inklusion für Schüler und Schülerinnen leisten, die eine Verhaltensauffälligkeit bzw. einen sonderpädagogischen Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung haben?“
Die ausführlich in der Ausarbeitung beschriebene Methode "traditionelle Literaturübersicht" trägt dazu bei, dass eine umfangreiche Auseinandersetzung mit dem aktuellen Forschungsstand rund um das Thema erfolgt. Hilfreich dabei ist, dass alle aufgenommenen Studien der Ausarbeitung nach ihrer Relevanz zur Forschungsfrage übersichtlich in drei Kategorien geordnet sind:
Kategorie 1 beinhaltet u.a. Studien, die aus dem Bereich der Heimtierforschung und Psychotherapie stammen. In der Kategorie 2 werden Studien aufgeführt, die im engen Kontakt zu Schulhunden stehen bzw. Ähnlichkeiten zu Studien im schulischen Setting aufweisen und Kategorie 3 enthält Studien, die sich explizit mit Schulhunden beschäftigen.
Dem Leser bzw. der Leserin wird durch dieses Vorgehen die Möglichkeit geboten, eine umfangreiche Anzahl von Studien in übersichtlicher Form zu überblicken, die die Wirkung von Hunden und insbesondere von Schulhunden auf den Menschen untersucht haben.
Ein wichtiges Ergebnis der vorliegenden Arbeit ist, dass der Einsatz eines Schulhundes generell und vor allem in einem zunehmend inklusivem Schulsystem das Potenzial hat, Schutzfaktoren zu erhöhen und somit einen positiven Beitrag für alle Schüler*innen und insbesondere für jene mit Verhaltensauffälligkeiten bzw. Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung, zu leisten. Jedoch wird auch deutlich, dass der aktuelle Forschungsstand noch zu gering ist, um hochgradig eindeutige Ergebnisse zu erzielen. Abschließend weist die Ausarbeitung auf diesen Mangel hin und leitet mögliche Forschungsfragen für die Zukunft ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Bezug zur Heilpädagogik
- 1.2 Aufbau der Ausarbeitung
- 2. Methodik (traditionelle) Literaturübersicht
- 3. Definitionen rund um den Kontext „Verhaltensauffälligkeiten und Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung“
- 3.1 Ableitungen aus den genannten Definitionen für die vorliegende Ausarbeitung
- 4. Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten bzw. Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung
- 5. Wichtige schulische Schutzfaktoren für Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten bzw. mit dem Förderschwerpunkt emotionalen und sozialen Entwicklung
- 5.1 Bindungstheorien (Schutzfaktor sichere Bindung)
- 5.2 Selbstkonzept
- 5.3 Soziale und emotionale Kompetenzen
- 6. Weitere Auseinandersetzung mit möglichen Schutzfaktoren
- 6.1 Schulische Inklusion
- 6.2 Soziale Partizipation
- 6.3 Nicht gelingende soziale Partizipation bei Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten bzw. mit dem Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung
- 6.4 Welche Schutzfaktoren lassen sich aus der sozialen Partizipation ableiten?
- 6.5 Fazit - Darstellung aller beschriebenen Schutzfaktoren (sichere Bindung, Klassenklima, emotionale und soziale Kompetenzen, Stressregulation, Selbstkonzept, Lehrer-Schüler-Beziehung, Schulleistungen)
- 7. Wichtige Informationen rund um den Schulhund
- 8. Nennung negativer Aspekte rund um den Schulhund
- 9. Die Mensch-Tier-Beziehung – Theoretische Erklärungsansätze
- 9.1 Biophilie
- 9.2 Das Konzept der „Du-Evidenz“
- 9.3 Ableitungen aus den Bindungstheorien auf die Mensch-Tier-Beziehung
- 9.4 Fazit der Theorie der Mensch-Tier-Beziehung
- 10. Empirischer Forschungsstand
- 10.1 Kategorie 1
- 10.2 Kategorie 2
- 10.3 Kategorie 3
- 11. Beantwortung der Forschungsfrage
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Ausarbeitung untersucht den potenziellen Beitrag von Schulhunden zur Förderung von Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten oder einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung. Das zentrale Ziel ist die Beantwortung der Frage, welchen Beitrag Schulhunde, insbesondere im Kontext der inklusiven Schule, leisten können. Die Arbeit stützt sich auf eine traditionelle Literaturübersicht und kategorisiert die relevanten Studien nach ihrem Bezug zum Thema Schulhunde.
- Der Einfluss von Schulhunden auf das soziale und emotionale Lernen von Schüler*innen.
- Schulhunde als Schutzfaktor im Kontext von Verhaltensauffälligkeiten und emotionalen/sozialen Entwicklungsschwierigkeiten.
- Die Rolle der Mensch-Tier-Beziehung im schulischen Umfeld.
- Der aktuelle Forschungsstand zum Thema Schulhunde und dessen Limitationen.
- Mögliche Implikationen für die schulische Praxis und zukünftige Forschung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und begründet die Relevanz der Untersuchung zum Thema Schulhunde. Es beschreibt den hohen Bedarf an Interventionsmöglichkeiten für Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten und den Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Der Erfahrungsbericht eines Lehrers mit Schulhunden verdeutlicht positive Auswirkungen auf das Klassenklima. Die hohe Belastung von Pädagogen, die mit diesen Schüler*innen arbeiten, wird hervorgehoben, ebenso wie der Wunsch nach mehr Unterstützung im Kontext inklusiver Bildung. Das Kapitel führt die Forschungsfrage ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Die Bedeutung der sozialen Partizipation als zentraler Aspekt schulischer Inklusion wird betont und der Zusammenhang zwischen fehlender sozialer Partizipation, psychischen Belastungen und Verhaltensauffälligkeiten wird deutlich gemacht.
2. Methodik (traditionelle) Literaturübersicht: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Arbeit, die auf einer traditionellen Literaturübersicht basiert. Die Auswahl und Kategorisierung der Studien wird erläutert. Die Kategorisierung der Studien in drei Kategorien (Heimtierforschung/Psychotherapie, Studien mit Ähnlichkeiten zu schulischen Settings und Studien die sich explizit mit Schulhunden beschäftigen) wird als Methode zur Strukturierung des umfangreichen Materials vorgestellt.
3. Definitionen rund um den Kontext „Verhaltensauffälligkeiten und Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung“: Das Kapitel liefert präzise Definitionen zu Verhaltensauffälligkeiten und dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Es klärt die verwendeten Begriffe und legt die Grundlage für eine einheitliche Verwendung der Terminologie in der gesamten Arbeit. Die Ableitungen dieser Definitionen für die vorliegende Ausarbeitung werden erläutert und liefern einen wichtigen konzeptionellen Rahmen.
4. Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten bzw. Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet die Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsschwierigkeiten im emotionalen und sozialen Bereich. Es liefert einen Überblick über verschiedene Faktoren, die zu solchen Schwierigkeiten beitragen können, und bietet somit einen umfassenden Hintergrund für das Verständnis der Problematik.
5. Wichtige schulische Schutzfaktoren für Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten bzw. mit dem Förderschwerpunkt emotionalen und sozialen Entwicklung: In diesem Kapitel werden wichtige schulische Schutzfaktoren für Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten und emotionalen/sozialen Entwicklungsschwierigkeiten vorgestellt. Die Bedeutung von Bindungstheorien, dem Selbstkonzept und sozialen und emotionalen Kompetenzen als Schutzfaktoren wird ausführlich erläutert und ihre Bedeutung für die positive Entwicklung der Schüler*innen wird hervorgehoben.
6. Weitere Auseinandersetzung mit möglichen Schutzfaktoren: Das Kapitel erweitert die Diskussion der Schutzfaktoren durch die Betrachtung von schulischer Inklusion und sozialer Partizipation. Es analysiert die Herausforderungen bei der sozialen Partizipation von Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten und untersucht, welche Schutzfaktoren sich daraus ableiten lassen. Es fasst die beschriebenen Schutzfaktoren (sichere Bindung, Klassenklima, emotionale und soziale Kompetenzen, Stressregulation, Selbstkonzept, Lehrer-Schüler-Beziehung, Schulleistungen) zusammen.
7. Wichtige Informationen rund um den Schulhund: Dieses Kapitel präsentiert wichtige Informationen über den Einsatz von Schulhunden. Es liefert relevante Details über die Haltung, Ausbildung und Integration von Schulhunden in den Schulalltag, um einen umfassenden Überblick über die praktische Umsetzung des Konzepts zu bieten.
8. Nennung negativer Aspekte rund um den Schulhund: Dieses Kapitel widmet sich den potenziellen negativen Aspekten des Einsatzes von Schulhunden. Es benennt und diskutiert kritische Punkte, die im Zusammenhang mit Schulhunden beachtet werden müssen, um eine ausgewogene und realistische Betrachtung des Themas zu gewährleisten.
9. Die Mensch-Tier-Beziehung – Theoretische Erklärungsansätze: Das Kapitel untersucht die theoretischen Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung. Es beleuchtet Konzepte wie Biophilie und die „Du-Evidenz“ und leitet daraus Schlussfolgerungen für die Mensch-Tier-Beziehung im Kontext von Schulhunden ab. Die Bedeutung von Bindungstheorien für das Verständnis dieser Beziehung wird ebenfalls erläutert.
10. Empirischer Forschungsstand: Dieses Kapitel präsentiert den empirischen Forschungsstand zum Thema Schulhunde, gegliedert in drei Kategorien, um die unterschiedlichen Perspektiven und Forschungsergebnisse zu systematisieren und zu analysieren.
Schlüsselwörter
Schulhund, Inklusion, Verhaltensauffälligkeiten, emotionale und soziale Entwicklung, Schutzfaktoren, soziale Partizipation, Mensch-Tier-Beziehung, Bindungstheorien, empirische Forschung, Interventionsmöglichkeiten, schulische Praxis.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Ausarbeitung?
Die Ausarbeitung untersucht den potenziellen Beitrag von Schulhunden zur Förderung von Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten oder einem sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung.
Welche Ziele verfolgt die Ausarbeitung?
Das zentrale Ziel ist die Beantwortung der Frage, welchen Beitrag Schulhunde, insbesondere im Kontext der inklusiven Schule, leisten können. Die Arbeit stützt sich auf eine traditionelle Literaturübersicht und kategorisiert die relevanten Studien nach ihrem Bezug zum Thema Schulhunde.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Ausarbeitung behandelt?
Die Themenschwerpunkte umfassen den Einfluss von Schulhunden auf das soziale und emotionale Lernen von Schüler*innen, Schulhunde als Schutzfaktor, die Rolle der Mensch-Tier-Beziehung, den aktuellen Forschungsstand und mögliche Implikationen für die schulische Praxis und zukünftige Forschung.
Welche Methodik wird in der Ausarbeitung angewendet?
Die Ausarbeitung basiert auf einer traditionellen Literaturübersicht. Die Auswahl und Kategorisierung der Studien wird erläutert, wobei die Studien in drei Kategorien eingeteilt werden: Heimtierforschung/Psychotherapie, Studien mit Ähnlichkeiten zu schulischen Settings und Studien, die sich explizit mit Schulhunden beschäftigen.
Welche Definitionen werden in der Ausarbeitung verwendet?
Die Ausarbeitung liefert präzise Definitionen zu Verhaltensauffälligkeiten und dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Sie klärt die verwendeten Begriffe und legt die Grundlage für eine einheitliche Verwendung der Terminologie in der gesamten Arbeit.
Welche Ursachen für Verhaltensauffälligkeiten werden diskutiert?
Das Kapitel beleuchtet die Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten und Entwicklungsschwierigkeiten im emotionalen und sozialen Bereich. Es liefert einen Überblick über verschiedene Faktoren, die zu solchen Schwierigkeiten beitragen können.
Welche schulischen Schutzfaktoren werden hervorgehoben?
Wichtige schulische Schutzfaktoren für Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten und emotionalen/sozialen Entwicklungsschwierigkeiten werden vorgestellt. Die Bedeutung von Bindungstheorien, dem Selbstkonzept und sozialen und emotionalen Kompetenzen als Schutzfaktoren wird ausführlich erläutert.
Wie wird die soziale Partizipation betrachtet?
Die Diskussion der Schutzfaktoren wird durch die Betrachtung von schulischer Inklusion und sozialer Partizipation erweitert. Es analysiert die Herausforderungen bei der sozialen Partizipation von Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten und untersucht, welche Schutzfaktoren sich daraus ableiten lassen.
Welche Informationen werden zum Schulhund bereitgestellt?
Wichtige Informationen über den Einsatz von Schulhunden werden präsentiert. Es liefert relevante Details über die Haltung, Ausbildung und Integration von Schulhunden in den Schulalltag.
Welche negativen Aspekte werden im Zusammenhang mit Schulhunden genannt?
Das Kapitel widmet sich den potenziellen negativen Aspekten des Einsatzes von Schulhunden. Es benennt und diskutiert kritische Punkte, die im Zusammenhang mit Schulhunden beachtet werden müssen.
Welche theoretischen Erklärungsansätze werden für die Mensch-Tier-Beziehung herangezogen?
Die theoretischen Grundlagen der Mensch-Tier-Beziehung werden untersucht. Es beleuchtet Konzepte wie Biophilie und die „Du-Evidenz“ und leitet daraus Schlussfolgerungen für die Mensch-Tier-Beziehung im Kontext von Schulhunden ab.
Wie ist der empirische Forschungsstand gegliedert?
Der empirische Forschungsstand zum Thema Schulhunde ist in drei Kategorien gegliedert, um die unterschiedlichen Perspektiven und Forschungsergebnisse zu systematisieren und zu analysieren.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Ausarbeitung?
Schulhund, Inklusion, Verhaltensauffälligkeiten, emotionale und soziale Entwicklung, Schutzfaktoren, soziale Partizipation, Mensch-Tier-Beziehung, Bindungstheorien, empirische Forschung, Interventionsmöglichkeiten, schulische Praxis.
- Arbeit zitieren
- Lukas Wilke (Autor:in), 2024, Schulhunde in der schulischen Inklusion. Chancen für Schüler*innen mit Verhaltensauffälligkeiten bzw. sonderpädagogischem Förderbedarf in der emotionalen und sozialen Entwicklung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1519332