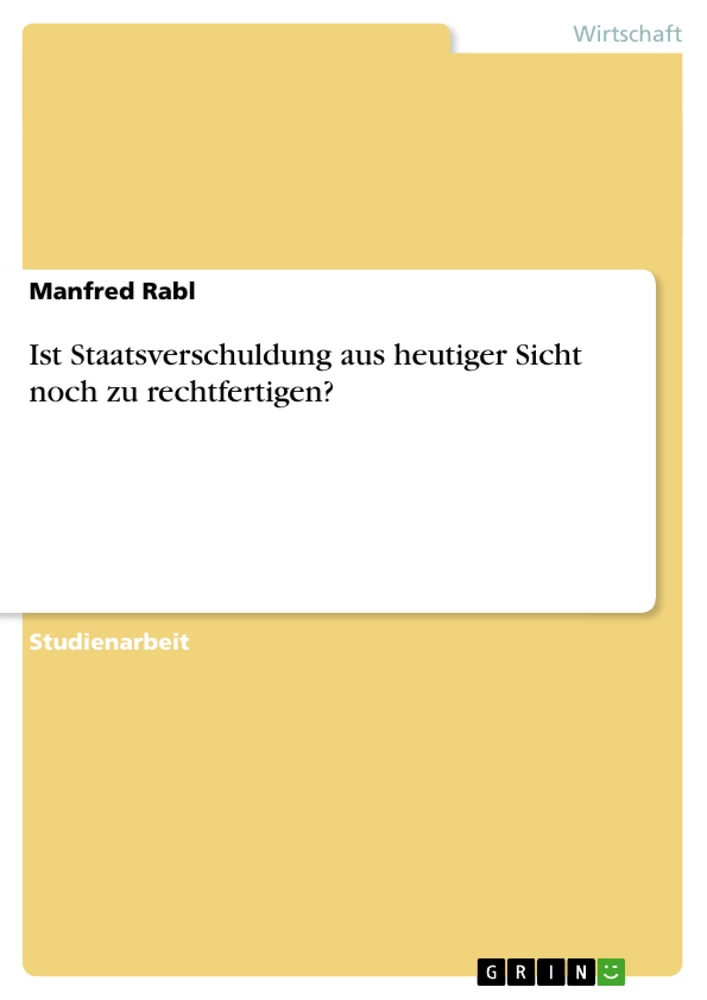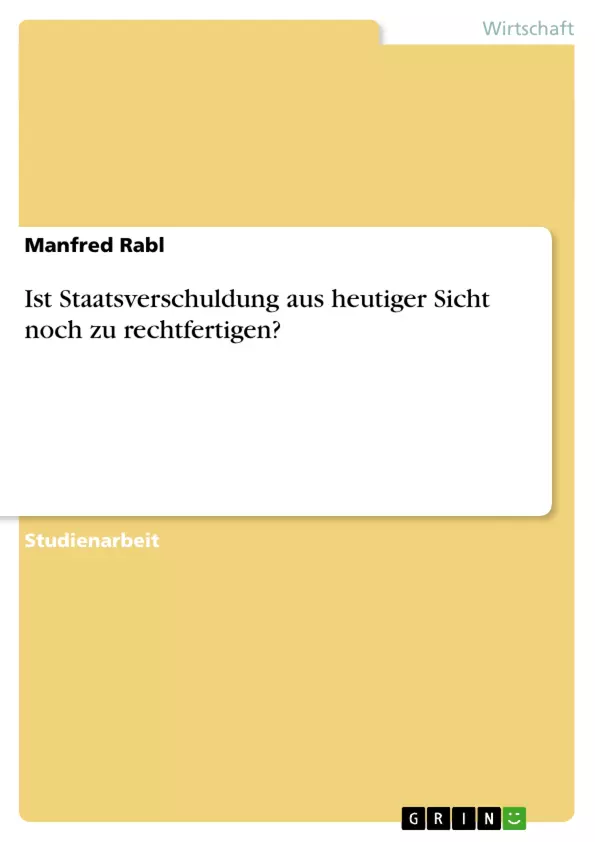In den letzten Monaten hat gerade die Frage ob Staatsverschuldung aus heutiger Sicht noch zu
rechtfertigen ist wieder an Aktualität gewonnen. Ein Grund dafür sind wohl die
Terroranschläge in den USA und der damit verbundene weltweite Konjunktureinbruch. Denn
schon werden die ersten Rufe nach staatlichem Handeln in Wirtschaft und Wissenschaft
lauter. So fordert beispielsweise Hans-Werner Sinn vom Münchner Ifo-Institut für
Wirtschaftsforschung ein Konjunkturprogramm auf G8-Ebene. Und auch Klaus
Zimmermann, der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin,
empfiehlt bei einer anhaltenden Abwärtsbewegung der Konjunktur ein koordiniertes
Infrastrukturprogramm für Europa. Kurzum fordern beide nach alter keynesscher Manier ein
kreditfinanziertes Konjunkturprogramm. Was in Deutschland noch gefordert wird, ist in den
Vereinigten Staaten bereits in die Tat umgesetzt worden, so hat die Regierung von George W.
Bush wenn man die 55 Milliarden Dollar Nothilfe, die Erhöhung des regulären Haushalts um
25 Milliarden Dollar und das Konjunkturprogramm von 60 bis 70 Milliarden Dollar
zusammenzählt bereits ein gigantisches Konjunkturprogramm gestartet, welches rund 1,5
Prozent des amerikanischen Bruttoinlandsprodukts entspricht. Im Gegensatz zu den USA
welche jahrelang gespart und Überschüsse erwirtschaftet haben, hat Deutschland mit dem
höchsten Haushaltsdefizit in der Euro-Zone einen weitaus geringeren finanziellen Spielraum.1
Ein weiterer Grund weshalb die Staatsverschuldung wieder in den Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses geraten ist, war wohl der drohende „blaue Brief“ aus Brüssel. Wegen
des hohen deutschen Haushaltsdefizits wollte EU-Währungskommissar Pedro Solbes
Deutschland eine formelle Frühwarnung schicken. Denn nach Berechnungen der Kommission
steigt die Gesamtwirtschaftliche Staatsverschuldung Deutschlands dieses Jahr auf 2,7 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts. Es ist daher zu befürchten das Deutschland die im Stabilitätspakt
verankerte Obergrenze von 3 Prozent erreicht oder gar überschreitet. Dies war für
Deutschland besonders bitter, da es sich bei Deutschland ja um den Erfinder des Europäischen
Stabilitätspaktes handelt.2 [...]
1 Vgl. Afhüppe, S./Gersemann, O./Gräf, P./Handschuch, K., Keynes, 2001, S. 22-27
2 Vgl. Afhüppe, S./Fischer, M./Hoffmann, M./Thelen, F., Blauer Brief, 2002, S. 23-27
Inhaltsverzeichnis
- Aktuelle Entwicklungen
- Begriffsdefinitionen
- Ökonomische Sichtweisen zur Staatsverschuldung
- Die klassische Sichtweise der Staatsverschuldung
- Das Keynessche Modell
- Das Ricardo-Barro-Äquivalenztheorem
- Folgen der Staatsverschuldung
- Finanzwirtschaftliche Folgen
- Realwirtschaftliche Folgen
- Kurzfristige realwirtschaftliche Folgen
- Langfristige realwirtschaftliche Folgen
- Realwirtschaftliche Folgen bei einer offenen Volkswirtschaft
- Monetäre Folgen
- Verteilungspolitische Folgen
- Ordnungspolitische Folgen
- Grenzen der Verschuldung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Frage, ob Staatsverschuldung aus heutiger Sicht noch zu rechtfertigen ist. Ziel ist es, die verschiedenen ökonomischen Sichtweisen auf Staatsverschuldung zu beleuchten und deren Folgen für die Finanzwirtschaft, die Realwirtschaft sowie die monetäre und verteilungspolitische Situation zu analysieren.
- Die klassische Sichtweise der Staatsverschuldung
- Das Keynessche Modell
- Das Ricardo-Barro-Äquivalenztheorem
- Finanzwirtschaftliche Folgen der Staatsverschuldung
- Realwirtschaftliche Folgen der Staatsverschuldung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die aktuellen Entwicklungen der Staatsverschuldung. Im zweiten Kapitel werden wichtige Begriffe wie Staatsverschuldung, Staatsdefizit und Staatshaushalt definiert. Das dritte Kapitel widmet sich den ökonomischen Sichtweisen auf Staatsverschuldung. Hier werden die klassische Sichtweise, das Keynessche Modell und das Ricardo-Barro-Äquivalenztheorem vorgestellt. Das vierte Kapitel befasst sich mit den Folgen der Staatsverschuldung. Es werden die Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft, die Realwirtschaft, die monetäre Situation, die Verteilung der Einkommen und die Ordnung der Wirtschaft analysiert. Das fünfte Kapitel untersucht die Grenzen der Verschuldung.
Schlüsselwörter
Staatsverschuldung, Staatsdefizit, Staatshaushalt, klassische Sichtweise, Keynessches Modell, Ricardo-Barro-Äquivalenztheorem, Finanzwirtschaft, Realwirtschaft, monetäre Folgen, verteilungspolitische Folgen, Ordnungspolitik, Grenzen der Verschuldung.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird Staatsverschuldung oft keynesianisch begründet?
Nach Keynes sollen Staaten in Krisenzeiten Kredite aufnehmen, um durch Investitionen die Konjunktur anzukurbeln (Deficit Spending).
Was ist das Ricardo-Barro-Äquivalenztheorem?
Es besagt, dass Staatsverschuldung wirkungslos ist, da Bürger künftige Steuererhöhungen erwarten und deshalb heute mehr sparen.
Welche Folgen hat eine hohe Staatsverschuldung?
Mögliche Folgen sind Zinslasten, Verdrängung privater Investitionen (Crowding-out) und eine Einschränkung des künftigen Handlungsspielraums.
Was regelt der Europäische Stabilitätspakt?
Er setzt eine Obergrenze für das Haushaltsdefizit von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts fest, um die Stabilität des Euro zu sichern.
Wann ist Staatsverschuldung ökonomisch sinnvoll?
In der klassischen Sicht ist sie nur für investive Zwecke vertretbar, die künftigen Generationen einen entsprechenden Nutzen hinterlassen.
- Arbeit zitieren
- Manfred Rabl (Autor:in), 2002, Ist Staatsverschuldung aus heutiger Sicht noch zu rechtfertigen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/15198