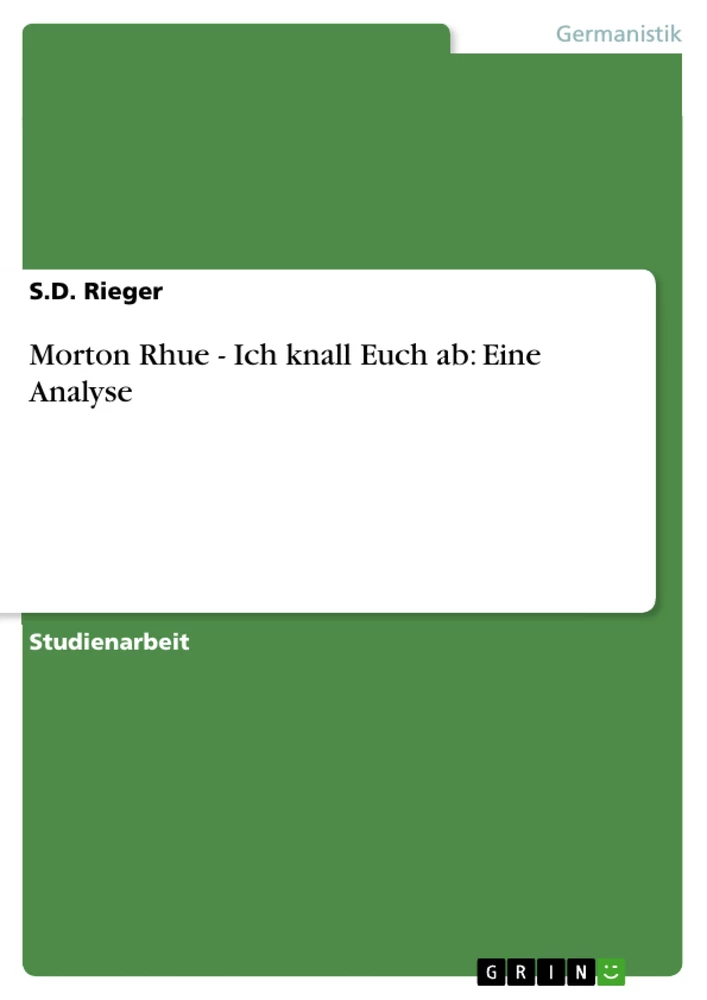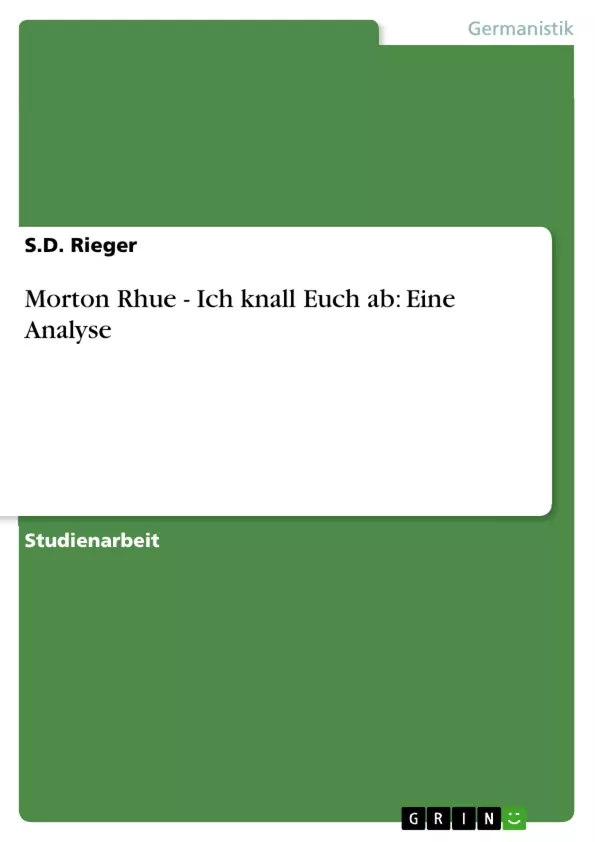Die Schule ist in mehrfacher Hinsicht relevant für Kinder- und Jugendbuchautoren. Spielt sich hier doch ein wesentlicher Teil des Lebens Heranwachsender ab, hier werden Weichen gestellt, die für das gesamte Leben von Bedeutung sein können. Neben der Familie und den Jugendkulturen ist die Schule die wichtigste Sozialisierungsinstanz.
Doch was passiert, wenn die Institution Schule als Vermittlungsinstanz zwischen Schülern versagt? Wenn durch das Verhalten von Lehrern und Intoleranz von Schülern Jugendliche sich so gedemütigt fühlen, dass sie den einzigen Ausweg in Gewalt sehen?
Die vorliegende Hausarbeit soll herausarbeiten, welche Faktoren die beiden Protagonisten Gary und Brendan in "Ich knall Euch ab" dazu geführt haben, die durch Andere erfahrene Gewalt mit denselben Mitteln zu bekämpfen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Inhaltsangabe
- Morton Rhue: Leben und Werk - Biographie
- Zeitgeschichtlicher Hintergrund
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit analysiert den Roman "Ich knall euch ab!" von Morton Rhue und untersucht die Faktoren, die die Protagonisten Gary und Brendan dazu bringen, Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung zu wählen. Darüber hinaus wird diskutiert, ob ein ähnliches Szenario an einer deutschen Schule denkbar wäre und welche Rolle die Medien am gesellschaftlichen Druck unter Jugendlichen an amerikanischen Highschools spielen.
- Analyse der Gewaltbereitschaft der Protagonisten
- Untersuchung der sozialen und schulischen Rahmenbedingungen
- Vergleich mit der deutschen Schullandschaft
- Einfluss der Medien auf das Verhalten von Jugendlichen
- Diskussion der Rolle von Außenseitern in der Schulgemeinschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Das Vorwort stellt die Bedeutung der Schule als Sozialisationsinstanz für Kinder und Jugendliche dar und thematisiert die Folgen von Versagen der Institution Schule. Es wird die Frage aufgeworfen, welche Faktoren dazu führen können, dass Jugendliche Gewalt als einzigen Ausweg sehen.
- Inhaltsangabe: Die Inhaltsangabe skizziert die Handlung des Romans, wobei der Fokus auf den Schulalltag der Protagonisten Gary und Brendan liegt. Die beiden Schüler, Außenseiter in ihrer Klasse, werden von den Cliquen an der Middletown Highschool ausgegrenzt und finden in ihrer gemeinsamen Ablehnung der herrschenden Normen eine Verbindung zueinander. Ihre Frustrationen äußern sie zunächst in Computerspielen, später in zunehmend gewalttätigen Fantasien und Plänen.
- Morton Rhue: Leben und Werk - Biographie: Dieser Abschnitt bietet eine kurze Biografie von Morton Rhue, seinem Schriftstellernamen, und stellt seine Werke vor, insbesondere sein bekanntestes Buch „Die Welle“.
- Zeitgeschichtlicher Hintergrund: Dieser Abschnitt behandelt den Kontext des Romans im Hinblick auf die Zunahme von Amokläufen an Schulen in den USA und Deutschland. Der Amoklauf an der Columbine High School wird als ein wichtiges Bezugspunkt für die Handlung des Romans "Ich knall euch ab!" vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Romans sind Schul- und Schülerromane, Gewalt unter Jugendlichen, Außenseiter in der Schulgemeinschaft, gesellschaftlicher Druck, Medienkonsum, Amokläufe an Schulen, amerikanische Highschools, Sozialisationsinstanz und die Rolle der Schule im Leben von Jugendlichen. Darüber hinaus werden Themen wie Fremdverstehen, die Folgen von Mobbing und die Auswirkungen von gewalttätigen Computerspielen behandelt.
- Citation du texte
- S.D. Rieger (Auteur), 2008, Morton Rhue - Ich knall Euch ab: Eine Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/151985