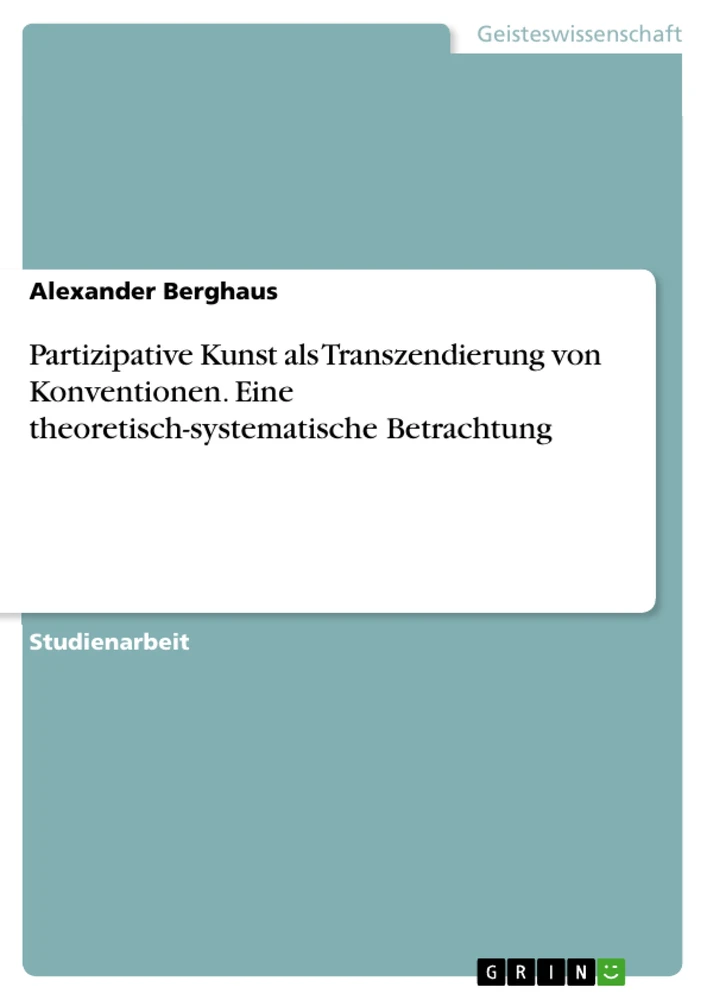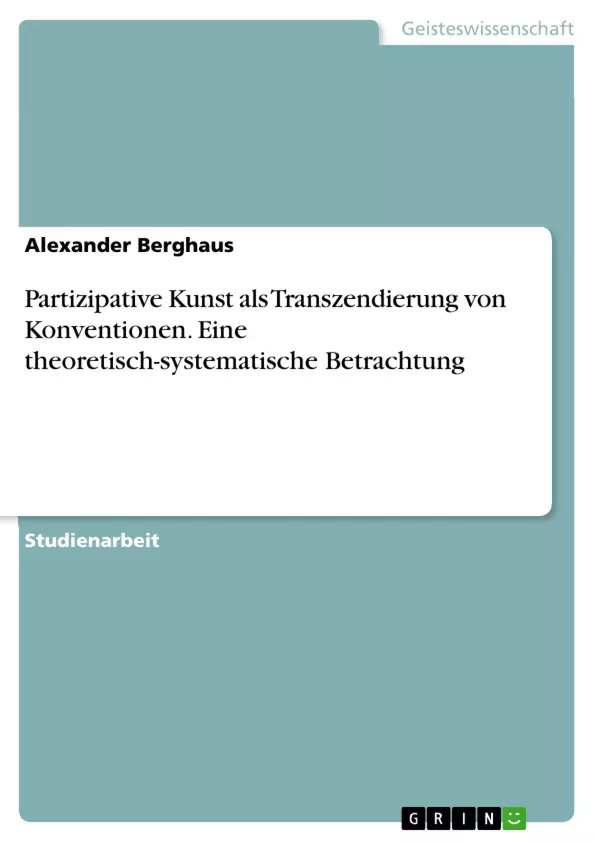Die Kernthese dieser Arbeit besteht darin, dass interaktive und partizipative Kunstformen bildender Kunst die bestehenden Konventionen zum Verhältnis zwischen Produzierenden und Rezipierenden transzendieren. Die Transzendenz besteht dabei darin, dass interaktive Kunstwerke in der Lage sind, die konzeptuelle Trennung von Produktion und Rezeption aufzuheben, ohne dabei notwendigerweise unkonventionell handeln zu müssen und damit gemäß der Beckerschen Theorie mit Missachtung sanktioniert zu werden.
Um die aufgestellte These zu belegen, erfolgt zunächst eine konzeptuelle Darstellung der Grundlagen interaktiver und partizipativer Kunst und den jeweiligen Auswirkungen dergleichen auf das Paradigma künstlerischer Autonomie. Die Aufhebung des Mythos der künstlerischen Autonomie des Produzierenden ist Voraussetzung dafür, das theoretische Verhältnis von Produzierenden und Rezipierenden auf seine Haltbarkeit hinsichtlich der Disziplin partizipativer Kunst hin zu untersuchen. Abschließend erfolgt die Erörterung über die Auswirkungen der Argumentation auf die Bedeutung von Konventionen für partizipative Produktionen und die Erklärung der Transzendierungsmechanismen eben jener Kunstwerke.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Theoretische Diskursformen bildender Kunst
- 2. Das Verhältnis partizipativer Kunst zur Autonomie künstlerischer Produktion
- 2.1 Grundlagen partizipativer Kunst
- 2.2 Paradigma künstlerischer Autonomie
- 3. Zur systematischen Trennbarkeit von Produzierenden und Rezipierenden
- 3.1 Theoretische Trennung von Produktions- und Rezeptionskontext
- 3.2 Kooperation und Binnenstrukturen zwischen Produktion und Rezeption
- 3.2.1 Beckers Theorie der Kooperation
- 3.2.2 Binnenstrukturen und semantisch-materialer Dualismus im Rezeptionsprozess
- 4. Partizipative Kunst als Transzendierung bestehender Konventionen
- 4.1 Konventionen und systemische Einflüsse auf den Prozess der Kunstschaffung
- 4.2 Partizipative Kunst als Transzendierungschance gegenüber bestehenden Konventionen
- 5. Logisch-systematische Analyse der Beziehungsstruktur als Ausgangspunkt empirischer Studien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht partizipative Kunst als Mittel zur Überwindung von Konventionen. Die Arbeit analysiert das Verhältnis von partizipativer Kunst zur Autonomie künstlerischer Produktion und hinterfragt die traditionelle Trennung zwischen Produzent und Rezipient. Es wird untersucht, wie partizipative Kunstformen bestehende Konventionen transzendieren und neue Beziehungsstrukturen schaffen.
- Die theoretischen Grundlagen partizipativer Kunst
- Das Verhältnis von partizipativer Kunst zur Autonomie künstlerischer Produktion
- Die Aufhebung der Trennung zwischen Produzent und Rezipient in partizipativer Kunst
- Der Einfluss von Konventionen auf den Prozess der Kunstschaffung
- Partizipative Kunst als Mittel zur Transzendierung von Konventionen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Theoretische Diskursformen bildender Kunst: Dieses Kapitel eröffnet die Arbeit mit einer Diskussion über ästhetische Debatten in der bildenden Kunst, insbesondere im Spannungsfeld zwischen klassischer Moderne und Gegenwartskunst. Es wird auf die Schwierigkeit der Interpretation von Gegenwartskunst hingewiesen und die zunehmende Bedeutung interaktiver und partizipativer Kunstformen hervorgehoben, die die Grenzen zwischen Produktion und Rezeption verschwimmen lassen. Die Arbeit betont die Notwendigkeit einer theoretischen Auseinandersetzung mit den Konsequenzen dieser Entwicklung für die Paradigmen der künstlerischen Autonomie und der Trennung von Produzenten und Rezipienten. Die Bedeutung sozialer Aspekte in der Kunstproduktion und -rezeption wird ebenfalls betont, wobei die "Black Boxes" von Kreativität und Imagination als Bereiche außerhalb des soziologischen Fokus definiert werden. Die Arbeit stützt sich auf die Ansätze von Becker und Schwietring, die die soziale Eingebundenheit von Kunstproduktion und -rezeption betonen.
2. Das Verhältnis partizipativer Kunst zur Autonomie künstlerischer Produktion: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Paradigma der Autonomie künstlerischer Produktion und seiner Infragestellung durch die Analyse partizipativer Kunst. Es wird die zunehmende Bedeutung der Rezipienten für die Kunstproduktion herausgestellt, basierend auf der Arbeit von Judith Siegmund. Das Kapitel legt die Grundlagen für die weitere Analyse partizipativer Kunstwerke, indem es auf die Studien von Kaija Kaitavuori Bezug nimmt und eine einheitliche Terminologie etabliert. Der Fokus liegt darauf, wie die Einbeziehung der Rezipienten in den Produktionsprozess das traditionelle Verständnis künstlerischer Autonomie in Frage stellt und den Blick für die Sozialität der Kunstproduktion öffnet.
Schlüsselwörter
Partizipative Kunst, künstlerische Autonomie, Produktion, Rezeption, Konventionen, Transzendenz, Kooperation, Soziologie der Kunst, interaktive Kunst, Gegenwartskunst, Becker, Schwietring, Kaitavuori.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in diesem Dokument?
Dieses Dokument ist eine umfassende Sprachvorschau, die den Titel, das Inhaltsverzeichnis, die Ziele und Schwerpunktthemen, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselwörter einer Seminararbeit enthält. Der Fokus liegt auf partizipativer Kunst und ihrer Beziehung zur künstlerischen Autonomie.
Was sind die Hauptthemen der Seminararbeit?
Die Arbeit untersucht die theoretischen Grundlagen partizipativer Kunst, das Verhältnis von partizipativer Kunst zur Autonomie künstlerischer Produktion, die Aufhebung der Trennung zwischen Produzent und Rezipient, den Einfluss von Konventionen auf den Prozess der Kunstschaffung und partizipative Kunst als Mittel zur Transzendierung von Konventionen.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Arbeit umfasst folgende Kapitel: 1. Theoretische Diskursformen bildender Kunst, 2. Das Verhältnis partizipativer Kunst zur Autonomie künstlerischer Produktion, 3. Zur systematischen Trennbarkeit von Produzierenden und Rezipierenden, 4. Partizipative Kunst als Transzendierung bestehender Konventionen, und 5. Logisch-systematische Analyse der Beziehungsstruktur als Ausgangspunkt empirischer Studien.
Was wird im ersten Kapitel behandelt?
Das erste Kapitel diskutiert ästhetische Debatten in der bildenden Kunst, insbesondere im Spannungsfeld zwischen klassischer Moderne und Gegenwartskunst. Es wird auf die Schwierigkeit der Interpretation von Gegenwartskunst hingewiesen und die zunehmende Bedeutung interaktiver und partizipativer Kunstformen hervorgehoben.
Was wird im zweiten Kapitel behandelt?
Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Paradigma der Autonomie künstlerischer Produktion und seiner Infragestellung durch die Analyse partizipativer Kunst. Es wird die zunehmende Bedeutung der Rezipienten für die Kunstproduktion herausgestellt.
Welche Schlüsselwörter sind mit der Seminararbeit verbunden?
Die Schlüsselwörter sind: Partizipative Kunst, künstlerische Autonomie, Produktion, Rezeption, Konventionen, Transzendenz, Kooperation, Soziologie der Kunst, interaktive Kunst, Gegenwartskunst, Becker, Schwietring, Kaitavuori.
Welche Autoren werden in der Arbeit erwähnt?
Die Arbeit bezieht sich auf die Ansätze von Becker, Schwietring, Judith Siegmund und Kaija Kaitavuori.
Was ist das Ziel der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht partizipative Kunst als Mittel zur Überwindung von Konventionen und analysiert das Verhältnis von partizipativer Kunst zur Autonomie künstlerischer Produktion.
- Quote paper
- Alexander Berghaus (Author), 2023, Partizipative Kunst als Transzendierung von Konventionen. Eine theoretisch-systematische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1519947