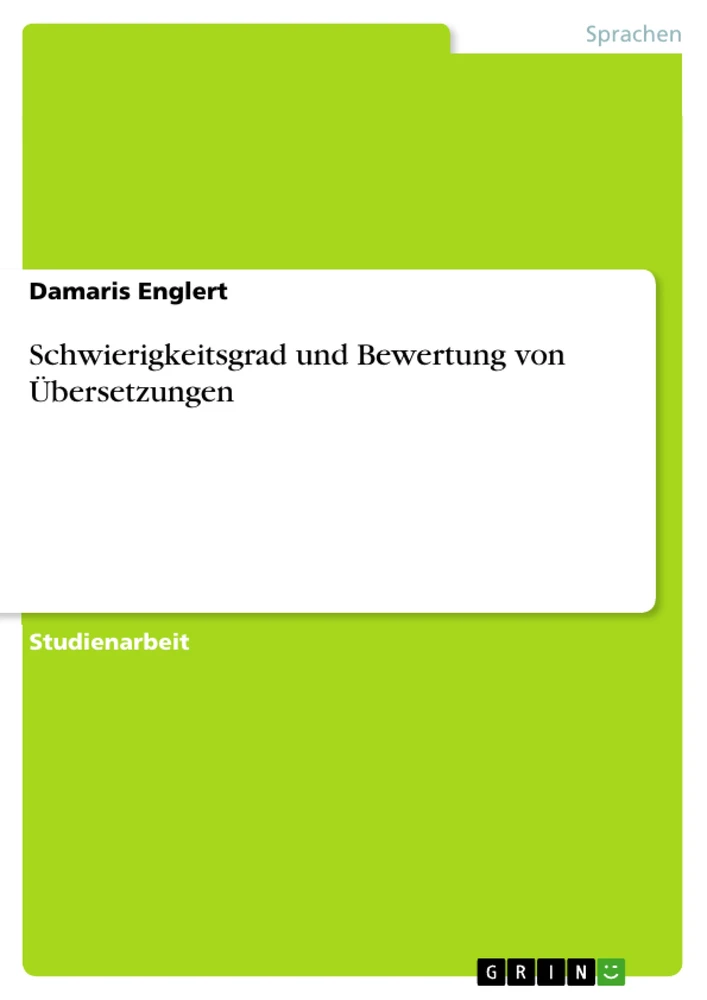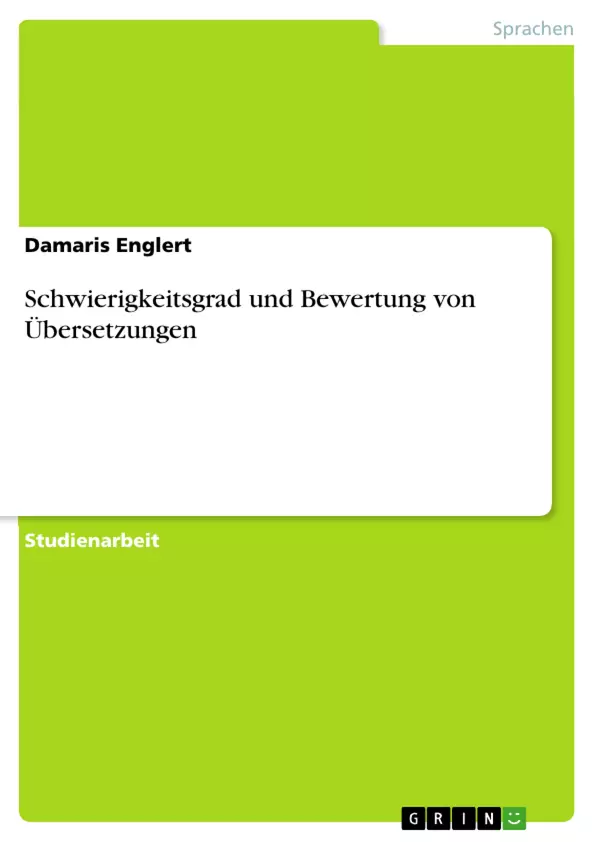Die Frage der Bestimmung des Schwierigkeitsgrades sowie der Bewertung von
Übersetzungen spielt sowohl in der Ausbildung von Übersetzern als auch in der späteren
Berufspraxis eine sehr wichtige Rolle – im Studium bei der Erstellung und Bewertung von
Klausuren, in der Praxis bei der Einschätzung der Leistung eines Berufsübersetzers im
Hinblick auf eine angemessene Honorierung. Daher ist es durchaus sinnvoll, sich im
Rahmen des Proseminars „Übersetzungswissenschaft – reine Theorie oder praktischer
Nutzen?“ mit diesem Thema zu beschäftigen. Denn natürlich beruhen sowohl die
Bestimmung des Schwierigkeitsgrades einer Übersetzung als auch deren Bewertung auf
vielen theoretischen Diskussionen, die sich wohl auch teilweise weit von der praktischen
Anwendung entfernt haben. Ist dennoch eine Auswirkung dieser Überlegungen in der Praxis
spürbar? Dieser Frage möchte ich in meiner Arbeit nachgehen. Dabei habe ich mich
hauptsächlich auf die Ausprägung dieser Thematik in der Ausbildungssituation konzentriert,
da das Proseminar in diesem Rahmen stattgefunden hat und die angehenden Übersetzer
zudem in der Ausbildung auf die Leistungsanforderungen und -bewertungen in der Praxis
vorbereitet werden sollen. Daher werde ich bei den einzelnen Punkten dieser Arbeit immer
wieder den Bezug zu den Studierenden herstellen und verdeutlichen, welche Bedeutung der
jeweilige Sachverhalt für sie hat.
Diese Arbeit ist den beiden im Titel anklingenden Bereichen entsprechend in zwei große
Teile untergliedert. So möchte ich zunächst auf den Schwierigkeitsgrad einer Übersetzung
eingehen, da dessen Bestimmung die Voraussetzung für eine spätere Evaluierung ist. Nach
der Erläuterung der für diese Thematik wichtigen Parameter und der Darstellung eines
Systems zur Bestimmung des Schwierigkeitsgrades werde ich dann zu der Bewertung selbst
kommen und dabei die notwendigen Grundlagen sowie verschiedene Evaluierungssysteme
miteinander vergleichen. Dieser Vergleich soll die ihm vorausgehenden theoretischen
Betrachtungen veranschaulichen und daher habe ich mein Augenmerk auf am FASK
Germersheim verwendete Bewertungsschemata gerichtet, da dies, beurteilt aus der Sicht
einer Studentin an dieser Einrichtung, sicher sehr interessante Einblicke geben kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Schwierigkeitsgrad einer Übersetzung
- Der Begriff „Übersetzungsschwierigkeit”
- Typologie der Übersetzungsschwierigkeiten
- Bewertung von Übersetzungen
- Der Begriff „Übersetzungsfehler”
- Die translatorischen Kategorien
- Allgemeine Grundlagen für ein Bewertungsschema nach Peter A. Schmitt
- Fehlerklassifizierung nach Christiane Nord
- Bewertungsschemata am FASK - ein Vergleich
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Schwierigkeitsgrad und die Bewertung von Übersetzungen im Kontext der Übersetzerausbildung. Sie untersucht die theoretischen Grundlagen und die praktische Anwendung von Konzepten zur Bestimmung von Übersetzungsschwierigkeiten und Fehlerklassifizierungen.
- Definition und Typologie von Übersetzungsschwierigkeiten
- Bedeutung von Übersetzungsschwierigkeiten für die Übersetzerausbildung
- Verschiedene Bewertungsschemata für Übersetzungen
- Vergleich von Bewertungsschemata im Kontext der Übersetzerausbildung
- Zusammenhang zwischen Schwierigkeitsgrad und Bewertung von Übersetzungen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und erläutert die Relevanz von Schwierigkeitsgrad und Bewertung von Übersetzungen für die Übersetzerausbildung. Sie betont den Fokus auf die Ausbildungssituation und die Relevanz der Thematik für angehende Übersetzer.
Der Schwierigkeitsgrad einer Übersetzung
Der Begriff „Übersetzungsschwierigkeit”
Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene Definitionsansätze von Übersetzungsschwierigkeiten. Es wird die Bedeutung einer einheitlichen Definition für die Didaktik herausgestellt und verschiedene Ansätze, wie beispielsweise die Definitionen von Thiel (1975) und Nord (2003), werden kritisch analysiert. Schließlich wird Thomes (2004) komplexe Definition vorgestellt, die verschiedene Faktoren des Übersetzungsprozesses berücksichtigt.
Typologie der Übersetzungsschwierigkeiten
Dieses Kapitel befasst sich mit der Klassifizierung von Übersetzungsschwierigkeiten und stellt verschiedene Typologisierungsversuche vor. Es werden die Ansätze von Krings (1986) und Nord genauer untersucht, die beide einen didaktischen Bezug haben. Krings unterscheidet zwischen Rezeptions- und Wiedergabeproblemen, während Nord Übersetzungsschwierigkeiten und Übersetzungsprobleme voneinander abgrenzt. Die Bedeutung dieser Typologisierungen für die Übersetzerausbildung wird erläutert.
Schlüsselwörter
Übersetzungsschwierigkeit, Übersetzungsbewertung, Übersetzerausbildung, Übersetzungsprozess, Didaktik, Typologie, Bewertungsschemata, Fehlerklassifizierung, Übersetzungsproblem, Rezeptionsproblem, Wiedergabeproblem
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Übersetzungsschwierigkeit und Übersetzungsproblem?
Nach Christiane Nord sind Schwierigkeiten subjektiv (abhängig vom Übersetzer), während Probleme objektiv im Text liegen und von jedem Übersetzer gelöst werden müssen.
Welche Rolle spielt die Bestimmung des Schwierigkeitsgrades?
Sie ist die Voraussetzung für eine faire Bewertung von Prüfungsleistungen im Studium und für eine angemessene Honorierung in der Berufspraxis.
Welche Bewertungsschemata werden in der Arbeit verglichen?
Die Arbeit vergleicht am FASK Germersheim verwendete Schemata, unter anderem basierend auf Ansätzen von Peter A. Schmitt und Christiane Nord.
Was sind translatorische Kategorien bei der Fehlerbewertung?
Dies sind Kriterien, nach denen Fehler klassifiziert werden, zum Beispiel Sinnfehler, Grammatikfehler, Stilfehler oder Verstöße gegen die Terminologie.
Wie definiert Wolfram Wilss Übersetzungsschwierigkeiten?
Die Arbeit diskutiert verschiedene Ansätze; generell wird die Komplexität des Textes im Verhältnis zu den kognitiven Ressourcen des Übersetzers betrachtet.
- Citation du texte
- B.A. Damaris Englert (Auteur), 2008, Schwierigkeitsgrad und Bewertung von Übersetzungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152121