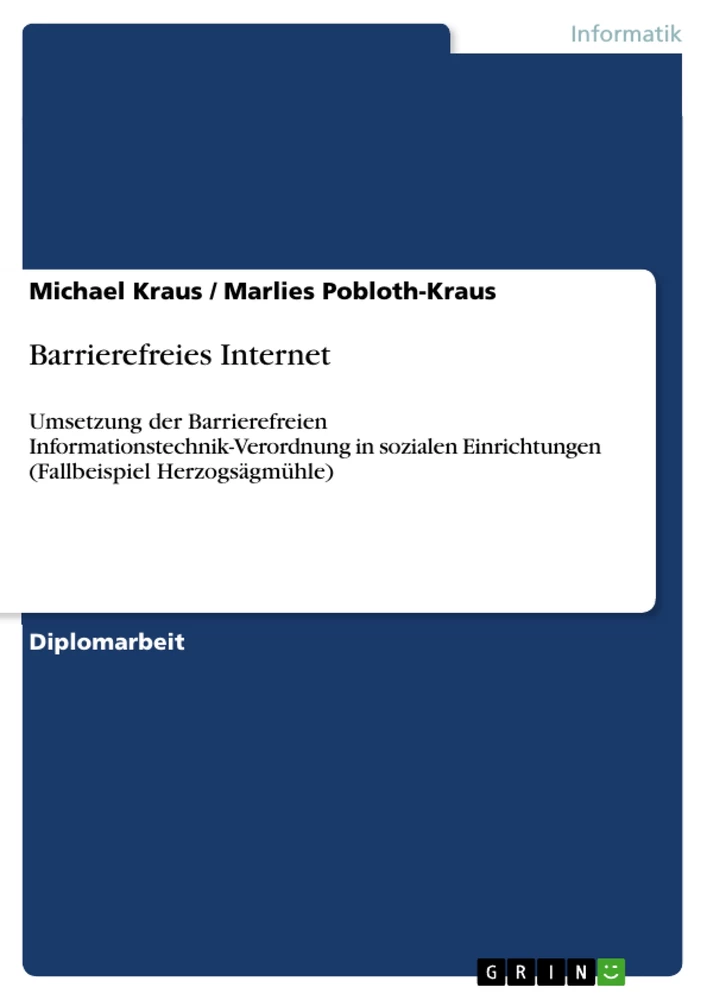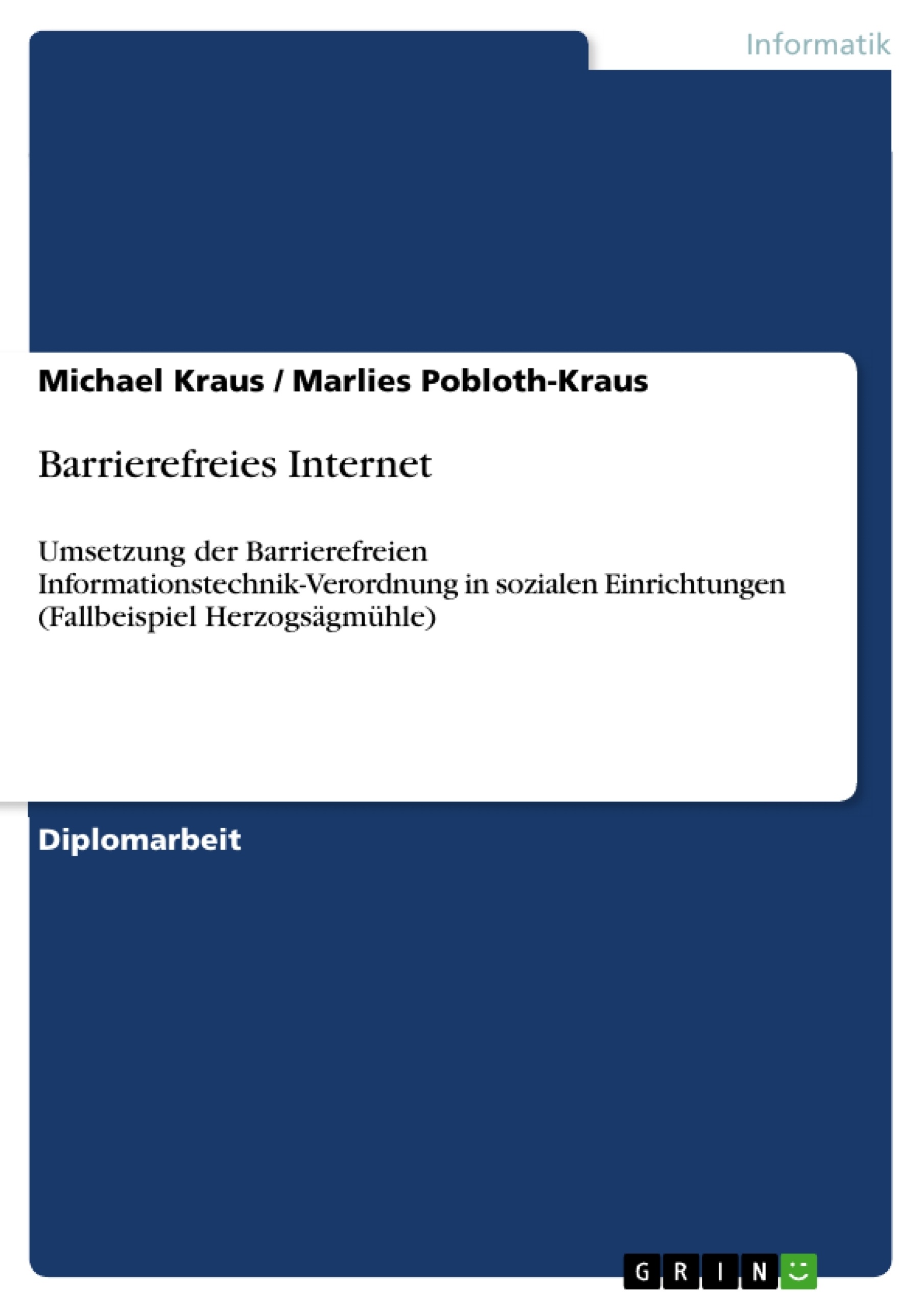Der Mikrozensus aus dem Jahr 2003 weist in der Bundesrepublik Deutschland 8,4 Millionen amtlich anerkannte behinderte Menschen aus, darunter 6,7 Millionen Schwerbehinderte. Gerade diese Personen haben oft aufgrund ihres eingeschränkten sozialen Umfelds ein starkes Interesse, Angebote im Web umfassend zu nutzen.
Jedoch gibt es im Internet unterschiedliche Barrieren: Blinde benötigen zusätzliche Textinformationen für Bilder und Animationen, Sehbehinderte vor allem einen ausreichenden Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe und die Möglichkeit, Schriften zu vergrößern. Gehörlose profitieren von Informationen in Gebärdensprache und Körperbehinderte von einer Bedienung des Internetangebots ohne Maus. Eine klar strukturierte Webseite in einfacher Sprache ist ein Gewinn für Lernbehinderte, geistig Behinderte und Ausländer. Von schlüssiger und logischer Navigation profitieren letztendlich alle Benutzer.
Hinter der Realisierung von Barrierefreiheit im Internet steckt der Grundgedanke des Universal Design, also das "Produkt Internet" so zu entwickeln, dass es von möglichst vielen Menschen genutzt werden kann. Barrierefreiheit bedeutet dabei die Symbiose der technischen Zugänglichkeit (Accessibility) mit der Benutzerfreundlichkeit (Usability).
Sämtliche wünschenswerten Anforderungen an eine barrierefreie Website sind in die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung, kurz BITV, in 66 Bedingungen, die zu 14 Anforderungsgruppen zusammengefasst sind, eingeflossen.
Entscheidet man sich für eine barrierefreie Umsetzung eines Webangebotes, sind diese Anforderungen der BITV zu berücksichtigen. Da diese teilweise sehr kryptisch formuliert sind, ist für Entscheider von Projekten, Projektleiter und Webdesigner ein Leitfaden unerlässlich, in dem man Schritt für Schritt die Bedingungen abarbeiten kann.
Diese Diplomarbeit beschreibt den Relaunch der Internetpräsenz des Europa-Projektbüros in der sozialen Einrichtung Herzogsägmühle anhand eines solchen Leitfadens.
Bei diesem Relaunchs orientierte man sich an anerkannten Kriterien des Projektmanagements, um die Risiken hinsichtlich Qualität, Finanzierung und Zeitrahmen zu minimieren. Ein interessanter Aspekt dieses Projekts war neben der Einhaltung und Überprüfung der BITV-Anforderungen durch Prüftools die Systemauswahl eines Content-Management-Systems. Hier fiel die Wahl nach Überprüfung mehrerer Auswahlkriterien auf das Open Source-System Typo3, das bereits vorgefertigte Module für Barrierefreiheit mitbringt.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- Ziele und Zweck der Arbeit
- Das Diakoniedorf Herzogsägmühle
- Definitionen
- Behinderung
- Gleichstellung
- Benachteiligung
- Barrierefreiheit
- Zielvereinbarungen
- Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung
- World Wide Web Consortium
- Web Accessibility Initiative
- Web Content Accessibility Guidelines
- Inhalt und Layout von HTML-Dokumenten
- Unterschied zwischen Website und Webseite
- Content-Management-System
- TEIL A: GRUNDLAGEN EINES BARRIEREFREIEN INTERNETS (MARLIES POBLOTH-KRAUS)
- ANFORDERUNGEN VERSCHIEDENER ZIELGRUPPEN AN BARRIEREFREIHEIT
- Allgemeine Anforderungen
- Usability
- Accessibility
- Barrierefreiheit
- Universal Design
- Anforderungen an die Zielgruppe der Behinderten
- Anteil der Behinderten an der Gesamtbevölkerung
- Nutzung des Internets
- Blinde
- Sehbehinderte
- Hörgeschädigte und Gehörlose
- Körperbehinderte
- Lernbehinderte
- Geistigbehinderte
- Anforderungen für die Gruppe der sonstig Benachteiligten
- Senioren
- Ausländer und Migranten
- Anwender mobiler Endgeräte
- Einführung von Personas
- ENTWICKLUNG UND AKTUELLE SITUATION DER BARRIEREFREIHEIT
- USA
- Americans with Disabilities Act (ADA)
- Rehabilitation Act - Section 508
- Web Accessibility Initiative (WAI)
- Computerindustrie
- IBM
- Microsoft
- Europa
- Deutschland
- Behindertenverbände
- Barrierefreie Projekte
- Aktionsbündnis für barrierefreie Informationstechnik
- barrierefrei kommunizieren!
- Österreich
- Schweiz
- LÄNDERÜBERGREIFENDE EMPFEHLUNGEN UND BUNDESDEUTSCHE GESETZE
- Länderübergreifende Empfehlungen des World Wide Web Consortiums
- Web Content Accessibility Guidelines 1.0
- Web Content Accessibility Guidelines 2.0
- Gestaltungsprinzip der Wahrnehmbarkeit
- Gestaltungsprinzip der Bedienbarkeit
- Gestaltungsprinzip der Verständlichkeit
- Robustheit der Technik
- Authoring Tool Accessibility Guidelines 1.0
- User Agent Accessibility Guidelines 1.0
- XML Accessibility Guidelines 1.0
- Rechtliche Bestimmungen in Deutschland
- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
- Sozialgesetzbuch Neuntes Buch
- Behindertengleichstellungsgesetz
- Landesgleichstellungsgesetze
- Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung
- STAND DER UMSETZUNG DER BITV IN DEUTSCHLAND
- Bundesbehörden
- Landesbehörden
- Hochschulen
- Privatwirtschaft und soziale Einrichtungen
- KOSTEN UND NUTZEN EINER BARRIEREFREIEN WEBSITE
- Kosten
- Rüstkosten
- Produktionskosten
- Migrationskosten
- Nutzen
- Ausdehnung der Reichweite
- Optimierung für Suchmaschinen
- Umsatzsteigerung
- Wettbewerbsvorteile
- Erschließung neuer Märkte
- Geringeres Transfervolumen
- Kostengünstiger Relaunch
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Umsetzung der Barrierefreien Informationstechnik-Verordnung (BITV) in sozialen Einrichtungen. Sie beleuchtet die Bedeutung eines barrierefreien Internets für verschiedene Zielgruppen, insbesondere für Menschen mit Behinderungen. Die Arbeit untersucht die Anforderungen an ein barrierefreies Webdesign, die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und die aktuellen Entwicklungen auf internationaler Ebene.
- Anforderungen an ein barrierefreies Internet für verschiedene Zielgruppen
- Rechtliche Rahmenbedingungen der BITV in Deutschland
- Entwicklung und aktuelle Situation der Barrierefreiheit
- Kosten und Nutzen eines barrierefreien Webauftritts
- Fallbeispiel: Herzogsägmühle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Barrierefreies Internet und die BITV ein. Sie definiert zentrale Begriffe wie Behinderung, Gleichstellung und Barrierefreiheit und stellt das Diakoniedorf Herzogsägmühle als Fallbeispiel vor.
Teil A der Arbeit, verfasst von Marlies Pobloth-Kraus, befasst sich mit den Grundlagen eines barrierefreien Internets. Kapitel 2 analysiert die Anforderungen verschiedener Zielgruppen, darunter Menschen mit Behinderungen, Senioren und Migranten, an ein barrierefreies Webdesign. Kapitel 3 beleuchtet die Entwicklung und die aktuelle Situation der Barrierefreiheit in den USA und Europa, insbesondere in Deutschland. Kapitel 4 untersucht länderübergreifende Empfehlungen und bundesdeutsche Gesetze zur Barrierefreiheit, einschließlich der BITV. Kapitel 5 analysiert den Stand der Umsetzung der BITV in Deutschland, während Kapitel 6 die Kosten und den Nutzen einer barrierefreien Website beleuchtet.
Schlüsselwörter
Barrierefreies Internet, BITV, Web Accessibility, Behinderung, Gleichstellung, Universal Design, Menschen mit Behinderungen, soziale Einrichtungen, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), rechtliche Rahmenbedingungen, Kosten und Nutzen.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Barrierefreiheit im Internet?
Barrierefreiheit im Internet bedeutet die Symbiose aus technischer Zugänglichkeit (Accessibility) und Benutzerfreundlichkeit (Usability), basierend auf dem Grundgedanken des Universal Design, damit Webangebote von möglichst vielen Menschen – insbesondere Menschen mit Behinderungen – genutzt werden können.
Was ist die BITV?
Die BITV steht für die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung. Sie umfasst 66 Bedingungen in 14 Anforderungsgruppen, die sicherstellen sollen, dass Webangebote für verschiedene Zielgruppen wie Blinde, Sehbehinderte oder Gehörlose zugänglich sind.
Welche Anforderungen haben Blinde an Webseiten?
Blinde Nutzer benötigen zusätzliche Textinformationen (Alt-Texte) für Bilder und Animationen, da sie auf Screenreader angewiesen sind, die den Inhalt der Seite vorlesen.
Warum wurde Typo3 für den Relaunch der Herzogsägmühle gewählt?
Typo3 wurde gewählt, weil es als Open-Source-System bereits vorgefertigte Module für Barrierefreiheit mitbringt und verschiedene Auswahlkriterien hinsichtlich der BITV-Konformität erfüllte.
Welchen Nutzen hat eine barrierefreie Website für die Betreiber?
Neben der sozialen Verantwortung bietet sie Vorteile wie eine größere Reichweite, Optimierung für Suchmaschinen, Umsatzsteigerung und Wettbewerbsvorteile durch die Erschließung neuer Märkte.
- Quote paper
- Michael Kraus (Author), Marlies Pobloth-Kraus (Author), 2006, Barrierefreies Internet, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152128