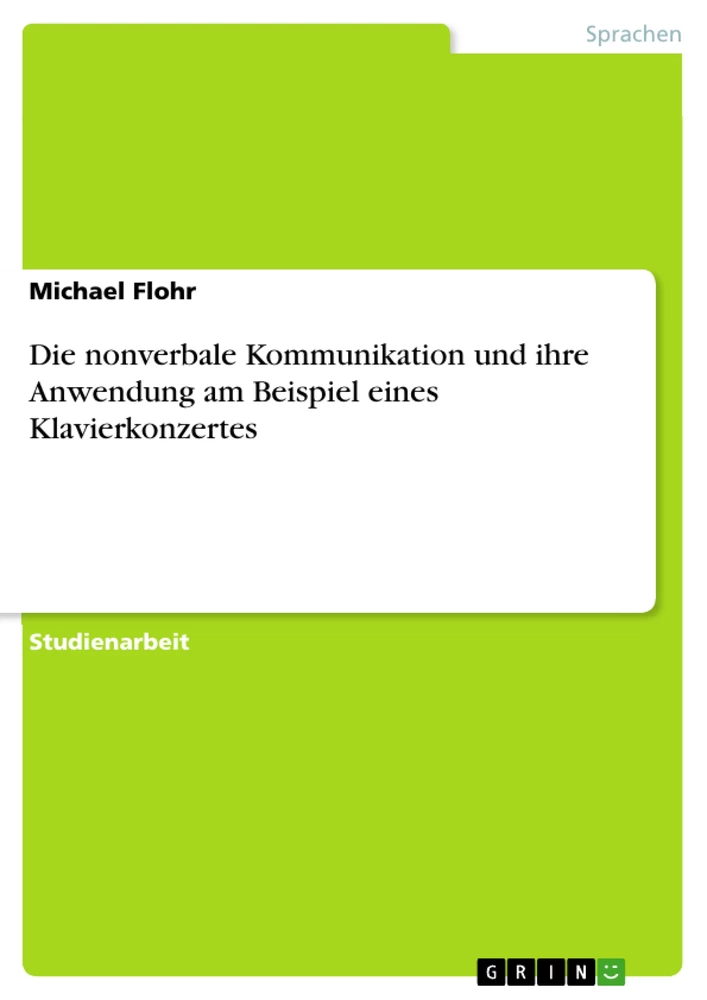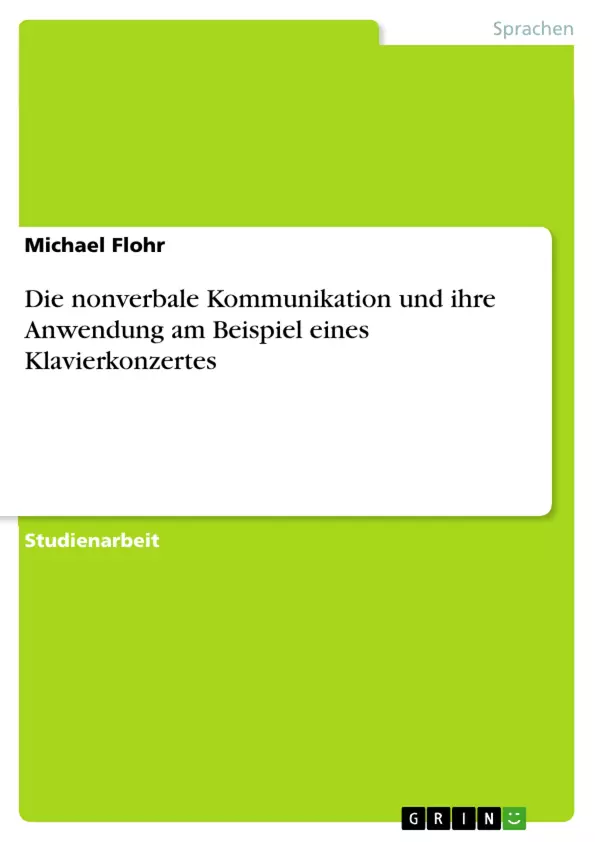Als Sujet dieser Seminararbeit soll die nonverbale Kommunikation mit ihren reichhaltigen Facetten vorgestellt werden. Körpersprachliche Elemente lassen den Körper beziehungsweise im übertragenen Sinne die Seele eines jeden Menschen im Alltag ohne Zuhilfenahme der Stimmbänder kommunizieren. Die Art zu gehen, zu stehen und zu sitzen prägt die Persönlichkeit eines Menschen, wie auch die Gesten und die Mimik, welche den persönlichen Charakter einer jeden Person für die Lebensumwelt verbildlichen. Neben einer Erörterung des Begriffs der nonverbalen Kommunikation in Verbindung mit einer kurzen Übersicht der Forschungshistorie sollen die einzelnen körpersprachlichen Signale einer genaueren Betrachtung unterzogen werden. Neben den bereits genannten Aspekten der Gestik, der Mimik, des Gangs und der Haltung sind Statussymbole und der persönliche Status in die Betrachtung einzubeziehen, wie auch die menschliche Stimme, die vordergründig ein verbales Instrument ist, hintergründig aber entscheidende nonverbale Impulse mittels unterschiedlicher Klanggebung und individuellen Tonfalls vermittelt. Ebenfalls grenzt der Mensch seine Intimsphäre stufenweise durch gewisse ihn umschließende Territorien ab, welche ebenso erklärt werden. Abgeschlossen wird der theoretisch geprägte Teil mit einer kurzen Analyse des menschlichen nonverbalen Verhaltens in Konfliktsituationen.
Im zweiten Teil dieser Arbeit stehen meine persönlichen Erfahrungen beim Klavierspiel im Mittelpunkt. Welche Bedeutung kann der Körpersprache bei einem Konzert beigemessen werden und welche nonverbalen Elemente finden Anwendung? Wie überzeugt man das Publikum von seinen künstlerischen Ideen und Intentionen? Wie sollte man mit Fehlern umgehen, um das Konzerterlebnis der Zuhörer nicht zu beeinträchtigen? Diese genannten Fragen sollen vor allem im Reflexionsteil beantwortet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begrifflichkeit nonverbale Kommunikation
- Forschungsgeschichte
- Körpersprachliche Signale
- Körperhaltung
- Gangarten
- Gestik
- Die Begrüßung
- Bedeutung und Wahrnehmung der einzelnen Bestandteile von Gestik
- Mimik
- Stimme und Tonfall
- Status
- Territorien
- Konflikt und Körpersprache
- Fallbeispiel: Nonverbale Kommunikation beim Klavierspiel
- Klavierspiel als Monolog oder Dialog
- Die persönliche Reflexion einer Konzertsituation: Die Vorbereitung
- Die persönliche Reflexion einer Konzertsituation: Das Konzert
- Der unverhoffte Moment
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die nonverbale Kommunikation und ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. Ziel ist es, die Bedeutung der Körpersprache im Alltag und insbesondere in einem künstlerischen Kontext (Klavierkonzert) zu beleuchten. Die Arbeit erörtert den Begriff der nonverbalen Kommunikation, ihre Forschungsgeschichte und analysiert verschiedene Aspekte der Körpersprache.
- Begriff und Forschungsgeschichte der nonverbalen Kommunikation
- Analyse verschiedener körpersprachlicher Signale (Gestik, Mimik, Körperhaltung, Stimme)
- Bedeutung von Territorien und Körpersprache in Konfliktsituationen
- Nonverbale Kommunikation im Kontext eines Klavierkonzertes
- Persönliche Reflexion der nonverbalen Aspekte des Klavierspiels
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der nonverbalen Kommunikation ein und beschreibt den Fokus der Arbeit: die Darstellung der vielseitigen Facetten nonverbaler Kommunikation und deren Anwendung, besonders im Kontext eines Klavierkonzertes. Es wird die zentrale Rolle der Körpersprache im alltäglichen Leben und ihre Bedeutung für die persönliche Ausdrucksfähigkeit hervorgehoben. Die Arbeit kündigt eine Erörterung des Begriffs, einen Überblick über die Forschungsgeschichte und eine detaillierte Betrachtung körpersprachlicher Signale an, inklusive Statussymbole, Stimme und Territorien, sowie eine Analyse nonverbalen Verhaltens in Konfliktsituationen. Der zweite Teil der Arbeit widmet sich der persönlichen Erfahrung der Autorin beim Klavierspiel und analysiert die Bedeutung der Körpersprache in einem Konzert.
Begrifflichkeit nonverbale Kommunikation: Dieses Kapitel definiert nonverbale Kommunikation als die Ausdrucksmöglichkeiten des Körpers im Alltag und betont deren enge Verzahnung mit verbaler Kommunikation. Es wird die Dominanz nonverbaler Kommunikation bei der Wahrnehmung von Gesprächspartnern (55%) im Vergleich zum gesprochenen Wort (7%) hervorgehoben. Die Problematik von Missverständnissen und Fehldeutungen wird angesprochen, und die automatisierte Wahrnehmung körpersprachlicher Signale ohne bewusste Analyse wird diskutiert. Der Einfluss nonverbaler Kommunikation auf die Meinungsbildung im privaten und öffentlichen Bereich wird ebenfalls behandelt, mit dem Hinweis auf die Möglichkeit der Manipulation durch geschulte Personen.
Forschungsgeschichte: Die Forschungsgeschichte der nonverbalen Kommunikation wird in drei Entwicklungslinien eingeteilt: die rhetorische, physiognomische und sprachphilosophische Forschung. Der moderne Ursprung wird mit Charles Darwin (1872) und der Begründung der empirischen Forschung nonverbalen Verhaltens verbunden. Die Entwicklung des Bewusstseins für die Dichotomie von Körper und Sprache und die anfängliche Unterordnung nonverbaler Kommunikation werden beleuchtet. Das zentrale Zitat von Watzlawick, Beavin und Jackson („Man kann nicht nicht kommunizieren“) wird eingeführt und in den Kontext der neueren empirischen Forschung eingeordnet.
Körpersprachliche Signale: Dieses Kapitel behandelt die Individualität des menschlichen Habitus und die Bedeutung körpersprachlicher Signale als Ausdruck innerer Haltungen, Gedanken und Gefühle. Es wird die schnelle Verarbeitung dieser Signale durch das Gehirn zu einem Gesamteindruck beschrieben. Der Fokus liegt auf der Körperhaltung als Ausdruck innerer Gefühlslage und Stellung zum Gesprächspartner, wobei die Unterscheidung zwischen unter- und überspannter sowie offener und geschlossener Körperhaltung hervorgehoben wird. Weitere Aspekte wie Gangarten, Gestik und Mimik werden angerissen, jedoch nicht detailliert behandelt.
Schlüsselwörter
Nonverbale Kommunikation, Körpersprache, Gestik, Mimik, Körperhaltung, Stimme, Tonfall, Status, Territorien, Konflikt, Klavierkonzert, Forschungsgeschichte, Wahrnehmung, Interpretation, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Nonverbale Kommunikation
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die nonverbale Kommunikation und ihre vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten, insbesondere im künstlerischen Kontext eines Klavierkonzertes. Sie beleuchtet die Bedeutung der Körpersprache im Alltag, erörtert den Begriff der nonverbalen Kommunikation, ihre Forschungsgeschichte und analysiert verschiedene Aspekte der Körpersprache wie Gestik, Mimik, Körperhaltung, Stimme und den Einfluss von Territorien und Körpersprache in Konfliktsituationen. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der persönlichen Reflexion der Autorin über die nonverbale Kommunikation beim Klavierspiel.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Begriff und Forschungsgeschichte der nonverbalen Kommunikation; Analyse verschiedener körpersprachlicher Signale (Gestik, Mimik, Körperhaltung, Stimme); Bedeutung von Territorien und Körpersprache in Konfliktsituationen; Nonverbale Kommunikation im Kontext eines Klavierkonzertes; Persönliche Reflexion der nonverbalen Aspekte des Klavierspiels.
Wie ist die Seminararbeit aufgebaut?
Die Seminararbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung und einem Überblick über Zielsetzung und Themenschwerpunkte. Es folgen Kapitel zur Begrifflichkeit nonverbaler Kommunikation, zur Forschungsgeschichte, zu körpersprachlichen Signalen (Körperhaltung, Gangarten, Gestik, Mimik, Stimme, Status), zu Territorien, zu Konflikt und Körpersprache und einem ausführlichen Fallbeispiel: Nonverbale Kommunikation beim Klavierspiel (Klavierspiel als Monolog oder Dialog, persönliche Reflexion einer Konzertsituation: Vorbereitung und Konzert, der unverhoffte Moment). Die Arbeit schließt mit einem Resümee ab. Die Kapitelzusammenfassungen bieten einen detaillierten Überblick über den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Nonverbale Kommunikation, Körpersprache, Gestik, Mimik, Körperhaltung, Stimme, Tonfall, Status, Territorien, Konflikt, Klavierkonzert, Forschungsgeschichte, Wahrnehmung, Interpretation, Kommunikation.
Was ist das zentrale Argument oder die These der Seminararbeit?
Die zentrale These ist, dass nonverbale Kommunikation eine bedeutende Rolle im Alltag und insbesondere in künstlerischen Kontexten spielt. Die Arbeit zeigt die Vielseitigkeit nonverbaler Ausdrucksformen auf und betont deren Einfluss auf die Wahrnehmung und Interpretation von Handlungen und Emotionen. Der Fall des Klavierkonzertes dient als exemplarische Anwendung der theoretischen Erkenntnisse.
Welche Bedeutung hat die persönliche Reflexion der Autorin?
Die persönliche Reflexion der Autorin über ihre Erfahrungen beim Klavierspiel bildet einen wichtigen Teil der Arbeit. Sie dient dazu, die theoretischen Aspekte der nonverbalen Kommunikation mit praktischen Erfahrungen zu veranschaulichen und die Bedeutung der Körpersprache in einem künstlerischen Kontext zu verdeutlichen.
Wie wird die Forschungsgeschichte der nonverbalen Kommunikation dargestellt?
Die Forschungsgeschichte wird in drei Entwicklungslinien (rhetorisch, physiognomisch, sprachphilosophisch) eingeteilt und der moderne Ursprung mit Charles Darwin (1872) und der Begründung der empirischen Forschung nonverbalen Verhaltens verbunden. Die Entwicklung des Bewusstseins für die Dichotomie von Körper und Sprache und die anfängliche Unterordnung nonverbaler Kommunikation werden beleuchtet. Das zentrale Zitat von Watzlawick, Beavin und Jackson („Man kann nicht nicht kommunizieren“) wird eingeführt und in den Kontext der neueren empirischen Forschung eingeordnet.
- Citar trabajo
- Michael Flohr (Autor), 2009, Die nonverbale Kommunikation und ihre Anwendung am Beispiel eines Klavierkonzertes, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152192