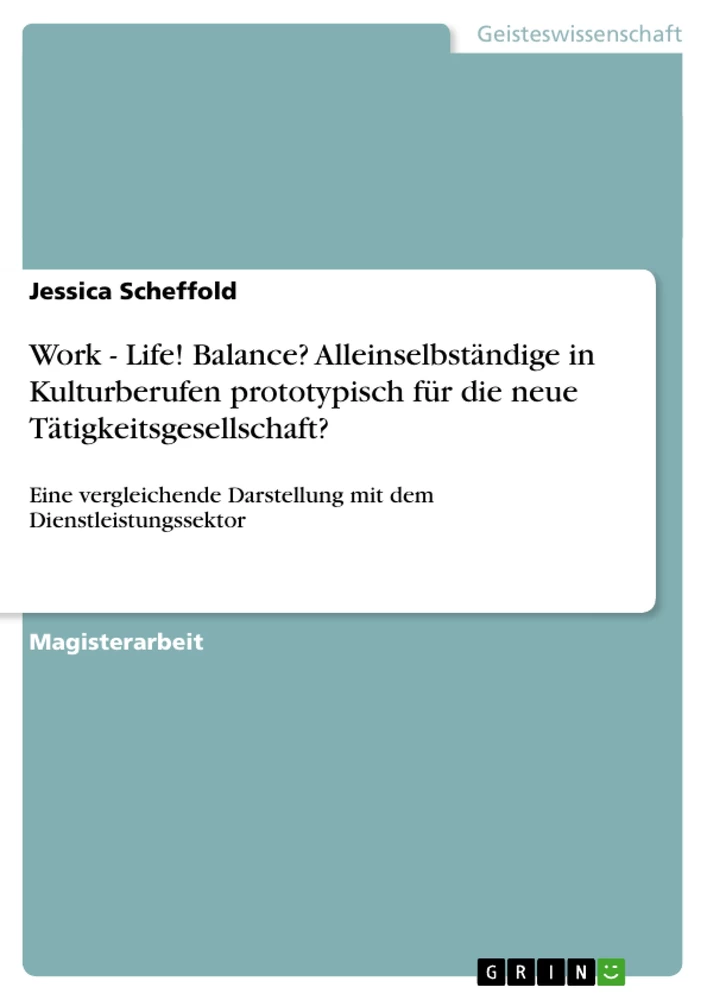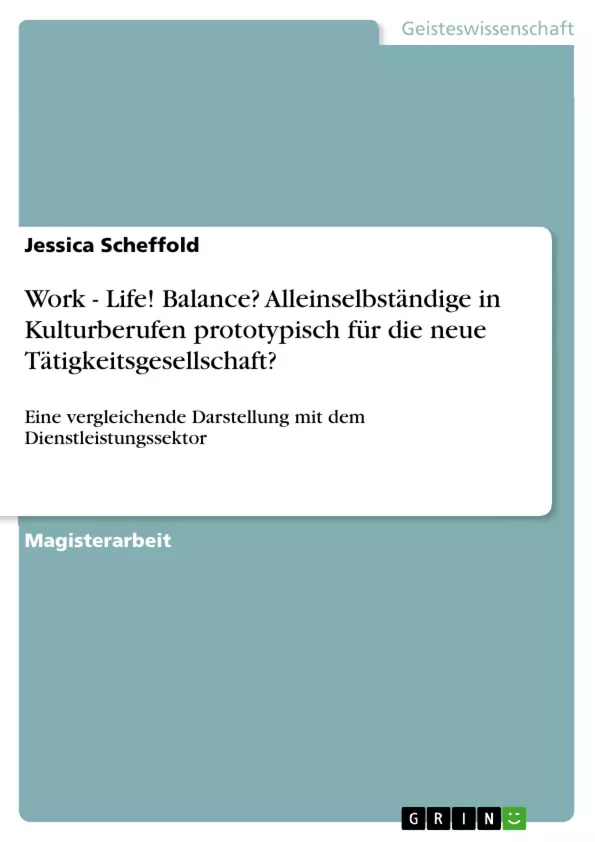Wir leben in einer Welt, in der auf Grund globalisierter Märkte und einer fortschreitenden Technologisierung, in der die Grenzen von Raum und Zeit faktisch aufgehoben sind. Entwicklungen wie das Internet haben dazu geführt, dass Daten in Echtzeit an sämtlichen Plätzen der Welt be- und verarbeitet werden können. Betrachtet man das Phänomen, dass sich die Erde nach wie vor um die Sonne dreht und auch die Zeitzonen weiter bestehen, so liegt nahe, dass unterschiedliche Personen an verschiedenen Orten an ein und demselben Projekt arbeiten können, und dies somit 24 Stunden am Tag bearbeitet werden kann. Was impliziert das für das von uns empfundene hier und jetzt?
Auf dem Weg in die Wissens- und Kulturgesellschaft werden sich die Gesellschaft, Fertigungsmethoden und Arbeitsweisen ändern. Unternehmen arbeiten auf andere Art mit wechselnden Beziehungen. Die Entwicklungszyklen im Allgemeinen werden drastisch verkürzt, so dass die Hersteller gezwungen sind, in jeglicher Hinsicht flexibler zu werden. Diese Anforderungen werden auf alle Lebens- und Arbeitsbereiche durchschlagen und sich somit auf unser aller Leben auswirken. Die Frage, die wir uns permanent stellen müssen lautet: Wie können wir dies schaffen, und gleichzeitig ein ausgeglichenes, erfülltes Leben führen?
Selbständige gelten gemeinhin als Unternehmer. Im Kulturbereich gibt es eine steigende Anzahl an Ein-Personen-Selbständigen, welche sich am Markt behaupten müssen. Auf Basis einer breiten theoretischen Grundlage und mittels eines Leitfadeninterviews wird das Befinden von Alleinselbständigen in Kulturberufen und das von Angestellten im Dienstleistungssektor analysiert. Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden herausgearbeitet und die Frage erläutert, ob die Lebens- und Arbeitsweise von Alleinselbständigen in Kulturberufen prototypisch für eine neue Tätigkeitsgesellschaft ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit
- 2 Definitionen
- 2.1 Kultur und Arbeit
- 2.2 Atypische Beschäftigung
- 2.3 Work Life Balance
- 2.4 Alleinselbständige in Kulturberufen
- 2.5 Arbeit vs. Tätigkeit
- 2.6 Prototyp
- 3 Forschungsmethodik
- 3.1 Leitfadeninterview
- 3.1.1 Entwicklung der Fragestellungen
- 3.1.2 Auswahl der Interviewpartner
- 3.1.3 Transkription und Auswertung
- 3.1 Leitfadeninterview
- 4 Von der Industrie- zur Wissens- und Kulturgesellschaft
- 4.1 Sektorentheorie vs. Kondratjewzyklus
- 4.2 Gesellschaftlicher Wandel
- 4.2.1 Wertewandel
- 4.2.2 Menschenbild
- 4.2.3 Demografischer Aspekt
- 4.2.4 Rollenverständnis und Bevölkerungszahl
- 4.3 Epochen- und Paradigmenwechsel
- 4.3.1 Agrargesellschaft
- 4.3.2 Industrialisierung und Normalarbeit
- 4.3.3 De-Industrialisierung und Post-Fordismus
- 4.4 Arbeitsmarktentwicklung
- 4.4.1 Bildungsniveau
- 4.4.2 Arbeitszeit
- 4.4.3 Das Teilzeitphänomen
- 4.4.4 Arbeitsteilung
- 4.4.5 Selbständigkeit im Kulturberuf
- 4.4.6 Kultur als Jobmotor
- 4.5 Entgrenzung und Subjektivierung
- 4.5.1 Prekarisierung und Flexibilisierung
- 4.5.2 Diskontinuierliche und multiple Beschäftigung
- 4.5.3 Mobiles Raum-Zeit Verständnis
- 5 Work-Life-Balance
- 5.1 Leitmotiv und Gattungsbegriff
- 5.2 Beziehungskontext der Arbeitsakteure
- 5.2.1 Unternehmenskultur
- 5.2.2 Flexible Führung und Hierarchien
- 5.2.3 Betriebliche Work-Life-Balance Massnahmen
- 5.2.4 Entkollektivierung
- 5.2.5 Interessenvertretungen
- 5.3 Nivellierung persönlicher Balance
- 5.3.1 Zeitbewusstsein und Zeitwohlstand
- 5.3.2 Multidimensionalität nach Kastner
- 5.3.3 Identität und Identifikation
- 5.3.4 Lebensziel und Zufriedenheit
- 5.3.5 Familiale Rahmenbedingungen
- 5.3.6 Life Balance nach dem Erwerbsleben
- 6 Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Work-Life-Balance von alleinselbständigen Kulturschaffenden und vergleicht diese mit Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Ziel ist es, herauszufinden, ob alleinselbständige in Kulturberufen als prototypisch für die neue Tätigkeitsgesellschaft angesehen werden können. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen und Besonderheiten der Work-Life-Balance in beiden Sektoren.
- Work-Life-Balance in Kulturberufen
- Vergleich mit dem Dienstleistungssektor
- Atypische Beschäftigungsverhältnisse
- Der Wandel der Arbeitswelt
- Prototypen der neuen Tätigkeitsgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung und Zielsetzung der Arbeit: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit und die Forschungsfrage, die sich mit der Work-Life-Balance von Selbstständigen im Kulturbereich beschäftigt und diese mit dem Dienstleistungssektor vergleicht. Die Zielsetzung ist die Untersuchung, inwiefern diese Gruppe als Prototyp für die neue Tätigkeitsgesellschaft gilt. Die Arbeit skizziert den methodischen Ansatz und den Aufbau der Untersuchung.
2 Definitionen: Dieses Kapitel liefert zentrale Definitionen für die Arbeit. Es werden die Begriffe Kultur und Arbeit, atypische Beschäftigung, Work-Life-Balance, alleinselbständige in Kulturberufen, Arbeit vs. Tätigkeit und Prototyp präzise abgegrenzt und im Kontext der Forschungsfrage erläutert. Die Definitionen legen die Grundlage für eine eindeutige und vergleichbare Analyse der untersuchten Gruppen.
3 Forschungsmethodik: Das Kapitel beschreibt detailliert die angewandte Forschungsmethode, das Leitfadeninterview. Es wird die Entwicklung der Interviewfragen, die Auswahl der Interviewpartner und die Vorgehensweise bei der Transkription und Auswertung der Daten erläutert. Die Methodik wird transparent dargestellt, um die Validität und Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
4 Von der Industrie- zur Wissens- und Kulturgesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet den gesellschaftlichen Wandel von der Industrie- zur Wissens- und Kulturgesellschaft. Es werden theoretische Modelle wie die Sektorentheorie und der Kondratjewzyklus herangezogen, um den Strukturwandel zu erklären. Es wird auf den Wertewandel, das sich verändernde Menschenbild, demografische Aspekte und das veränderte Rollenverständnis eingegangen. Die Kapitel analysiert die Entwicklung des Arbeitsmarktes, insbesondere die zunehmende Bedeutung von atypischen Beschäftigungsverhältnissen und Selbstständigkeit.
5 Work-Life-Balance: Dieses Kapitel widmet sich zentral dem Thema Work-Life-Balance. Es werden verschiedene Aspekte beleuchtet, wie beispielsweise der Einfluss der Unternehmenskultur, flexible Führungsstrukturen und betriebliche Maßnahmen zur Verbesserung der Work-Life-Balance. Der Kapitel untersucht kritisch den Grad der persönlichen Balance und analysiert dabei zeitliches Bewusstsein, Multidimensionalität nach Kastner, Identität und Identifikation, Lebensziele, Zufriedenheit und familiäre Rahmenbedingungen.
Schlüsselwörter
Work-Life-Balance, Alleinselbständige, Kulturberufe, Dienstleistungssektor, Atypische Beschäftigung, Gesellschaftlicher Wandel, Tätigkeitsgesellschaft, Prekarisierung, Flexibilisierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: Work-Life-Balance von alleinselbständigen Kulturschaffenden
Was ist das Thema der Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Work-Life-Balance von alleinselbständigen Kulturschaffenden und vergleicht diese mit Beschäftigten im Dienstleistungssektor. Das zentrale Forschungsziel ist die Klärung der Frage, ob alleinselbständige in Kulturberufen als prototypisch für die neue Tätigkeitsgesellschaft angesehen werden können.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Work-Life-Balance in Kulturberufen, Vergleich mit dem Dienstleistungssektor, atypische Beschäftigungsverhältnisse, den Wandel der Arbeitswelt und Prototypen der neuen Tätigkeitsgesellschaft. Es werden gesellschaftliche Veränderungen, der Arbeitsmarkt und verschiedene Aspekte der Work-Life-Balance analysiert.
Welche Methodik wurde angewendet?
Die Forschungsmethode basiert auf Leitfadeninterviews. Die Arbeit beschreibt detailliert die Entwicklung der Interviewfragen, die Auswahl der Interviewpartner und die Vorgehensweise bei der Transkription und Auswertung der Daten. Die Transparenz der Methodik soll die Validität und Zuverlässigkeit der Ergebnisse gewährleisten.
Welche Definitionen werden verwendet?
Das Kapitel "Definitionen" klärt zentrale Begriffe wie Kultur und Arbeit, atypische Beschäftigung, Work-Life-Balance, alleinselbständige in Kulturberufen, Arbeit vs. Tätigkeit und Prototyp. Diese präzisen Definitionen bilden die Grundlage für eine eindeutige und vergleichbare Analyse.
Wie wird der gesellschaftliche Wandel dargestellt?
Der gesellschaftliche Wandel von der Industrie- zur Wissens- und Kulturgesellschaft wird anhand theoretischer Modelle wie der Sektorentheorie und dem Kondratjewzyklus erläutert. Die Arbeit analysiert Wertewandel, das veränderte Menschenbild, demografische Aspekte, das veränderte Rollenverständnis und die Entwicklung des Arbeitsmarktes mit Fokus auf atypische Beschäftigungsverhältnisse und Selbstständigkeit.
Wie wird die Work-Life-Balance untersucht?
Das Kapitel "Work-Life-Balance" beleuchtet verschiedene Einflussfaktoren wie Unternehmenskultur, flexible Führungsstrukturen und betriebliche Maßnahmen. Es analysiert den Grad der persönlichen Balance anhand von Aspekten wie Zeitbewusstsein, Multidimensionalität (nach Kastner), Identität, Identifikation, Lebenszielen, Zufriedenheit und familiären Rahmenbedingungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Work-Life-Balance, Alleinselbständige, Kulturberufe, Dienstleistungssektor, Atypische Beschäftigung, Gesellschaftlicher Wandel, Tätigkeitsgesellschaft und Prekarisierung/Flexibilisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung und Zielsetzung, Definitionen, Forschungsmethodik, Der Wandel von der Industrie- zur Wissens- und Kulturgesellschaft, Work-Life-Balance und Fazit und Ausblick. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel detailliert beschrieben.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Wissenschaftler, die sich mit Work-Life-Balance, atypischen Beschäftigungsverhältnissen und dem Wandel der Arbeitswelt beschäftigen, insbesondere im Kontext der Kultur- und Kreativwirtschaft.
- Citar trabajo
- Jessica Scheffold (Autor), 2009, Work - Life! Balance? Alleinselbständige in Kulturberufen prototypisch für die neue Tätigkeitsgesellschaft?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152232