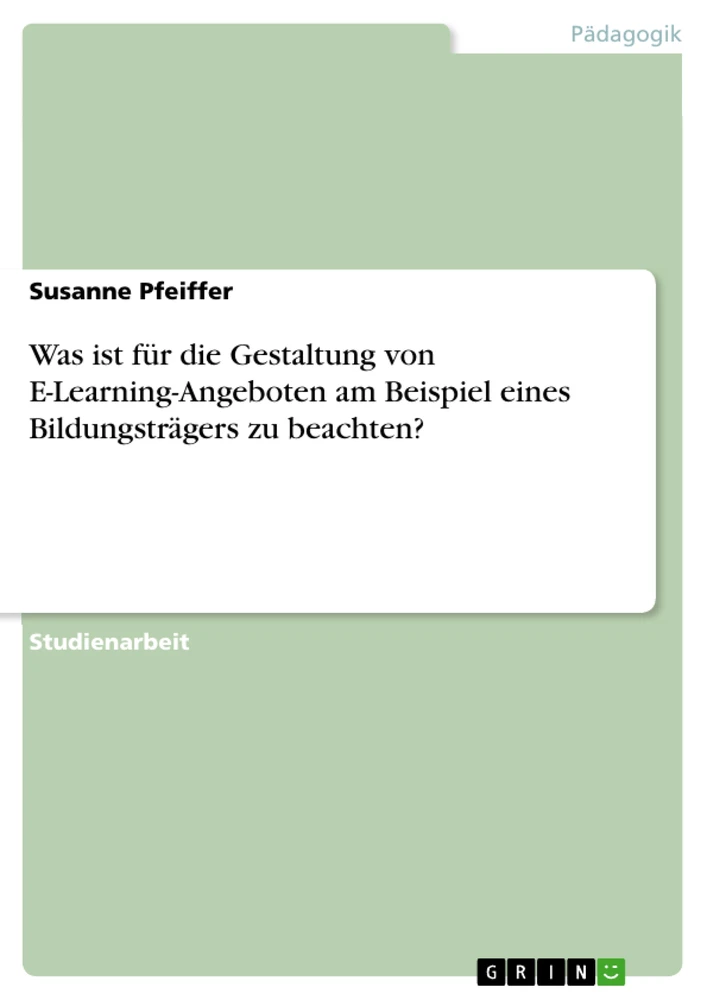In der heutigen Zeit begegnet uns digitales Lernen im nahezu allen Lebensbereichen. Im privaten Bereich sind dies zum Beispiel Anleitungen zu Reparaturen oder Alltagstipps. Im medizinischen Bereich zur ärztlichen Fortbildung mit neuesten funktionsdiagnostischen Hilfsmitteln. Im beruflichen Bereich gibt es ebenfalls zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten mit diversen Medieneinsätzen. Und im schulischen sowie im hochschulichen Bereich werden mit digitalen Hilfsmitteln, vielfach konkrete Lernziele, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt.
Angebote im Bereich E-Leaming (Electronic Learning) finden insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie eine immer weitere Verbreitung, seitens der Bildungseinrichtungen als auch bei den Teilnehmenden. In Baum (2022, S. 395) wird deutlich, dass ein sinnvolles Trainingskonzept auf einer Basis einer detaillierten Zielgruppenanalyse erstellt werden sollte. Diese ist Grundlage für die Lernziele und hat insbesondere bei E-Learning-Angeboten eine hohe Bedeutung. Damit die Teilnehmenden ihr Interesse zeigen und das Wissen erweitern können, müssen unter Berücksichtigung der eingesetzten Medien die Bedürfnisse und Voraussetzungen bekannt sein, um das E-Learning-Angebot dementsprechend zu gestalten. Digitale Medien verfügen über ein vielfältiges Potenzial. Die Vorteile liegen hierbei im tiefgründigeren Lernen, in den Möglichkeiten einer flexiblen Lernorganisation verbunden mit kürzeren Lernzeiten sowie geringeren Kosten.
Auch für kleine Bildungsträger ist die Entwicklung von E-Learning-Angeboten unumgänglich, sodass eine grundlegende Planung notwendig ist, um die Erwartungen von lernenden und lehrenden zu erfüllen und das Lehrangebot entsprechend zu gestalten. Daher ist eine essenzielle Analyse der Zielgruppe sinnvoll, um das Bildungsangebot auf diese abzustimmen.
In der vorliegenden Seminararbeit soll im Rahmen einer Literaturrecherche zunächst der Begriff und die Entwicklung des E-Learnings aufgezeigt werden, sowie die Bedeutung im aktuellen Zeitgeschehen, insbesondere durch die Zeit der Covid-19-Pandemie. Danach erfolgt eine Erläuterung der zusammenhänge von Lerninhalten und Zielgruppe bis hin zur Analyse der Zielgruppe im Allgemeinen. Auf die didaktische Konzeption von Lehr- und Lerninhalten und deren Aspekte erfolgt eine weitere theoretische Fundierung zum Thema.
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1: Einleitung
- Kapitel 2: Theoretische Grundlagen
- 2.1: Konzept A
- 2.2: Konzept B
- Kapitel 3: Empirische Untersuchung
- Kapitel 4: Diskussion der Ergebnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht [hier kurze Beschreibung des Gesamtgegenstands der Arbeit einfügen]. Die Zielsetzung besteht darin, [hier die konkreten Ziele der Arbeit nennen].
- Theoretische Fundierung des Forschungsgegenstands
- Analyse empirischer Daten
- Diskussion der Ergebnisse im Kontext bestehender Literatur
- Ableitung von Schlussfolgerungen und Implikationen
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, stellt den Forschungsgegenstand vor und skizziert die Forschungsfrage(n) der Arbeit. Sie erläutert die Relevanz der Thematik und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit. Besondere Hervorhebung findet hier [hier einen wichtigen Aspekt der Einleitung spezifizieren], der die Grundlage für die folgenden Kapitel bildet. Die Einleitung begründet die Wahl des methodischen Vorgehens und gibt einen Ausblick auf die erwarteten Ergebnisse.
Kapitel 2: Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel präsentiert die theoretischen Grundlagen, auf denen die empirische Untersuchung aufbaut. Es werden relevante Theorien und Konzepte vorgestellt und kritisch diskutiert. Ein Schwerpunkt liegt auf [hier einen wichtigen Aspekt des Kapitels spezifizieren, z.B. einer bestimmten Theorie oder einem Konzept], welches im Detail erklärt und in den Kontext der Forschungsfrage eingeordnet wird. Die Darstellung der theoretischen Grundlagen dient als Basis für die Interpretation der später präsentierten empirischen Daten.
Kapitel 3: Empirische Untersuchung: In diesem Kapitel wird die Methodik der empirischen Untersuchung detailliert beschrieben. Es werden die verwendeten Forschungsmethoden (z.B. quantitative oder qualitative Methoden) erläutert und begründet. Die Datenerhebung und -aufbereitung werden präzise dargestellt, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Die Stichprobe und die verwendeten Messinstrumente werden genau beschrieben, und mögliche Limitationen der Methodik werden offen angesprochen. [hier einen wichtigen Aspekt des Kapitels spezifizieren, z.B. die Art der Datenerhebung oder die angewandte statistische Methode] spielt eine zentrale Rolle in diesem Kapitel.
Kapitel 4: Diskussion der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Ergebnisse werden im Kontext der im zweiten Kapitel vorgestellten theoretischen Grundlagen diskutiert. Es wird geprüft, inwieweit die Hypothesen oder Forschungsfragen bestätigt werden konnten. Dabei werden sowohl erwartete als auch unerwartete Ergebnisse analysiert. Die Diskussion der Ergebnisse beinhaltet auch einen Vergleich mit den Ergebnissen anderer Studien. [hier einen wichtigen Aspekt des Kapitels spezifizieren, z.B. eine besonders relevante Erkenntnis oder ein überraschendes Ergebnis] wird hier ausführlich behandelt.
Schlüsselwörter
Forschungsgegenstand, empirische Untersuchung, theoretische Grundlagen, [weitere Schlüsselbegriffe einfügen], Ergebnisse, Diskussion, Schlussfolgerungen.
Häufig gestellte Fragen zur Sprachevorschau
Was beinhaltet die Sprachevorschau?
Die Sprachevorschau umfasst das Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der Kapitel sowie Schlüsselwörter.
Was ist im Inhaltsverzeichnis enthalten?
Das Inhaltsverzeichnis listet die Kapitel und Unterkapitel der Arbeit auf. Beispiele sind Kapitel zur Einleitung, theoretischen Grundlagen, empirischen Untersuchung und Diskussion der Ergebnisse. Es dient als Navigationshilfe.
Welche Informationen liefert die Beschreibung der "Zielsetzung und Themenschwerpunkte"?
Dieser Abschnitt beschreibt den Gegenstand der Arbeit, die konkreten Ziele, und listet die Themenschwerpunkte auf. Zu den Themenschwerpunkten gehören die theoretische Fundierung, die Analyse empirischer Daten, die Diskussion der Ergebnisse und die Ableitung von Schlussfolgerungen.
Was beinhalten die Kapitelzusammenfassungen?
Die Kapitelzusammenfassungen geben einen kurzen Überblick über den Inhalt jedes Kapitels. Sie beschreiben die Hauptthemen, die Methodik und die wichtigsten Ergebnisse jedes Kapitels. Jedes Kapitel wird kurz zusammengefasst, beginnend mit der Einleitung über theoretische Grundlagen und empirische Untersuchung bis zur Diskussion der Ergebnisse.
Welchen Zweck erfüllen die Schlüsselwörter?
Die Schlüsselwörter identifizieren die wichtigsten Begriffe und Konzepte der Arbeit. Sie dienen der Indexierung und erleichtern die Suche nach relevanten Informationen.
Welche Themen werden in Kapitel 1 behandelt?
Kapitel 1, die Einleitung, führt in die Thematik ein, stellt den Forschungsgegenstand vor, skizziert die Forschungsfragen, erläutert die Relevanz und gibt einen Überblick über den Aufbau der Arbeit.
Was wird in Kapitel 2 behandelt?
Kapitel 2, die theoretischen Grundlagen, präsentiert relevante Theorien und Konzepte, die für die empirische Untersuchung von Bedeutung sind. Es werden Theorien und Konzepte kritisch diskutiert und in den Kontext der Forschungsfrage eingeordnet.
Welchen Inhalt hat Kapitel 3?
Kapitel 3 beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es werden die Forschungsmethoden, Datenerhebung und -aufbereitung, die Stichprobe und die Messinstrumente detailliert erläutert.
Was wird in Kapitel 4 behandelt?
Kapitel 4 präsentiert und interpretiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Die Ergebnisse werden im Kontext der theoretischen Grundlagen diskutiert und mit den Ergebnissen anderer Studien verglichen.
- Arbeit zitieren
- Susanne Pfeiffer (Autor:in), 2023, Was ist für die Gestaltung von E-Learning-Angeboten am Beispiel eines Bildungsträgers zu beachten?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1522677