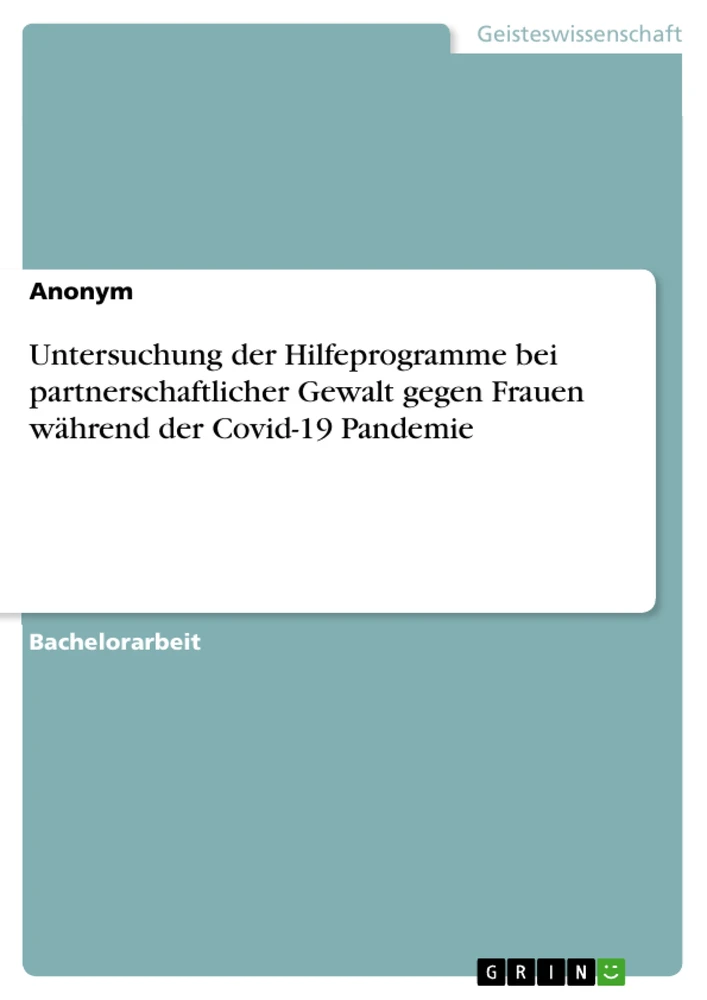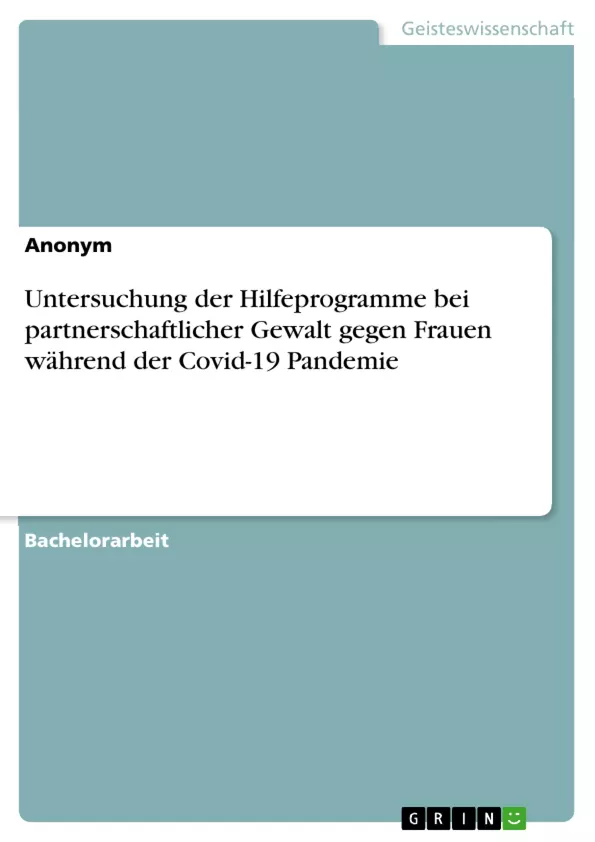Die vorliegende Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Hilfeprogramme bei partnerschaftlicher Gewalt gegen Frauen. Der Fokus liegt dabei darauf, was die Soziale Arbeit für zukünftige Ausnahmesituationen lernen kann. Die theoretische Ausarbeitung umfasst Definitionen, Ausdrucksformen sowie Ursachen und Risikofaktoren, basierend auf dem Vierebenen-Modell. Professionelle Ansätze zur Prävention und Intervention in Deutschland werden vorgestellt, bevor der Fokus auf den Verlauf der COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen auf partnerschaftliche Gewalt und Hilfsangebote gerichtet wird. Die empirische Untersuchung basiert auf sieben Fachexpert:inneninterviews, die Einblicke in die Pandemiezeit und den Lehren daraus liefern. Die gewonnenen Erkenntnisse illustrieren das komplexe Geflecht der Pandemie auf Hilfeprogramme von partnerschaftlicher Gewalt und zeigen Herausforderungen für die Soziale Arbeit auf. Die Pandemie bedingten Anpassungen in Hilfsangeboten, einschließlich reduzierter Verfügbarkeit und technologischer Herausforderungen, werden aufgezeigt. Ebenso werden die gestiegene Arbeitsbelastung für Fachkräfte sowie die Lehren und Forderungen für die Zukunft diskutiert.
Diese Erkenntnisse bieten wertvolle Lehren für die Soziale Arbeit, betonen die Bedeutung von Flexibilität, digitaler Infrastruktur und Veränderung der Rahmenbedingungen. Die Arbeit schlussfolgert mit Handlungsideen für die Praxis, darunter verstärkte Unterstützung für Betroffene, flexible Zugangswege und eine kraftvolle Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft.
Inhaltsverzeichnis
- Abstract
- Tabellen- und Abbildungsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Forschungsfrage
- 1.2 Zielsetzung der Arbeit
- 1.3 Motivation
- 1.4 methodisches Vorgehen
- 1.5 Hinweis zur spezifischen Betrachtung innerhalb des Themas
- 2. Theoretische Ausarbeitung
- 2.1 Definition von partnerschaftlicher Gewalt
- 2.2 Formen von partnerschaftlicher Gewalt
- 2.2.1 Physische Gewalt
- 2.2.2 Psychische Gewalt
- 2.2.3 Sexualisierte Gewalt
- 2.2.4 Ökonomische Gewalt
- 2.2.4 Soziale Gewalt
- 2.3 Ursachen, Risikofaktoren und Entstehung von partnerschaftlicher Gewalt
- 2.3.1 Vier-Ebenen-Modell
- 2.3.2 Gewaltzyklus
- 2.4 Professionelle Präventions- und Interventionsangebote
- 2.4.1 Bildungs- und Präventionsarbeit
- 2.4.2 Beratungsstellen
- 2.4.3 Frauenhäuser
- 2.5 COVID-19-Pandemie und partnerschaftliche Gewalt
- 2.5.1 COVID-19-Pandemie
- 2.5.2 Chronik der Coronapandemie in Deutschland
- 2.5.3 Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Gewalt in Partnerschaften
- 2.5.4 Veränderungen in den Hilfeprogrammen durch die Coronapandemie
- 3. Zwischenfazit
- 3.1 Ableitung der Hypothesen
- 4. Empirische Ausarbeitung
- 4.1 Methodik
- 4.1.1 Das Expert:inneninterview
- 4.1.1.1 Interviewleitfaden
- 4.1.1.2 Auswahl und Vorstellung der Expert:innen
- 4.1.1.3 Vorüberlegungen und Durchführung der Interviews
- 4.1.2 Gütekriterien qualitativer Sozialforschung
- 4.1.3 Auswertungsmethoden
- 4.1.3.1 Transkription
- 4.1.3.2 Qualitative Inhaltsanalyse
- 4.1.1 Das Expert:inneninterview
- 4.2 Ergebnisse
- 4.2.1 Definition partnerschaftliche Gewalt
- 4.2.2 Ursachen und Risikofaktoren von partnerschaftlicher Gewalt
- 4.2.3 Neue Auslöser durch veränderte Lebensumstände
- 4.2.4 Auswirkungen der Pandemie auf die Zahlen von partnerschaftlicher Gewalt
- 4.2.5 Spezifische Anliegen während der Pandemie
- 4.2.6 Veränderung der Hilfsangebote aufgrund der Pandemiebedingungen
- 4.2.7 Bereitstellungsbeeinträchtigungen der Hilfsangebote durch die Pandemie
- 4.2.8 Lehren aus der Pandemie für die Vorbereitung auf zukünftige Krisensituationen
- 4.1 Methodik
- 5. Diskussion
- 5.1 Kritische Reflexion
- 5.2 Einordnung der Ergebnisse in den theoretischen Hintergrund
- 5.3 Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf die Hypothesen und die Forschungsfrage
- 5.4 Implikationen für die Praxis
- 5.4.1 Verstärkte Unterstützungsmaßnahmen für Betroffene
- 5.4.2 Flexible und kreative Zugangsmöglichkeiten und Angebote
- 5.4.3 Interessenvertretung der Sozialen Arbeit in Politik und Gesellschaft
- 5.5 Limitationen der Studie und Ausblick auf zukünftige Forschung
- 6. Schlussteil
- 6.1 Zusammenfassung
- 6.2 Resümee
- 6.3 Ausblick für das Handlungsfeld der Sozialen Arbeit
- 6.4 Danksagung
- Literaturverzeichnis
- Anhang
- 1. Interviewleitfaden
- 2. Transkripte der Experteninterviews inkl. Einwilligungserklärungen
- 3. Kodierleitfaden
- 4. Codierte Segmente
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Hilfsprogramme bei partnerschaftlicher Gewalt gegen Frauen und leitet daraus Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit in zukünftigen Ausnahmesituationen ab. Der Fokus liegt auf den Erfahrungen von Expert:innen im Umgang mit den Pandemiebedingungen.
- Definition und Erscheinungsformen partnerschaftlicher Gewalt
- Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Dynamik partnerschaftlicher Gewalt
- Anpassungsstrategien von Hilfsprogrammen während der Pandemie
- Herausforderungen und Ressourcen in der Arbeit mit betroffenen Frauen
- Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit in zukünftigen Krisen
Zusammenfassung der Kapitel
**1. Einleitung**: Diese Einleitung stellt die Problematik partnerschaftlicher Gewalt gegen Frauen dar und führt in die Forschungsfrage ein: Was kann die Soziale Arbeit im Hinblick auf Hilfsangebote bei partnerschaftlicher Gewalt für zukünftige Ausnahmesituationen lernen? Die Zunahme häuslicher Gewalt während der Pandemie wird thematisiert und die Zielsetzung der Arbeit, Handlungsempfehlungen für zukünftige Krisensituationen zu liefern, wird formuliert. Das methodische Vorgehen, basierend auf Expert:inneninterviews, wird skizziert. **2. Theoretische Ausarbeitung**: Dieses Kapitel liefert die theoretischen Grundlagen zum Verständnis von partnerschaftlicher Gewalt. Es definiert den Begriff, beschreibt verschiedene Formen der Gewalt (physisch, psychisch, sexualisiert, ökonomisch, sozial) und erläutert Ursachen und Risikofaktoren anhand des Vier-Ebenen-Modells und des Gewaltzyklus. Es werden professionelle Präventions- und Interventionsangebote in Deutschland (Bildungs- und Präventionsarbeit, Beratungsstellen, Frauenhäuser) vorgestellt und die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf partnerschaftliche Gewalt und die Hilfsangebote werden diskutiert. **3. Zwischenfazit**: Dieses Kapitel fasst die wichtigsten Erkenntnisse der theoretischen Ausarbeitung zusammen und leitet daraus die zentralen Hypothesen ab, die im empirischen Teil der Arbeit überprüft werden. **4. Empirische Ausarbeitung**: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung, die auf sieben Expert:inneninterviews basiert. Die Auswahl der Expert:innen, die Durchführung der Interviews und die verwendeten Auswertungsmethoden (qualitative Inhaltsanalyse) werden detailliert dargestellt. Die Ergebnisse der Interviews werden in verschiedenen Kategorien präsentiert und diskutiert (Definition partnerschaftlicher Gewalt, Ursachen, veränderte Lebensumstände, Auswirkungen der Pandemie auf die Zahlen, spezifische Anliegen, Veränderungen der Hilfsangebote, Bereitstellungsbeeinträchtigungen, Lehren aus der Pandemie). **5. Diskussion**: Dieses Kapitel reflektiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung kritisch, ordnet sie in den theoretischen Rahmen ein und diskutiert sie im Hinblick auf die Forschungsfrage. Es werden Handlungsempfehlungen für die Praxis abgeleitet und die Limitationen der Studie sowie der Ausblick auf zukünftige Forschung werden dargelegt.Schlüsselwörter
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Fokus dieser Arbeit über partnerschaftliche Gewalt?
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Hilfsprogramme bei partnerschaftlicher Gewalt gegen Frauen und leitet daraus Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit in zukünftigen Ausnahmesituationen ab. Der Fokus liegt auf den Erfahrungen von Expert:innen im Umgang mit den Pandemiebedingungen.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem Definition und Erscheinungsformen partnerschaftlicher Gewalt, Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Dynamik partnerschaftlicher Gewalt, Anpassungsstrategien von Hilfsprogrammen während der Pandemie, Herausforderungen und Ressourcen in der Arbeit mit betroffenen Frauen sowie Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit in zukünftigen Krisen.
Was ist die zentrale Forschungsfrage?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Was kann die Soziale Arbeit im Hinblick auf Hilfsangebote bei partnerschaftlicher Gewalt für zukünftige Ausnahmesituationen lernen?
Welche Formen partnerschaftlicher Gewalt werden unterschieden?
Es werden verschiedene Formen der Gewalt unterschieden, darunter physische Gewalt, psychische Gewalt, sexualisierte Gewalt, ökonomische Gewalt und soziale Gewalt.
Welche theoretischen Modelle werden zur Erklärung von partnerschaftlicher Gewalt herangezogen?
Zur Erklärung von partnerschaftlicher Gewalt werden das Vier-Ebenen-Modell und der Gewaltzyklus herangezogen.
Welche professionellen Hilfsangebote werden vorgestellt?
Es werden professionelle Präventions- und Interventionsangebote in Deutschland vorgestellt, darunter Bildungs- und Präventionsarbeit, Beratungsstellen und Frauenhäuser.
Wie hat sich die COVID-19-Pandemie auf partnerschaftliche Gewalt ausgewirkt?
Die COVID-19-Pandemie hat die Dynamik partnerschaftlicher Gewalt beeinflusst und zu einer Zunahme häuslicher Gewalt geführt. Zudem hat die Pandemie Auswirkungen auf die Hilfsangebote gehabt.
Welche Methodik wurde für die empirische Untersuchung verwendet?
Für die empirische Untersuchung wurden Expert:inneninterviews durchgeführt. Die Auswertung erfolgte mittels qualitativer Inhaltsanalyse.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind Partnerschaftliche Gewalt, häusliche Gewalt, COVID-19-Pandemie, Soziale Arbeit, Frauenhäuser, Beratungsstellen, Prävention, Intervention, Expert:inneninterviews, Qualitative Inhaltsanalyse, Handlungsempfehlungen, Krisenintervention, Dunkelfeldforschung, Resilienz, Digitalisierung und Istanbul-Konvention.
Welche Handlungsempfehlungen werden für die Soziale Arbeit abgeleitet?
Es werden Handlungsempfehlungen abgeleitet, die verstärkte Unterstützungsmaßnahmen für Betroffene, flexible und kreative Zugangsmöglichkeiten und Angebote sowie die Interessenvertretung der Sozialen Arbeit in Politik und Gesellschaft umfassen.
- Arbeit zitieren
- Anonym (Autor:in), 2023, Untersuchung der Hilfeprogramme bei partnerschaftlicher Gewalt gegen Frauen während der Covid-19 Pandemie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/1522945