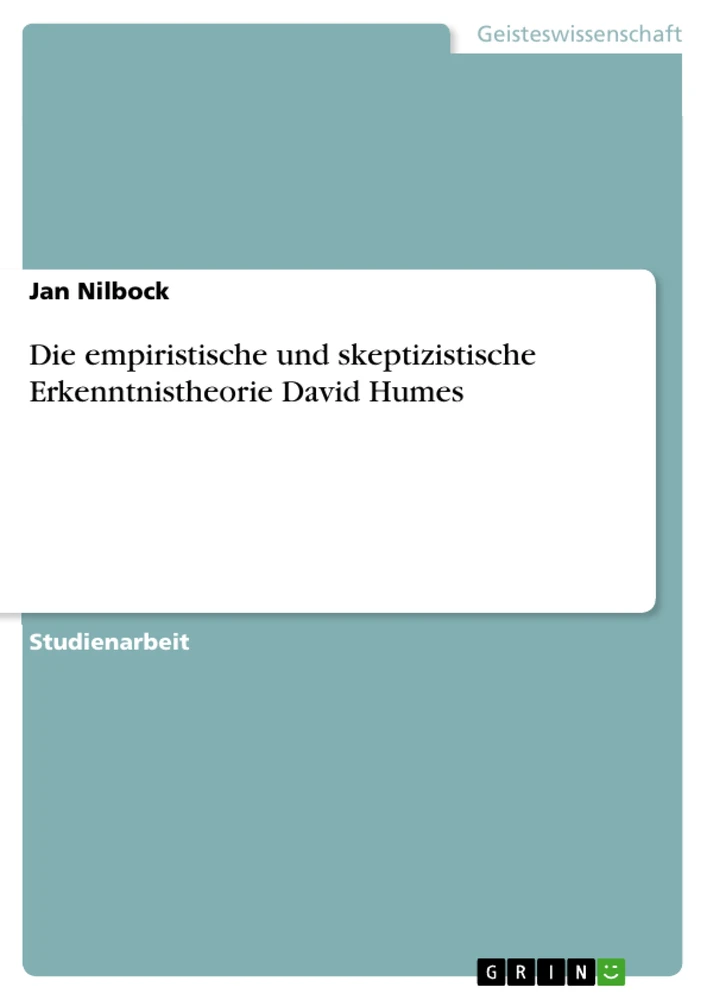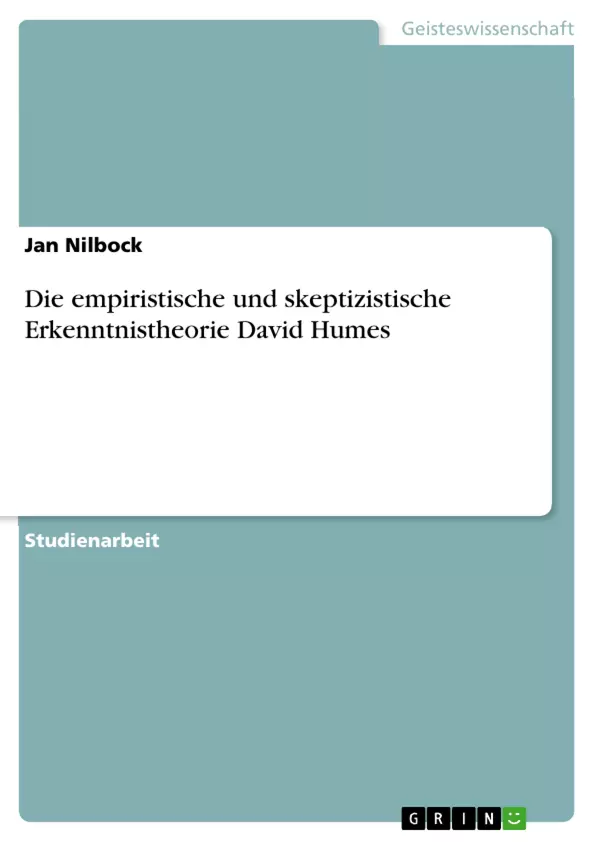Diese Arbeit wurde in erster Linie geschrieben, um dem Leser einen groben Überblick über Humes Erkenntnistheorie, oder Theory of Knowledge bzw. Theory of Mind, wie sie im englischsprachigen Raum bezeichnet wird, zu vermitteln und somit eine kurze, bündige und gut verständliche Einführung in diesen Teil seines Werks zu bieten. Dabei habe ich mich an Humes späterem Werk „An Enquiry Concerning Human Understanding“ aus dem Jahre 1758 (bzw. der deutschen Übersetzung mit dem Titel „Untersuchung in Betreff des menschlichen Verstandes“ von Julius H. von Kirchmann, 1869) orientiert (in Zitaten wurde die Rechtschreibung angeglichen), welches sich auf das erste Buch seines früheren Werkes „Treatise of Human Nature“ von 1739/40 bezieht, in dem er bereits eine ausführliche Theorie zum menschlichen Verstand entwickelt hatte. Da Hume später jedoch selbst nur an seinem späteren und überarbeiteten Werk gemessen werden wollte (vgl. Vorwort zur Enquiry), wurde diesem Wunsch hier entsprochen. Wer sich allerdings intensiver mit der Thematik beschäftigen möchte, dem sei trotzdem geraten, sich auch mit der Treatise auseinanderzusetzen, da diese umfangreicher ist und eingehendere Erläuterungen enthält als die Enquiry. Des Weiteren wurden diverse aktuelle englische bzw. amerikanische Monographien zur genaueren Auseinandersetzung mit Humes Erkenntnistheorie herangezogen, um die moderne Sicht und Einschätzung seines Werkes nicht außer Acht zu lassen. In den Fußnoten stehen größtenteils Kommentare, die an der einen oder anderen Stelle Anregungen zu Interpretationsmöglichkeiten geben oder mögliche Schwierigkeiten und Unstimmigkeiten in Humes Abhandlung aufzeigen sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 EINLEITUNG
- 2 HAUPTTEIL
- 2.1 Allgemeines zu David Hume
- 2.1.1 Leben und Werk
- 2.1.2 Einflüsse auf Hume
- 2.2 Zum Erkenntnisproblem
- 2.2.1 Ursprung und Verbindung von Vorstellungen
- 2.2.2 Skeptische Zweifel über die Verstandestätigkeit
- 2.3 Einordnung von Humes Erkenntnistheorie
- 2.3.1 Schwächen und Mängel
- 2.3.2 Auswirkungen und Bedeutung von Humes Werk
- 3 SCHLUSS
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet eine umfassende Einführung in die empiristische und skeptische Erkenntnistheorie von David Hume. Der Fokus liegt auf seiner späteren Arbeit „An Enquiry Concerning Human Understanding“, die eine Neufassung des ersten Buches seiner „Treatise of Human Nature“ darstellt. Die Arbeit beleuchtet Humes Leben und Werk, seine philosophischen Einflüsse und die zentralen Elemente seiner Erkenntnistheorie. Ziel ist es, dem Leser einen klaren und verständlichen Einblick in Humes Theorie des menschlichen Verstandes zu vermitteln.
- Humes Leben und Werk
- Einflüsse auf Humes Philosophie
- Der Ursprung und die Verbindung von Vorstellungen
- Skeptische Zweifel über die Verstandestätigkeit
- Die Einordnung und Bedeutung von Humes Erkenntnistheorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über die Arbeit und erläutert den Fokus auf Humes „An Enquiry Concerning Human Understanding“. Der Hauptteil beginnt mit einem Einblick in Humes Leben und Werk, einschließlich seiner frühen Einflüsse und der Entstehung seiner Erkenntnistheorie. Im Anschluss wird das Kernstück von Humes Erkenntnistheorie behandelt, nämlich der Ursprung und die Verbindung von Vorstellungen sowie die skeptischen Zweifel über die Verstandestätigkeit. Das Kapitel über die Einordnung von Humes Erkenntnistheorie befasst sich mit den Stärken und Schwächen seines Ansatzes und seiner Bedeutung für spätere Philosophen.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter, die Humes Werk prägen, sind Empirismus, Skeptizismus, Erkenntnistheorie, Vorstellung, Verstand, Kausalität, Induktion, Vernunft, Moral und Religion. Humes Kritik an der traditionellen Metaphysik und seine Betonung der Erfahrung als Grundlage des Wissens prägen seine Philosophie. Er stellt zentrale Fragen nach der Gültigkeit von Induktionsschlüssen und den Grenzen der menschlichen Erkenntnisfähigkeit.
- Quote paper
- Jan Nilbock (Author), 2005, Die empiristische und skeptizistische Erkenntnistheorie David Humes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/152295